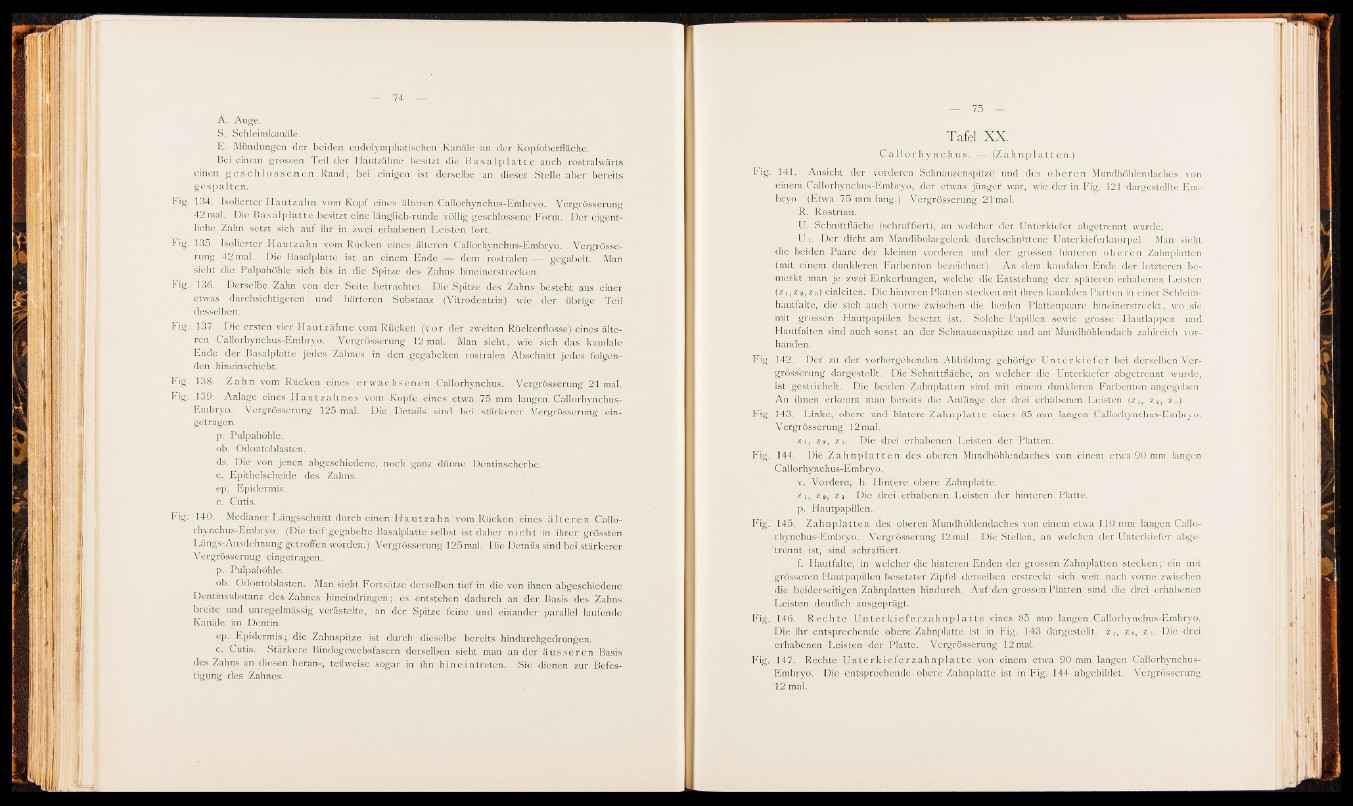
A. Auge.
S. Schleimkanäle.
E. Mündungen der beiden endolymphatischen Kanäle an der Kopfoberfläche.
Bei einem grossen Teil der .Hautzähne besitzt die B a s a l p l a t t e auch rostralwärts
einen g e s c h l o s s e n e n Rand; bei einigen ist derselbe an dieser Stelle aber bereits
g e s p a lt e n .
134. Isolierter H a u tz a h n vom Kopf eines älteren Callorhynchus-Embryo. Vergrösserung
4 2 mal. Die B a s a lp la t t e besitzt eine länglich-runde völlig geschlossene Form. Der eigentliche
Zahn setzt sich auf ihr in zwei erhabenen Leisten fort.
135. Isolierter H au tzah n vom Rücken eines älteren Callorhynchus-Embryo. Vergrösserung
42 mal. Die Basalplatte ist an einem Ende — dem rostralen — gegabelt. Man
sieht die Pulpahöhle sich bis in die Spitze des Zahns hineinerstrecken.
136. Derselbe Zahn von der Seite betrachtet. Die Spitze des Zahns besteht aus einer
etwas durchsichtigeren und härteren Substanz (Vitrodentrin) wie der übrige Teil
desselben.
137. Die ersten vier H a u t z ä h n e vom Rücken (v o r der zweiten Rückenflosse) eines älteren
Callorhynchus-Embryo. Vergrösserung 12 mal. Man sieht, wie sich das kaudale
Ende der Basalplatte jedes Zahnes in den gegabelten rostralen Abschnitt jedes folgenden
hineinschiebt.
138. Z a h n vom Rücken eines e r w a c h s e n e n Callorhynchus. Vergrösserung 21 mal.
139. Anlage eines H a u t z a h n e s vom Kopfe eines etwa 75 mm langen Callorhynchus-
Embryo. Vergrösserung 125 mal. Die Details sind bei stärkerer Vergrösserung eingetragen.
p. Pulpahöhle,
ob. Odontoblasten.
ds. Die von jenen abgeschiedene, noch ganz dünne Dentinscherbe,
e. Epithelscheide des Zahns,
ep. Epidermis,
c. Cutis.
140. Medianer Längsschnitt durch einen H a u t z a h n vom Rücken eines ä l t e r e n Calloi,
rhynchus-Embryo. (Die tie f gegabelte Basalplatte selbst ist daher n i c h t in ihrer grössten
Längs-Ausdehnung getroffen worden.) Vergrösserung 1 2 5mal. Die Details sind bei stärkerer
Vergrösseruug eingetragen.
p. Pulpahöhle.
ob. Odontoblasten. Man sieht Fortsätze derselben tie f in die von ihnen abgeschiedene
Dentinsubstanz des Zahnes hineindringen; es entstehen dadurch an der Basis des Zahns
breite und unregelmässig verästelte, an der Spitze feine und einander parallel laufende
Kanäle im Dentin.
ep. Epidermis ; die Zahnspitze ist durch dieselbe bereits hindurchgedrungen,
c. Cutis. Stärkere Bindegewebsfasern derselben sieht man an der ä u s s e r e n Basis
des Zahns an diesen heran-, teilweise sogar in ihn h in e in tr e te n . Sie dienen zur Befestigung
des Zahnes.
- 75 | l i | l
Tafel XX.
C a l l o r h y n c h u s g | | | | (Z.ahnp 1 a 1 1 en.)
141. Ansicht der vorderen Schnauzenspitze und des o b e r e n Mundhöhlendaches von
einem Callorhynchus-Embryo, der etwas jünger war, wie der in Fig. 121 dargestellte Embryo.
(Etwa 75 mm lang.) Vergrösserung 21 mal.
R. Rostrum.
U. Schnittfläche (schraffiert), an welcher der Unterkiefer abgetrennt wurde.
U i. Der dicht am Mandibulargelenk durchschnittene Unterkieferknorpel. Man sieht
die beiden Paare der kleinen vorderen und der grossen hinteren o b e r e n Zahnplatten
(mit einem dunkleren Farbenton bezeichnet). An dem kaudalen Ende der letzteren bemerkt
man je zwei Einkerbungen, welche die Entstehung der späteren erhabenen Leisten
(z i, z 2, z 3) einleiten. Die hinteren Platten stecken mit ihren kaudalen Partien in einer Schleimhautfalte,
die sich auch vorne zwischen die beiden Plattenpaare hineinerstreckt, wo sie
mit grossen Hautpapillen besetzt ist. Solche Papillen sowie grosse Hautlappen und
Hautfalten sind auch sonst an der Schnauzenspitze und am Mundhöhlendach zahlreich vorhanden.
142. Der zu der vorhergehenden Abbildung gehörige U n t e r k i e f e r bei derselben Vergrösserung
dargestellt. Die Schnittfläche, an welcher die Unterkiefer abgetrennt wurde,
ist gestrichelt. Die beiden Zahnplatten sind mit einem dunkleren Farbenton angegeben.
An ihnen erkennt man bereits die Anfänge der drei erhabenen Leisten (z j, z 2, z 3).
143. Linke, obere und hintere Z a h n p la tte eines 85 mm langen Callorhynchus-Embryo.
V ergrösserung 12 mal.
z i, z 2, Z3. Die drei erhabenen Leisten der Platten.
144. Die Z a h n p l a t t e n des oberen Mundhöhlendaches von einem etwa 90 mm langen
Callorhynchus-Embryo.,
v. Vordere, h. Hintere obere Zahnplatte.
z i, z 2, z 3. Die drei erhabenen Leisten der hinteren Platte.
p. Hautpapillen.
145. Z a h n p la tte n des oberen Mundhöhlendaches von einem etwa 110 mm langen Callorhynchus
Embryo. Vergrösserung 12 mal. Die Stellen, an welchen der Unterkiefer abgetrennt
ist, sind schraffiert.
f. Hautfalte, in welcher die hinteren Enden der grossen Zahnplatten stecken; ein mit
grösseren Hautpapillen besetzter Zipfel derselben erstreckt sich weit nach vorne zwischen
die beiderseitigen Zahnplatten hindurch. Auf den grossen Platten sind die drei erhabenen
Leisten deutlich ausgeprägt.
146. R e c h t e U n t e r k i e f e r z a h n p l a t t e eines 85 mm langen Callorhynchus-Embryo.
Die ihr entsprechende obere Zahnplatte ist in Fig. 143 dargestellt, z i, z*, Zs. Die drei
erhabenen Leisten der Platte. Vergrösserung 12 mal.
147. Rechte: U n t e r k i e f e r z a h n p l a t t e von einem etwa 90 mm langen Callorhynchus-
Embryo. Die entsprechende obere Zahnplatte ist in Fig. 144 abgebildet. Vergrösserung
12 mal.