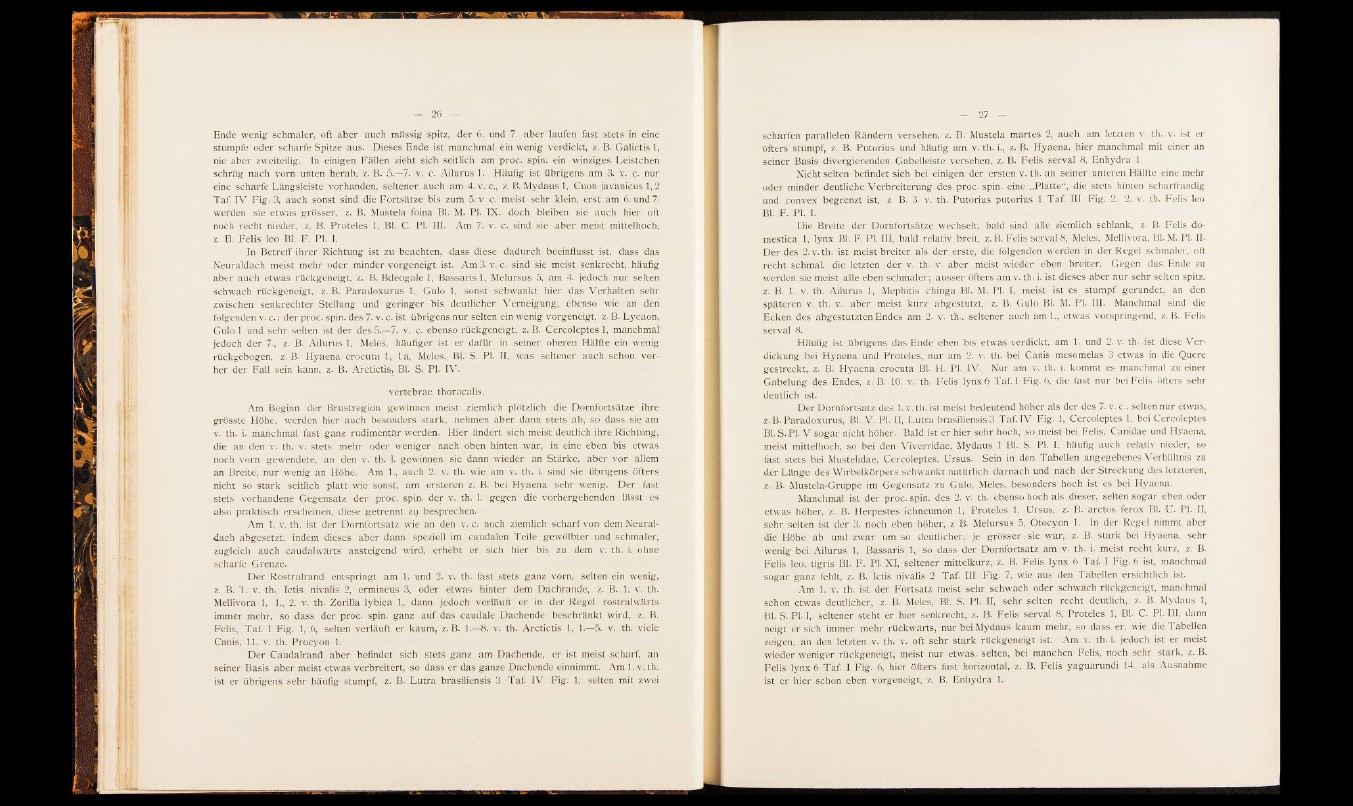
Ende wenig schmaler, oft aber auch mässig spitz, der 6. und 7. aber laufen fast stets in eine
stumpfe oder scharfe Spitze aus. Dieses Ende ist manchmal ein wenig verdickt, z. B. Galictis f |
nie aber zweiteilig. In einigen Fällen zieht sich seitlich am proc. spin. ein winziges Leistchen
schräg nach vorn unten herab, z. B. 5.—7. v. c- Ailurus 1. Häufig ist übrigens am 3. v. c. nur
eine scharfe Längsleiste vorhanden, seltener auch am 4. v. c,, z. B. Mydausl, Cuon javanicus 1,2
Taf. IV Fig. 3, auch sonst sind die Fortsätze bis zum 5. v. c. meist sehr klein, erst am 6. und 7:
werden sie etwas grösser, z. B. Mustela foina Bl. M. PI. IX, doch bleiben sie auch hier oft
noch recht nieder, z. B. Proteles 1, Bl. C. PI. III. Am 7. v. e. sind sie aber meist mittelhoch,
z. B. Felis leo Bl. F. PI. I.
In Betreff ihrer Richtung ist zu beachten, dass diese dadurch beeinflusst ist, dass das
Neuraldach meist mehr oder minder vorgeneigt .ist. Am 3. v. c. sind sie meist senkrecht, häufig
aber auch etwas rückgeneigt, z. B. Bdeogale 1, Bassaris 1, Melursus 5, am 4. jedoch nur selten
schwach rückgeneigt, z. B. Paradoxurus 1, Gulo 1, sonst schwankt hier das Verhalten sehr
zwischen senkrechter Stellung und geringer bis deutlicher Verneigung, ebenso wie an den
folgenden v. c.; der proc. spin. des 7. v. c. ist übrigens nur selten ein wenig vorgeneigt, z. B. Lycaon,
Gulo 1 und sehr selten ist der des 5.-7. v. c. ebenso rückgeneigt, z. B. Cercoleptes 1, manchmal
jedoch der 7., z. B. Ailurus 1, Meies, häufiger ist er dafür in seiner oberen Hälfte ein wenig
rückgebogen, z.B. Hyaena crocuta 1, la, Meies, Bl. S. PL II, was seltener auch schon vorher
der Fall sein kann, z. B. Arctictis, Bl. S. PL IV.
vertebrae thoracalis.
Am Beginn der Brustregion gewinnen meist ziemlich plötzlich die Dornfortsätze ihre
grösste Höhe, werden hier auch besonders stark, nehmen aber dann stets ab, so dass sie am
v. th. i. manchmal fast ganz rudimentär werden. Hier ändert sich meist deutlich ihre Richtung,
die an den v. th. v. stets mehr oder weniger nach oben hinten war, in eine eben bis etwas
noch vorn gewendete, an den v. th. 1. gewinnen sie dann wieder an Stärke, aber vor allem
an Breite, nur wenig an Höhe. Am 1., auch 2. v. th. wie am v. th. i. sind sie übrigens, öfters
nicht so stark seitlich platt wie sonst, am ersteren z. B. bei Hyaena sehr wenig. Der fast
stets vorhandene Gegensatz der proc. spin. der v. th. 1. gegen die vorhergehenden läSst es
also praktisch erscheinen, diese getrennt zu besprechen.
Am 1. v. th. ist der Dornfortsatz wie an den v. c. noch ziemlich scharf von dem Neuraldach
abgesetzt, indem dieses aber dann speziell im caudalen Teile gewölbter und schmaler,
zugleich auch caudalwärts ansteigend wird, erhebt er sich hier bis zu dem v. th. i. ohne
scharfe Grenze.
Der Rostralrand entspringt am 1. und 2. V. th. fast stets ganz vorn, selten ein wenig,
z. B. '1. v. th. Ictis nivalis 2, ermineus 3, oder etwas hinter dem Dachrande, z. B. 1. v. th.
Mellivora 1, 1., 2. v. th. Zorilla lybica 1, dann jedoch verläuft er in der Regel rosträlwärts
immer mehr, so dass der proc. spin. ganz auf das caudale Dachende beschränkt wird, z. B.
Felis, Taf. I Fig. 1, 6, selten verläuft er kaum, z,B. 1.—8. y. th. Arctictis 1, 1.—5. v. th. viele
Canis, 11. v. th. Procyon 1.
Der Caudalrand aber befindet sich stets ganz am Dachende, er ist meist scharf, an
seiner Basis aber meist etwas verbreitert, so dass er das ganze Dachende einnimmt. Am 1. v. th.
ist er übrigens sehr häufig stumpf, z. B. Lutra brasiliensis 3 Taf. IV Fig. 1, selten mit zwei
scharfen parallelen Rändern versehen, z. B. Mustela martes 2, auch am letzten v. th. v. ist er
öfters stumpf, z. B. Putorius und häufig am v. th. i., z, B. Hyaena, hier manchmal mit einer an
seiner Basis divergierenden Gabelleiste versehen, z. B. Felis serval 8, Enhydra 1.
Nicht selten befindet sich bei einigen der ersten v. th. an seiner unteren Hälfte eine mehr
oder minder deutliche Verbreiterung des proc. spin. eine „Platte“, die stets hinten scharfrandig
und convex begrenzt ist,? z. B. 3. v. th. Putorius putorius 1 Taf. III Fig. 2, 2. v. th. Felis leo
BL F. Pl. I.
Die Breite der Dornfortsätze wechselt, bald sind alle ziemlich schlank, z. B. Felis do-
mestica 1, lynx BL F. Pl. III, bald relativ breit, z.B.Felis serval8, Meies, Mellivora, BL M. PL II.
Der dés 2. v. th. ist meist breiter als der erste, die folgenden werden in der Regel schmaler, oft
recht schmal, die letzten der v. th. y.. aber meist wieder eben breiter. Gegen das Ende zu
werden sie meist alle eben schmaler; ausser öfters am v. th. i. ist dieses aber nur sehr selten spitz,
zv B.ljj. v . th. Ailurus 1 , Mephitis chinga BL M. Pl. I, meist ist es stumpf gerundet, an den
späteren v. th. v. aber meist kurz abgestutzt, z. B. Gulo Bl. M. Pl. III. Manchmal sind die
Ecken des abgestutzten Endes am 2. v. th., seltener auch am 1., etwas vorspringend, z.B. Felis
serval 8.H
äufig ist übrigens das Ende eben bis etwas verdickt, am 1. und 2. v. th. ist diese Verdickung
bei Hyaena und Proteles, nur am 2. v. th. bei Canis mesomelas 3 etwas in die Quere
gestreckt, z. B. Hyaena crocuta B1. H. Pl. IV. Nur am v. th. i. kommt es manchmal zu einer
Gabelung des Endes, z. B. 10. v. th. Felis lynx 6 Taf. I Fig. 6, die fast nur bei Felis öfters sehr
deutlich ist.
Der Dornfortsatz des 1. v. th. ist meist bedeutend höher als der des 7. v. c., selten nur etwas,
z. B. Paradoxurus, BL V. Pl. II, Lutra brasiliensis 3 Taf. IV Fig. 1, Cercoleptes 1, bei Cercoleptes
BL S. Pl. V sogar nicht höher. Bald ist er hier sehr hoch, so. meist bei Felis, Canidae und Hyaena,
meist mittelhoch, so bei den Viverridae, Mj'daus 1 Bl. S. PL I, häufig auch relativ nieder, so
fast stets bei Mustelidae, Cercoleptes, Ursus. Sein in den Tabellen angegebenes Verhältnis zu
der Länge des Wirbelkörpers schwankt natürlich darnach und nach der Streckung des letzteren,
z. B. Mustela-Gruppe im Gegensatz, zu Gulo, Meies, besonders hoch ist es bei Hyaena.
Manchmal ist der proc. spin. des 2. v. th. ebenso hoch als dieser, selten sogar eben oder
etwas höher, z. B. Herpestes ichneumon 1, Proteles 1, Ursus, z. B. arctos ferox BL U. Pl. II,
sehr selten ist der 3. noch eben höher, z. B. Melursus 5, Otocyon 1. In der Regel nimmt aber
die Höhe ab und zwar um so deutlicher, je grösser sie war, z. B. stark bei Hyaena, sehr
wenig bei Ailurus 1, Bassaris 1, so dass der Dornfortsatz am v. th. i. meist recht kurz, z. B.
Felis leo, tigris BL F. PL XI, seltener mittelkurz, z. B. Felis lynx 6 Taf. I Fig. 6 ist, manchmal
sogar ganz fehlt, z. B. Ictis nivalis 2 Taf. III Fig. 7, wie aus den Tabellen ersichtlich ist.
Am 1. v. th. ist der Fortsatz meist sehr schwach oder schwach rückgeneigt, manchmal
schon etwas deutlicher, z. B. Meies, Bl. S. PL II, sehr selten recht deutlich, z. B. Mydaus 1,
BL S. PL I, seltener steht er hier senkrecht, z. B. Felis serval 8, Proteles 1, BL C. Pl. III, dann
neigt ersieh immer mehr rückwärts, nur bei Mydaus kaum mehr, so dass er, wie die Tabellen
zeigen, an den letzten v. th. v. oft sehr stark rückgeneigt ist. Am v. th. i. jedoch ist er meist
wieder weniger rückgeneigt, meist nur etwas, selten, bei manchen Felis, noch sehr stark, z. B.
Felis lynx 6 Taf. I Fig. 6, hier öfters fast horizontal, z. B. Felis yaguarundi 14, als Ausnahme
ist er hier schon ebèn vorgerieigt, z. B. Enhydra 1.