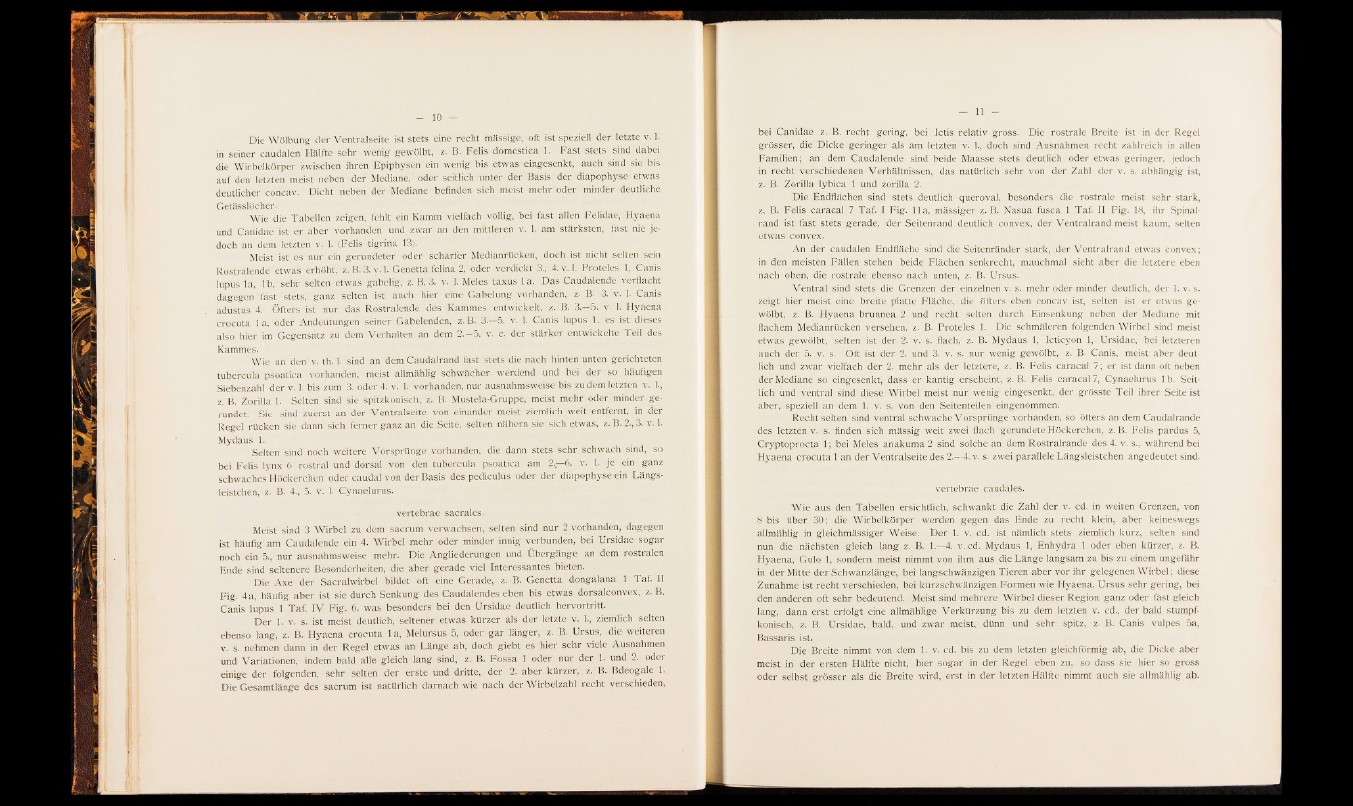
Die Wölbung der Ventralseite ist stets eine recht mässige, oft ist speziell der letzte v. 1.
in seiner caudalen Hälfte sehr wenig gewölbt, z. B. Felis domesticaM Fast stets- sind dabei
die Wirbelkörper zwischen ihren Epiphysen ein wenig bis etwas eingesenkt, auchiSind sie bis
auf den letzten meist neben der Mediane, oder seitlich unter der Basis der diapophÿsse etwas
deutlicher concav. Dicht neben der Mediane befinden sich mei#:mehr oder minder deutliche
Getässlöcher.
Wie die Tabellen zeigen, fehlt ein Kamm vielfach völlig, bei fast allen Felidae, Hyaena
und Canidae ist er aber vorhanden und zwar an den mittleren v. 1. am stärksten, fast nie jedoch
an dem letzten v. 1. (Felis-tigrina 13). ( -
Meist ist es nur ein gerundeter oder scharfer Medianrücken, doch ist nicht selten jsein
Röstralende'etwas erhöht, z. B. 3. y. 1. Genetta felina 2, oder verdickt 3ÿ*4iv. 1. Proteles 1, Canij|
lupus ía, lb, sehr selten etwas gabelig, z. B. 3. v. 1. MelSs taxus l a. Das Caudalende verflacht
dagegen fast stets, ganz Sölten ist auch hier eine Gabelung- vorhanden, z. B. 3. v. 1. Canif.;
adiustus 4. Öfters ist nur das Rostralende des Kammes entwickelt, z. B. 3.—5. v. IV Hyaena
crocuta la , oder Andeutungen seiner Gabelenden, z.B. 3.-5. v. 1. Canis lupus 1, es ist dieses
also hier im Gegensatz zu dem Verhalten an dem 2.-5. vT«® der stärker entwickelte Teil des
Kammes.
Wie an den v. th. 1. sind an dem Caüdalrand fast stets die nach hinten unten gerichteten
tubercula psoatica vorhanden, méist allmählig schwächer werdend und bei der so häufigen
Siebenzahl der v. 1-bis zum 3. Oder 4. v. 1. vorhanden, nur ausnahmsweise bis zu dem letzten v. 1.,
z. B. Zorilla 1. Selten sind sie spitzkonisch, z. B. Mustela-Gruppe, meist mehr od,er minder gerundet.
Sie sind zuerst an der Venträlseite von einander möist ziemlich weit entfernt, in der
Regel rücken sie dann sich ferner ganz an die Seite, selten nähern sie'sich etwas, z. B. 2., 3. v. 1.
Mydaus 1.
Selten sind noch weitere Vorsprünge vorhanden, die dann stets Sehr schwach sind, So
bei Felis lynx 6 rostral und dorsal von den tubercula psoatica am v- Je ein ganz
schwaches Höckerchen oder caudal von der Basis des pediculus Oder der di’apophyse ein Längs-
leistchen, z. B. 4., 5. v. 1. Cynaelurus.
vertebrae sacrales.
Meist sind 3 Wirbel zu dem sacrum verwachsen, selten sind nur 2 vorhanden, dagegen
ist häufig am Caudalende ein 4. Wirbel mehr oder minder innig verbunden, bei Ursidae îægar
noch ein 5., nur ausnahmsweise mehr. Die Angliederungen und Übergänge an dem rostralen
Ende sind seltenere Besonderheiten, die aber gerade viel Interessantes bieten.
Die Axe der Sacralwirbel bildet oft eine Gerade, z. B. Genetta dongalana 1 Taf. II
Fig. 4a, häufig aber ist sie durch Senkung des CaudalendeS eben bis etwas dorsalconvex, z. B.
Canis lupus 1 Taf. IV Fig. 6, was besonders bei den Ursidae deutlich hervortritt.
Der 1. v. s. ist meist deutlich, seltener etwas kürzer als der letzte v. 1., ziemlich selten
ebenso lang, z. B. Hyaena crocuta 1 a, Melursus 5,. oder gar länger, z. B. Ursus, die weiteren
v. s. nehmen dann in der Regel etwas an Länge ab, doch giebt es hier sehr viele Ausnahmen
und Variationen, indem bald alle gleich lang sind, z. B. Fossa 1 oder nur der 1. und 2. oder
einige der folgenden, Sehr selten der erste und dritte, der 2. aber kürzer, z. B. Bdeogale 1.
Die Gesamtlänge des sacrum ist natürlich darnach wie nach der Wirbelzahl recht verschieden,
■ u Ü
bei Canidae z. B. recht gering, bei Ictis relativ gross. Die rostrale Breite ist in der Regel
grösser, die Dicke geringer als am letzten v. 1., doch sind Ausnahmen recht zahlreich in allen
Familien; an dem Caudalende sind beide Maasse stets deutlich oder etwas geringer, jedoch
in recht verschiedenen Verhältnissen, das natürlich sehr von der Zahl der v. s. abhängig ist,
z. B. Zorilla lybica 1 und zorilla 2.
Die Endflächen sind stets deutlich queroval, besonders die rostrale meist sehr stark,
z. B. Felis caracal 7 Taf. I Fig. 11a, mässiger z.B. Nasua fusca 1 Taf. II Fig. 18, ihr Spinalrand
ist fast stets gerade, der Seitenrand deutlich convex, der Ventralrand meist kaum, Selten
etwas convex.
An der caudalen Endfläche sind die Seitenränder stark, der Ventralrand etwas convex;
in den meisten Fällen stehen beide Flächen senkrecht, manchmal sieht aber die letztere eben
nach oben, die rostrale ebenso nach unten, z. B. Ursus.
Ventral sind stets die Grenzen der einzelnen v. s. mehr oder minder deutlich, der 1. v. s.
zeigt hier meist eine breite platte Fläche, die öfters eben concav ist, selten ist er etwas gewölbt,
z. B. Hyaena brunnea 2 und recht selten durch Einsenkung neben der Mediane mit
flachem Medianrücken versehen,, z. B. Proteles 1. Die schmäleren folgenden Wirbel sind meist
etwas gewölbt, selten ist der 2. v. s. flach, z. B. Mydaus 1, Icticyon 1, Ursidae, bei letzteren
auch der 5. v. s. Oft ist der 2. und 3. v. s. nur wenig gewölbt, z. B. Canis, meist aber deutlich
und zwar vielfach der 2. mehr als der letztere, z. B. Felis caracal 7; er ist dann oft neben
der Mediane so eingesenkt, dass er kantig erscheint, z.B. Felis caracal 7, Cynaelurus lb. Seitlich
und ventral sind diese Wirbel meist nur wenig eingesenkt, der grösste Teil ihrer Seite ist
aber, speziell an dem 1. v. s. von den Seitenteilen eingenommen.
Recht selten sind ventral schwache Vorsprünge vorhanden, so öfters an dem Caudalrande
des letzten v. s. finden sich mässig weit zwei flach gerundete Höckerchen, z.B. Felis pardus 5,
Cryptoprocta 1; bei Meies anakuma 2 sind solche an dem Rostralrande des 4. v. s., während bei
Hyaena crocuta 1 an der Ventralseite des 2.-4. v. s. zwei parallele Längsleistchen angedeutet sind.
vertebrae caudales.
Wrie aus den Tabellen ersichtlich, schwankt die Zahl der v. cd. in weiten Grenzen, von
8 bis über 30; die Wirbelkörper werden gegen das Ende zu recht klein, aber keineswegs
allmählig in gleichmässiger Weise. Der 1. v. cd. ist nämlich stets ziemlich kurz, selten sind
nun die nächsten gleich lang z. B. 1.—4. v. cd. Mydaus 1, Enhydra 1 oder eben kürzer, z. B.
Hyaena, Guio 1, sondern meist nimmt von ihm aus die Länge langsam zu bis zu einem ungefähr
in der Mitte der Schwanzlänge, bei langschwänzigen Tieren aber vor ihr gelegenen Wirbel; diese
Zunahme ist recht verschieden, bei kurzschwänzigen Formen wie Hyaena, Ursus sehr gering, bei
den anderen oft sehr bedeutend. Meist sind mehrere Wirbel dieser Region ganz oder fast gleich
lang, dann erst erfolgt eine allmählige Verkürzung bis zu dem letzten v. ed., der bald stumpfkonisch,
z. B. Ursidae, bald, und zwar meist, dünn und sehr spitz, z. B. Canis vulpes 5a,
Bassaris ist.
Die Breite nimmt von dem 1. v. cd. bis zu dem letzten gleichförmig ab, die Dicke aber
meist in der ersten Hälfte nicht, hier sogar in der Regel eben zu, so dass sie hier so gross
oder selbst grösser als die Breite wird, erst in der letzten Hälfte nimmt auch sie allmählig ab.