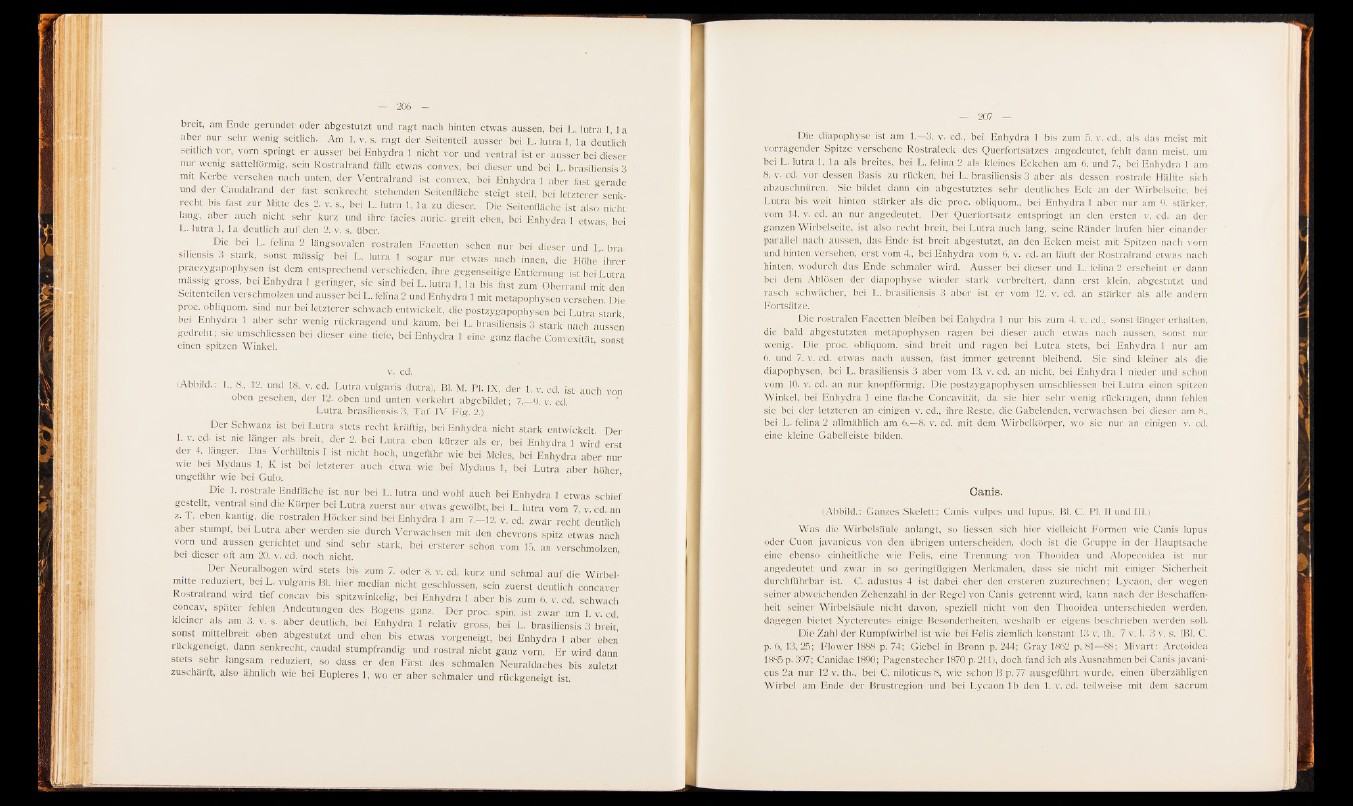
breit, am Ende gerundet oder abgestutzt und ragt nach hinten etwas aussen, bei L. lutra 1, l a
aber nur sehr wenig seitlich. Am 1. v. s. ragt der Seitenteil ausser bei L. lutra 1, la deutlich
seitlich vor, vorn springt er ausser bei Enhydra 1 nicht vor und ventral ist er ausser bei dieser
nur wenig sattelförmig, sein Rostralrand fällt etwas convex, bei dieser und bei L. brasiliensis 3
mit Kerbe versehen nach unten, der Ventralrand ist convex, bei Enhydra 1 aber fast gerade
und der Caudalrand der fast senkrecht stehenden Seitenfläche steigt steil, bei letzterer senkrecht
bis fast zur Mitte de sÄ v. s , bei L. lutra 1, la zu dieser. Die Seitenfläche ist also nicht
lang, aber auch nicht sehr kurz und ihre facies auric. greift eben, bei Enhydra 1 etwas, bei
L. lutra 1, la deutlich auf den 2. v. s. über.
Die bei L. felina 2 längsovalen rostralen Facetten sehen nur bei dieser und L. brasiliensis
3 stark, sonst mässig bei L. lutra 1 sogar nur etwas nach" innen, die Höhe ihrer
praezygapophysen ist dem entsprechend verschieden, ihre gegenseitige Entfernung ist bei Lutra
mässig gross, bei Enhydra 1 geringer, sie sind bei L. lutra 1, 1 a bis fast zum Oberrand mit den
Seitenteilen verschmolzen und ausser bei r.. felina 2 und Enhydra 1 mit metapophysen versehen Die
proc. obliquem, sind nur bei letzterer schwach entwickelt, die postzygapophysen bei Lutra stark
bei Enhydra 1 aber sehr wenig rückragend und kaum, bei L. brasiliensis 3 stark nach aussen
gedreht; sie umschliessen bei dieser eine tiefe, bei Enhydra 1 eine ganz flache Convexität sonst
einen spitzen Winkel.
v. cd.
(Abbild.: 1, 8, 12. und 18. v. cd. Lutra vulgaris (lutra), Bl. M. PI. IX, der 1. v. cd. ist auch von
oben gesehen, der 12. oben und unten verkehrt abgebildet; y,- 9. v. cd.
Lutra brasiliensis 3, Taf. IV Fig. 2.)
Der Schwanz ist bei Lutra stets recht kräftig, bei Enhydra nicht stark entwickelt Der
1. v. cd. ist nie länger als breit, der 2. bei Lutra eben kürzer als er, bei Enhydra 1 wird erst
der 4. länger. Das Verhältnis I ist nicht hoch, ungefähr wie bei Meies, bei Enhydra aber nur
wie bei Mydaus 1, K ist bei letzterer auch etwa wie bei Mydaus 1, bei Lutra aber ¡höher
ungefähr wie bei Gulo. • - ’
Die 1. rostrale Endfläche ist nur bei L. lutra und wohl auch bei Enhydra 1 etwas schief
gestellt, ventral sind die Körper bei Lutra zuerst nur etwas gewölbt, bei L. lutra vom'7: v. cd. an
z. T. eben kantig, die rostralen Höcker sind bei Enhydra 1 am 7.—12. v. cd. zwar recht deutlich
aber stumpf, bei Lutra aber werden sie durch Verwachsen mit den chevrons spitz etwas nach
vorn und aussen gerichtet und sind sehr stark, bei ersterer schon vom 15. an verschmolzen
bei dieser oft am 20. v. cd. noch nicht.
Der Neuralbogen wird stets bis zum f i oder 8. v. cd. kurz und schmal auf-die Wirbelmitte
reduziert, bei L. vulgaris Bl. hier median nicht geschlossen, sein zuerst deutlich concaver
Rostralrand wird tief concav bis spitzwinkelig, bei Enhydra 1 aber bis zum 6. v. cd. schwach
concav, später fehlen Andeutungen des Bogens ganz. Der proc. spin. ist zwar am 1. v. cd.
kleiner als am 3. v. s. aber deutlich, bei Enhydra 1 relativ gross, bei L. brasiliensis 3 breit
sonst mittelbreit oben abgestutzt und eben bis etwas vorgeneigt, bei Enhydra 1 aber àben
ruckgeneigt, dann senkrecht, caudal stumpfrandig und rostral nicht ganz vorn. Er wird dann
stets sehr langsam reduziert, so dass er den First des schmalen Neuraldaches bis zuletzt
zuschärft, also ähnlich wie bei Eupleres 1, wo er aber schmaler und rückgeneigt ist.
Die diapophyse ist am 1.—3. v. ed., bei Enhydra 1 bis zum 5. v. ed., als das meist mit
vorragender Spitze versehene Rostraleck des Querfortsatzes angedeutet, fehlt dann meist, um
bei L. lutra 1, l a als breites, bei L. felina 2 als kleines Eckchen am 6. und 7., bei Enhydra 1 am-
8. v. cd. vor dessen Basis zu rücken, bei L. brasiliensis 3 aber als dessen rostrale Hälfte sich
abzuschnüren. Sie bildet dann ein abgestutztes sehr deutliches Eck an der Wirbelseite, bei
Lutra bis weit hinten stärker als die proc. obliquom., bei Enhydra 1 aber nur am 9. stärker,
vom 14. v. cd. an nur angedeutet. Der Querfortsatz entspringt an den ersten v. cd. an der
ganzen Wirbelseite, ist also recht breit, bei Lutra auch lang, seine Ränder laufen hier einander
parallel nach aussen, das Ende ist breit abgestutzt, an den Ecken meist mit Spitzen nach vorn
und hinten, versehen, erst vom 4., bei Enhydra vom 6. v. cd. an läuft der Rostralrand etwas nach
hinten, wodurch das Ende schmaler wird. Ausser bei dieser und L. felina 2 erscheint er dann
bei dem Ablösen der diapophyse wieder stark verbreitert, dann erst klein, abgestutzt und
rasch schwächer, bei L. brasiliensis 3 aber ist er vom 12. v. cd. an stärker als alle ändern
Fortsätze.
Die rostralen Facetten bleiben bei Enhydra 1 nur bis zum 4. v. ed., sonst länger erhalten,
die bald abgestutzten metapophysen ragen bei dieser auch etwas nach aussen, sonst nur
wenig. Die proc. obliquom. sind breit und ragen bei Lutra stets, bei Enhydra 1 nur am
6. und 7. v. cd. etwas nach aussen, fast immer getrennt bleibend. Sie sind kleiner als die
diapophysen, bei L. brasiliensis 3 aber vom 13. v. cd. an nicht, bei Enhydra 1 nieder und schon
vom 10. v. cd. an nur knopfförmig. Die postzygapophysen umschliessen bei Lutra einen spitzen
Winkel, bei Enhydra 1 eine flache Concavität, da sie hier sehr wenig rückragen, dann fehlen
sie bei der letzteren an einigen v. ed., ihre Reste, die Gabelenden, verwachsen bei dieser am 8.,
bei L. felina 2 allmählich am 6.-8. v. cd. mit dem Wirbelkörper, wo sie nur an einigen v. cd.
eine kleine Gabelleiste bilden.
Canis.
(Abbild.: Ganzes Skelett: Canis vulpes und lupus, Bl. C. PI. II und III.)
Was die Wirbelsäule anlangt, so liessen sich hier vielleicht Formen wie Canis lupus
oder Cuon javanicus von den übrigen unterscheiden, doch ist die Gruppe in der Hauptsache
eine ebenso einheitliche wie Felis, eine Trennung von Thooidea und Alopecoidea ist nur
angedeutet und zwar in so geringfügigen Merkmalen, dass sie nicht mit einiger Sicherheit
durchführbar ist. C. adustus 4 ist dabei eher den ersteren zuzurechnen; Lycaon, der wegen
seiner abweichenden Zehenzahl in der Regel von Canis getrennt wird, kann nach der Beschaffenheit
seiner Wirbelsäule nicht davon, speziell nicht von den Thooidea unterschieden werden,
dagegen bietet Nyctereutes einige Besonderheiten, weshalb er eigens beschrieben werden soll.
Die Zahl der Rumpfwirbel ist wie bei Felis ziemlich konstant 13 v. th. 7 v. 1. 3 v. s. (Bl. C.
p. 6, 13, 25; Flower 1888 p. 74; Giebel in Bronn p. 244; Gray 1862 p. 81—88; Mivart: Arctoidea
1885 p. 397; Canidae 1890; Pagenstecher 1870 p. 211), doch fand ich als Ausnahmen bei Canis javanicus
2a nur 12 v. th., bei C. niloticus 8, wie schon B p. 77 ausgeführt wurde, einen überzähligen
Wirbel am Ende der Brustregion und bei Lycaon lb den 1. v. cd. teilweise mit dem sacrum