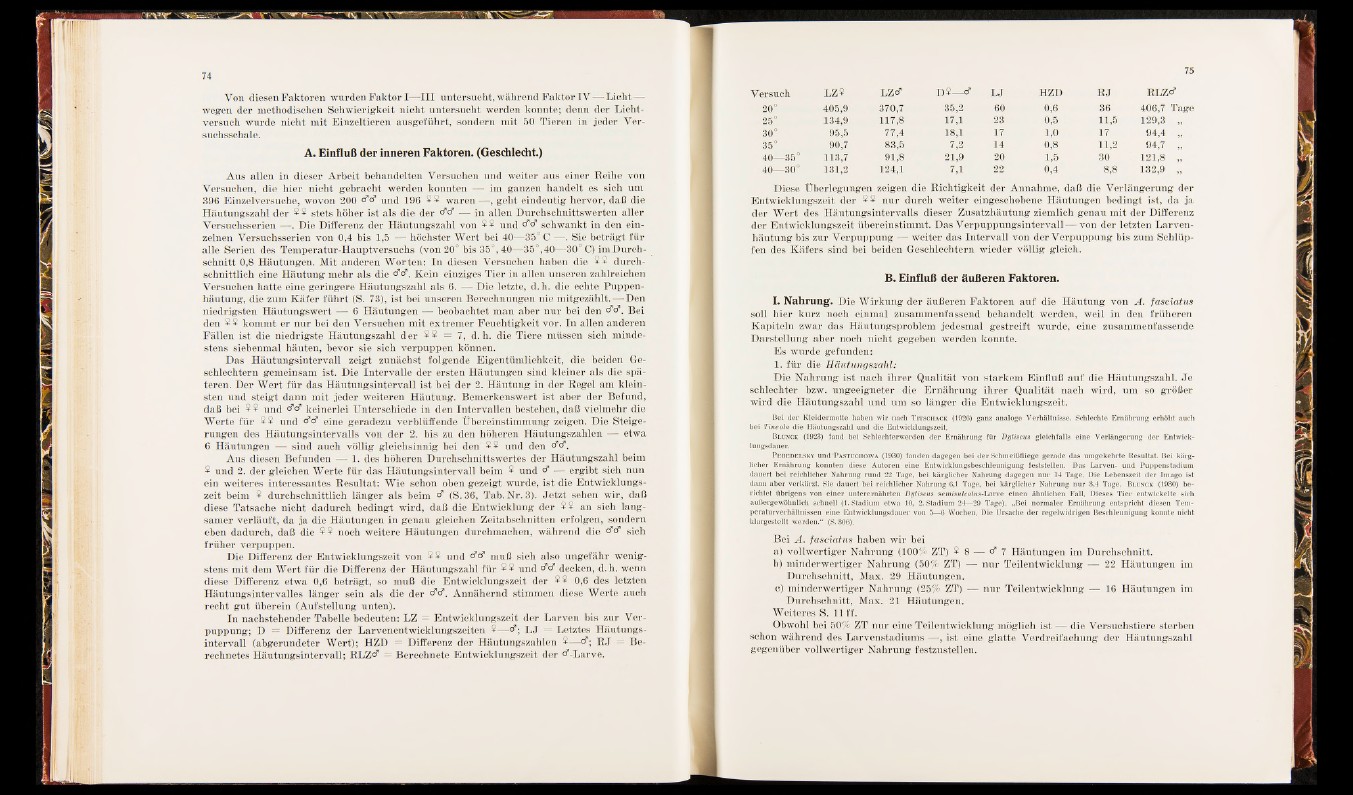
1
Von diesen Faktoren wurden Faktor I—I I I untersucht, während F aktor IV— Licht —
wegen der methodischen Schwierigkeit nicht untersucht werden konnte; denn der Lichtversuch
wurde nicht mit Einzeltieren ausgeführt, sondern mit 50 Tieren in jeder Versuchsschale.
A. Einfluß der inneren Faktoren. (Gesdiledit.)
Aus allen in dieser Arbeit behandelten Versuchen und weiter aus einer Reihe von
Versuchen, die hier nicht gebracht werden konnten — im ganzen handelt es sich um
396 Einzelversuche, wovon 200 cfcf und 196 2 ? w a ren—, geht eindeutig hervor, daß die
Häutungszahl der 2 $ stets höher ist als die der cfcf — in allen Durchschnittswerten aller
Versuchsserien —. Die Differenz der Häutungszahl von 5$ und cf cf schwankt in den einzelnen
Versuchsserien von 0,4 bis 1,5 — höchster Wert bei 40—35° C -—. Sie beträgt für
alle Serien des Temperatur-Hauptversuchs (von 20° bis 35°, 40—35°, 40—30° C) im Durchschnitt
0,8 Häutungen. Mit anderen Worten: In diesen Versuchen haben die durchschnittlich
eine Häutung mehr als die cf cf. Kein einziges Tier in allen unseren zahlreichen
Versuchen hatte eine geringere Häutungszahl als 6. Die letzte, d. h. die echte Puppenhäutung,
die zum Käfer führt (S. 73), ist bei unseren Berechnungen nie mitgezählt.—Den
niedrigsten Häutungswert - 3 6 Häutungen — beobachtet man aber nur bei den cf cf. Bei
den 22 kommt er nur bei den Versuchen mit extremer Feuchtigkeit vor. In allen anderen
Fällen ist die niedrigste Häutungszahl de r 22 = d.h. die Tiere müssen sich mindestens
siebenmal häuten, bevor sie sich verpuppen können.
Das Häutungsintervall zeigt zunächst folgende Eigentümlichkeit, die beiden Geschlechtern
gemeinsam ist. Die Intervalle der ersten Häutungen sind kleiner als die späteren.
Der Wert für das Häutungsintervall ist bei der 2. Häutung in der Regel am kleinsten
und steigt dann mit jeder weiteren Häutung. Bemerkenswert ist aber der Befund,
daß hei 22 und cf cf keinerlei Unterschiede in den Intervallen bestehen, daß vielmehr die
Werte für 22 und cf cf eine geradezu verblüffende Übereinstimmung zeigen. Die Steigerungen
des Häutungsintervalls von der 2. bis zu den höheren Häutungszahlen etwa
6 Häutungen 3 sind auch völlig gleichsinnig hei den 22 und den cf cf.
Aus diesen Befunden — 1. des höheren Durchschnittswertes der Häutungszahl beim
2 und 2. der gleichen Werte fü r das Häutungsintervall beim 2 und cf - ^ e rg ib t sich nun
ein weiteres interessantes Resultat: Wie schon oben gezeigt wurde, ist die Entwicklungszeit
beim 2 durchschnittlich länger als beim cf (S. 36, Tab. Nr. 3). Jetzt sehen wir, daß
diese Tatsache nicht dadurch bedingt wird, daß die Entwicklung der 2 2 an sich langsamer
verläuft, da ja die Häutungen in genau gleichen Zeitabschnitten erfolgen, sondern
eben dadurch, daß die 2 2 noch weitere Häutungen durchmachen, während die cf cf sich
früher verpuppen.
Die Differenz der Entwicklungszeit von 2 2 und cf cf muß sich also ungefähr wenigstens
mit dem Wert für die Differenz der Häutungszahl für 22 und cfcf decken, d.h. wenn
diese Differenz etwa 0,6 beträgt, so muß die Entwicklungszeit der 2 2 0,6 des letzten
Häutungsinter valles länger sein als die der cf cf. Annähernd stimmen diese Werte auch
recht gut überein (Aufstellung unten).
In nachstehender Tabelle bedeuten: LZ = Entwicklungszeit der Larven bis zur Verpuppung;
D = Differenz der Larvenentwicklungszeiten 2—cf; L J — Letztes Häutungsintervall
(abgerundeter Wert); HZD = Differenz der Häutungszahlen 2—cf; R J = Berechnetes
Häutungsintervall; RLZcf = Berechnete Entwicklungszeit der cf-Larve.
Versuch LZ 2 LZtf D ?—<? LJ HZD ß j ELZc?
20° 405,9 370,7 35,2 60 0,6 36 406,7 Tage
25'' 134,9 117,8 i7>,a.:;v; 23 0,5 11,5 129,3 „
30° 95,5 77,4 18,1 17 1,0 17 94,4 „
35° 90,7 83,5 7,2 14 0,8 11,2 94,7 „
40—35° 113,7 91,8 21,9 20 1,5 30 121,8 „
40—30° 131,2 124,1 7,1 22 0,4 8,8 132,9 „
Diese Überlegungen zeigen die Richtigkeit der Annahme, daß die Verlängerung der
Entwicklungszeit der 22 nur durch weiter eingeschobene Häutungen bedingt ist, da ja
der Wert des Häutungsintervalls dieser Zusatzhäutung ziemlich genau mit der Differenz
der Entwicklungszeit übereinstimmt. Das Verpuppungsintervall — von der letzten Larvenhäutung
bis zur Verpuppung — weiter das Intervall von der Verpuppung bis zum Schlüpfen
des Käfers sind bei beiden Geschlechtern wieder völlig gleich.
B. Einfluß der äußeren Faktoren.
I. Nahrung. Die Wirkung der äußeren Faktoren auf die Häutung von A. fasciatus
soll hier kurz noch einmal zusammenfassend behandelt werden, weil in den früheren
Kapiteln zwar das Häutungsproblem jedesmal gestreift wurde, eine zusammenfassende
Darstellung aber noch nicht gegeben werden konnte.
Es wurde gefunden:
1 . für die Häutungszahl:
Die Nahrung ist nach ihrer Qualität von starkem Einfluß auf die Häutungszahl. Je
schlechter bzw. ungeeigneter die Ernährung ihrer Qualität nach wird, um so größer
wird die Häutungszahl und um so länger die Entwicklungszeit.
Bei der Kleidermotte haben wir nach T it s c h a c k (1926) ganz analoge Verhältnisse. Schlechte Ernährung erhöht auch
bei Tineola die Häutungszahl und die Entwicklungszeit.
B l u n c k (1923) fand bei Schlechterwerden der Ernährung für Dyliscus gleichfalls eine Verlängerung der Entwicklungsdauer.
P er ed e l sk y und’P astuchowa (1930) fanden dagegen bei der Schmeißfliege gerade das umgekehrte Resultat. Bei kärglicher
Ernährung konnten diese Autoren eine Entwicklungsbeschleunigung feststellen. Das Larven- und Puppenstadium
dauert bei reichlicher Nahrung rund 22 Tage, bei kärglicher Nahrung dagegen nur 14 Tage. Die Lebenszeit der Imago ist
dann aber verkürzt. Sie dauert bei reichlicher Nahrung 6,1 Tage, bei kärglicher Nahrung nur 3 ,4 Tage. Blunck (1930) berichtet
übrigens von einer unterernährten Dyiiscus semisulcatus-Larve einen ähnlichen Fall. Dieses Tier entwickelte sich
außergewöhnlich schnell (1. Stadium etwa 10, 2. Stadium 24—29 Tage). „Bei normaler Ernährung entspricht diesen Temperaturverhältnissen
eine Entwicklungsdauer von 5— 6 Wochen. Die Ursache der regelwidrigen Beschleunigung konnte nicht
klargestellt werden.“ (S. 306).
Bei A. fasciatus haben wir bei
a) vollwertiger Nahrung (100% ZT) 2 8 cf 7 Häutungen im Durchschnitt.
b) minderwertiger Nahrung (50% ZT) — nur Teilentwicklung|iii|22 Häutungen im
Durchschnitt, Max. 29 Häutungen.
c) minderwertiger Nahrung (25% ZT) — nur Teilentwicklung — 16 Häutungen im
Durchschnitt, Max. 21 Häutungen.
Weiteres S. 11 ff.
Obwohl bei 50% ZT nur eine Teilentwicklung möglich ist — die Versuchstiere sterben
schon während des Larvenstadiums —, ist eine glatte Verdreifachung der Häutungszahl
gegenüber vollwertiger Nahrung festzustellen.