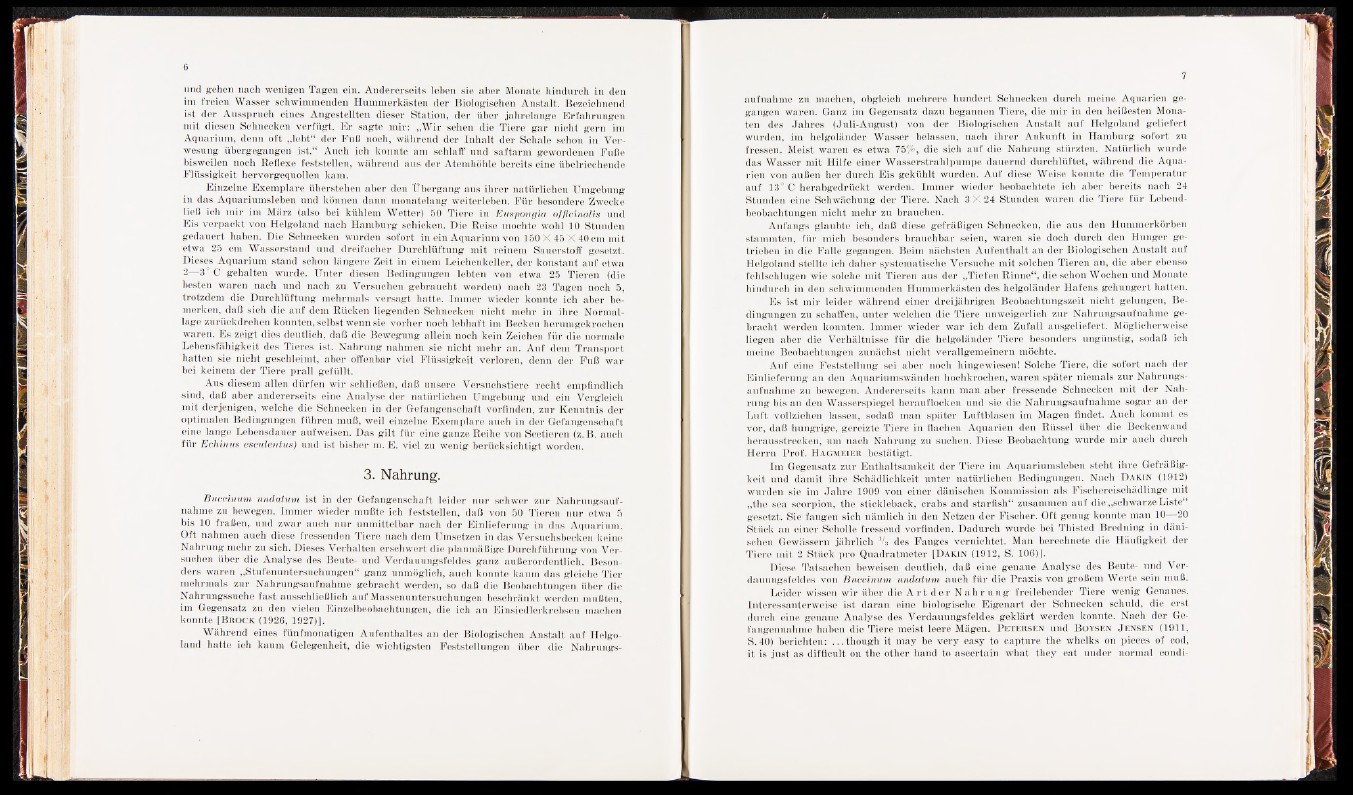
und gehen nach wenigen Tagen ein. Andererseits leben sie aber Monate hindurch in den
im freien Wasser schwimmenden Hummerkästen der Biologischen Anstalt. Bezeichnend
ist der Ausspruch eines Angestellten dieser Station, der über jahrelange Erfahrungen
mit diesen Schnecken verfügt. E r sagte mir: „Wir sehen die Tiere gar nicht gern im
Aquarium, denn oft „lebt“ der Fuß noch, während der Inhalt der Schale schon in Verwesung
übergegangen ist.“ Auch ich konnte am schlaff und saftarm gewordenen Fuße
bisweilen noch Reflexe feststellen, während aus der Atemhöhle bereits eine übelriechende
Flüssigkeit hervorgequollen kam.
Einzelne Exemplare überstehen aber den Übergang aus ihrer natürlichen Umgebung
in das Aquariumsleben und können dann monatelang weiterleben. F ü r besondere Zwecke
ließ ich mir im März (also hei kühlem Wetter) 50 Tiere in Euspongia officinalis und
Eis verpackt von Helgoland nach Hamburg schicken. Die Reise mochte wohl 10 Stunden
gedauert haben. Die Schnecken wurden sofort in ein Aquarium von 150 X 45 X 40 cm mit
etwa 25 cm Wasserstand und dreifacher Durchlüftung mit reinem Sauerstoff gesetzt.
Dieses Aquarium stand schon längere Zeit in einem Leichenkeller, der konstant auf etwa
2—3° C gehalten wurde. Unter diesen Bedingungen lebten von etwa 25 Tieren (die
besten waren nach und nach zu Versuchen gebraucht worden) nach 23 Tagen noch 5,
trotzdem die Durchlüftung mehrmals versagt hatte. Immer wieder konnte ich aber bemerken,
daß sich die auf dem Rücken liegenden Schnecken nicht mehr in ihre Normallage
zurückdrehen konnten, selbst wenn sie vorher noch lebhaft im Becken herumgekrochen
waren. Es zeigt dies deutlich, daß die Bewegung allein noch kein Zeichen für die normale
Lebensfähigkeit des Tieres ist. Nahrung nahmen sie nicht mehr an. Auf dem Transport
hatten sie nicht geschleimt, aber offenbar viel Flüssigkeit verloren, denn der Fuß war
hei keinem der Tiere prall gefüllt.
Aus diesem allen dürfen wir schließen, daß unsere Versuchstiere recht empfindlich
sind, daß aber andererseits eine Analyse der natürlichen Umgebung und ein Vergleich
mit derjenigen, welche die Schnecken in der Gefangenschaft vorfinden, zur Kenntnis der
optimalen Bedingungen führen muß, weil einzelne Exemplare auch in der Gefangenschaft
eine lange Lebensdauer aufweisen. Das gilt für eine ganze Reihe von Seetieren (z. B. auch
für Echinus esculentus) und ist bisher m. E. viel zu wenig berücksichtigt worden.
3. Nahrung.
Buccinum undatum ist in der Gefangenschaft leider nur schwer zur Nahrungsaufnahme
zu bewegen. Immer wieder mußte ich feststellen, daß von 50 Tieren nur etwa 5
bis 10 fraßen, und zwar auch nur unmittelbar nach der Einlieferung in das Aquarium.
Oft nahmen auch diese fressenden Tiere nach dem Umsetzen in das Versuchsbecken keine
Nahrung mehr zu sich. Dieses Verhalten erschwert die planmäßige D urchführung von Versuchen
über die Analyse des Beute- und Verdauungsfeldes ganz außerordentlich. Besonders
waren „Stufenuntersuchungen“ ganz unmöglich, auch konnte kaum das gleiche Tier
mehrmals zur Nahrungsaufnahme gebracht werden, so daß die Beobachtungen über die
Nahrungssuche fast ausschließlich auf Massenuntersuchungen beschränkt werden mußten,
im Gegensatz zu den vielen Einzelbeobachtungen, die ich an Einsiedlerkrebsen machen
konnte [Brock (1926, 1927)].
Während eines fünfmonatigen Aufenthaltes an der Biologischen Anstalt auf Helgoland
hatte ich kaum Gelegenheit, die wichtigsten Feststellungen über die Nahrungsauf
nähme zu machen, obgleich mehrere hundert Schnecken durch meine Aquarien gegangen
waren. Ganz im Gegensatz dazu begannen Tiere, die mir in den heißesten Monaten
des Jahres (Juli-August) von der Biologischen Anstalt auf Helgoland geliefert
wurden, im helgoländer Wasser belassen, nach ihrer Ankunft in Hamburg sofort zu
fressen. Meist waren es etwa 75%, die sich auf die Nahrung stürzten. Natürlich wurde
das Wasser mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe dauernd durchlüftet, während die Aquarien
von außen her durch Eis gekühlt wurden. Auf diese Weise konnte die Temperatur
auf 13° C herabgedrückt werden. Immer wieder beobachtete ich aber bereits nach 24
Stunden eine Schwächung der Tiere. Nach 3 X 24 Stunden waren die Tiere für Lebendbeobachtungen
nicht mehr zu brauchen.
Anfangs glaubte ich, daß diese gefräßigen Schnecken, die aus den Hummerkörben
stammten, für mich besonders brauchbar seien, waren sie doch durch den Hunger getrieben
in die Falle gegangen. Beim nächsten Aufenthalt an der Biologischen Anstalt auf
Helgoland stellte ich daher systematische Versuche mit solchen Tieren an, die aber ebenso
fehlschlugen wie solche mit Tieren aus der „Tiefen Rinne“, die schon Wochen und Monate
hindurch in den schwimmenden Hummerkästen des helgoländer Hafens gehungert hatten.
Es ist mir leider während einer dreijährigen Beohachtungszeit nicht gelungen, Bedingungen
zu schaffen, unter welchen die Tiere unweigerlich zur Nahrungsaufnahme gebracht
werden konnten. Immer wieder war ich dem Zufall ausgeliefert. Möglicherweise
liegen aber die Verhältnisse für die helgoländer Tiere besonders ungünstig, sodaß ich
meine Beobachtungen zunächst nicht verallgemeinern möchte.
Auf eine Feststellung sei aber noch hingewiesen! Solche Tiere, die sofort nach der
Einlieferung an den Aquariumswänden hochkrochen, waren später niemals zur Nahrungsaufnahme
zu bewegen. Andererseits kann man aber fressende Schnecken mit der Nahrung
bis an den Wasserspiegel her auf locken und sie die Nahrungsaufnahme sogar an der
Luft vollziehen lassen, sodaß man später Luftblasen im Magen findet. Auch kommt es
vor, daß hungrige, gereizte Tiere in flachen Aquarien den Rüssel über die Beckenwand
herausstrecken, um nach Nahrung zu suchen. Diese Beobachtung wurde mir auch durch
Herrn Prof. Hagmeier bestätigt.
Im Gegensatz zur Enthaltsamkeit der Tiere im Aquariumsleben steht ihre Gefräßigkeit
und damit ihre Schädlichkeit unter natürlichen Bedingungen. Nach Dakin (1912)
wurden sie im Jah re 1909 von einer dänischen Kommission als Fischereischädlinge mit
„the sea scorpion, the stickleback, crahs and starfish“ zusammen auf die „schwarze Liste“
gesetzt. Sie fangen sich nämlich in den Netzen der Fischer. Oft genug konnte man 10 20
Stück an einer Scholle fressend vorfinden. Dadurch wurde bei Thisted Bredning in dänischen
Gewässern jährlich 1U des Fanges vernichtet. Man berechnete die Häufigkeit der
Tiere mit 2 Stück pro Quadratmeter [Dakin (1912, S. 106)].
Diese Tatsachen beweisen deutlich, daß eine genaue Analyse des Beute- und Verdauungsfeldes
von Buccinum undatum auch für die Praxis von großem Werte sein muß.
Leider wissen wir über die A r t d e r N a h r u n g freilebender Tiere wenig Genaues.
Interessanterweise ist daran eine biologische Eigenart der Schnecken schuld, die erst
durch eine genaue Analyse des Verdauungsfeldes geklärt werden konnte. Nach der Gefangennahme
haben die Tiere meist leere Mägen. P etersen und Boysen J ensen (1911,
S. 40) berichten: ...th o u g h it may be very easy to capture the whelks on pieces of cod,
it is just as difficult on the other hand to ascertain what they eat under normal condi