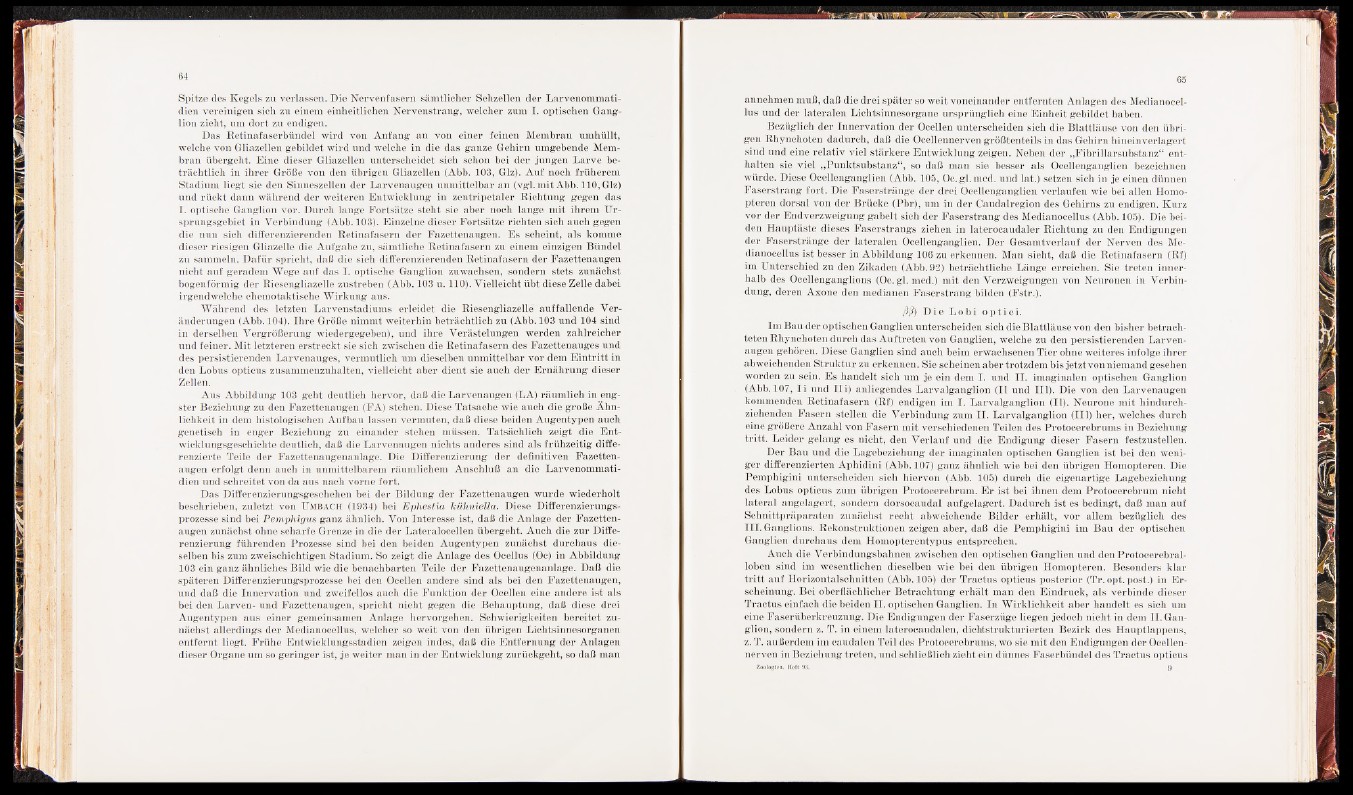
Spitze des Kegels zu verlassen. Die Nervenfasern sämtlicher Sehzellen der Larvenommati-
dien vereinigen sich zu einem einheitlichen Nervenstrang, welcher zum I. optischen Ganglion
zieht, um dort zu endigen.
Das Retinafaserbündel wird von Anfang an von einer feinen Membran umhüllt,
welche von Gliazellen gebildet wird und welche in die das ganze Gehirn umgehende Membran
übergeht. Eine dieser Gliazellen unterscheidet sich schon bei der jungen Larve beträchtlich
in ihrer Größe von den übrigen Gliazellen (Abb. 103, Glz). Auf noch früherem
Stadium liegt sie den Sinneszellen der Larvenaugen unmittelbar an (vgl. mit Abb. 110, Glz)
und rückt dann während der weiteren Entwicklung in zentripetaler Richtung gegen das
I. optische Ganglion vor. Durch lange Fortsätze steht sie aber noch lange mit ihrem Ursprungsgebiet
in Verbindung (Abb. 103). Einzelne dieser Fortsätze richten sich auch gegen
die nun sich differenzierenden Retinafasern der Fazettenaugen. Es scheint, als komme
dieser riesigen Gliazelle die Aufgabe zu, sämtliche Retinafasern zu einem einzigen Bündel
zu sammeln. Dafür spricht, daß die sich differenzierenden Retinafasern der Fazettenaugen
nicht auf geradem Wege auf das I. optische Ganglion Zuwachsen, sondern stets zunächst
bogenförmig der Riesengliazelle zustreben (Abb. 103 u. 110). Vielleicht übt diese Zelle dabei
irgendwelche chemotaktische Wirkung aus.
Während des letzten Larvenstadiums erleidet die Riesengliazelle auffallende Veränderungen
(Abb. 104). Ihre Größe nimmt weiterhin beträchtlich zu (Abb. 103 und 104 sind
in derselben Vergrößerung wiedergegeben), und ihre Verästelungen werden zahlreicher
und feiner. Mit letzteren erstreckt sie sich zwischen die Retinafasern des Fazettenauges und
des persistierenden Larvenauges, vermutlich um dieselben unmittelbar vor dem E in tritt in
den Lobus opticus zusammenzuhalten, vielleicht aber dient sie auch der Ernährung dieser
Zellen.
Aus Abbildung 103 geht deutlich hervor, daß die Larvenaugen (LA) räumlich in engster
Beziehung zu den Fazettenaugen (FA) stehen. Diese Tatsache wie auch die große Ähnlichkeit
in dem histologischen Aufbau lassen vermuten, daß diese beiden Augentypen auch
genetisch in enger Beziehung zu einander stehen müssen. Tatsächlich zeigt die Entwicklungsgeschichte
deutlich, daß die Larvenaugen nichts anderes sind als frühzeitig differenzierte
Teile der Fazettenaugenanlage. Die Differenzierung der definitiven Fazettenaugen
erfolgt denn auch in unmittelbarem räumlichem Anschluß an die Larvenommati-
dien und schreitet von da aus nach vorne fort.
Das Differenzierungsgeschehen bei der Bildung der Fazettenaugen wurde wiederholt
beschrieben, zuletzt von U mbach (1934) bei Ephestia kühniella. Diese Differenzierungsprozesse
sind bei Pemphigus ganz ähnlich. Von Interesse ist, daß die Anlage der Fazettenaugen
zunächst ohne scharfe Grenze in die der Lateralocellen übergeht. Auch die zur Differenzierung
führenden Prozesse sind bei den beiden Augentypen zunächst durchaus dieselben
bis zum zweischichtigen Stadium. So zeigt die Anlage des Ocellus (Oc) in Abbildung
103 ein ganz ähnliches Bild wie die benachbarten Teile der Fazettenaugenanlage. Daß die
späteren Differenzierungsprozesse bei den Ocellen andere sind als bei den Fazettenaugen,
und daß die Innervation und zweifellos auch die Funktion der Ocellen eine andere ist als
bei den Larven- und Fazettenaugen, spricht nicht gegen die Behauptung, daß diese drei
Augentypen aus einer gemeinsamen Anlage hervorgehen. Schwierigkeiten bereitet zunächst
allerdings der Medianocellus, welcher so weit von den übrigen Lichtsinnesorganen
entfernt liegt. Frühe Entwicklungsstadien zeigen indes, daß die Entfernung der Anlagen
dieser Organe um so geringer ist, je weiter man in der Entwicklung zurückgeht, so daß man
annehmen muß, daß die drei später so weit voneinander entfernten Anlagen des Medianocellus
und der lateralen Lichtsinnesorgane ursprünglich eine Einheit gebildet haben.
Bezüglich der Innervation der Ocellen unterscheiden sich die Blattläuse von den übrigen
Rhynchoten dadurch, daß die Ocellennerven größtenteils in das Gehirn hineinverlagert
sind und eine relativ viel stärkere Entwicklung zeigen. Neben der „Fibrillarsubstanz“ enthalten
sie viel „Punktsubstanz“, so daß man sie besser als Ocellenganglien bezeichnen
würde. Diese Ocellenganglien (Abb. 105, Oc. gl. med. und lat.) setzen sich in je einen dünnen
Faserstrang fort. Die Faserstränge der drei Ocellenganglien verlaufen wie bei allen Homo-
pteren dorsal von der Brücke (Pbr), um in der Caudalregion des Gehirns zu endigen. Kurz
vor der Endverzweigung gabelt sich der Faserstrang des Medianocellus (Abb. 105). Die beiden
Hauptäste dieses Faserstrangs ziehen in laterocaudaler Richtung zu den Endigungen
der Faserstränge der lateralen Ocellenganglien. Der Gesamtverlauf der Nerven des Medianocellus
ist besser in Abbildung 106 zu erkennen. Man sieht, daß die Retinafasern (Rf)
im Unterschied zu den Zikaden (Abb. 92) beträchtliche Länge erreichen. Sie treten innerhalb
des Ocellenganglions (Oc. gl. med.) mit den Verzweigungen von Neuronen in Verbindung,
deren Axone den medianen Faserstrang bilden (Fstr.).
ßß) D ie Lo b i opt i ci .
Im Bau der optischen Ganglien unterscheiden sich die Blattläuse von den bisher betrachteten
Rhynchoten durch das Auftreten von Ganglien, welche zu den persistierenden Larvenaugen
gehören. Diese Ganglien sind auch beim erwachsenen Tier ohne weiteres infolge ihrer
abweichenden Struktur zu erkennen. Sie scheinen aber trotzdem bis jetzt von niemand gesehen
worden zu sein. Es handelt sich um je ein dem I. und II. imaginalen optischen Ganglion
(Abb. 107, I i und IIi) anliegendes Larvalganglion (II und III). Die von den Larvenaugen
kommenden Retinafasern (Rf) endigen im I. Larvalganglion (II). Neurone mit hindurchziehenden
Fasern stellen die Verbindung zum II. Larvalganglion (III) her, welches durch
eine größere Anzahl von Fasern mit verschiedenen Teilen des Protocerebrums in Beziehung
tritt. Leider gelang es nicht, den Verlauf und die Endigung dieser Fasern festzustellen.
Der Bau und die Lagebeziehung der imaginalen optischen Ganglien ist bei den weniger
differenzierten Aphidini (Abb. 107) ganz ähnlich wie bei den übrigen Homopteren. Die
Pemphigini unterscheiden sich hiervon (Abb. 105) durch die eigenartige Lagebeziehung
des Lobus opticus zum übrigen Protocerebrum. E r ist bei ihnen dem Protocerebrum nicht
lateral angelagert, sondern dorsocaudal aufgelagert. Dadurch ist es bedingt, daß man auf
Schnittpräparaten zunächst recht abweichende Bilder erhält, vor allem bezüglich des
III. Ganglions. Rekonstruktionen zeigen aber, daß die Pemphigini im Bau der optischen
Ganglien durchaus dem Homopterentypus entsprechen.
Auch die Verbindungsbahnen zwischen den optischen Ganglien und den Protocerebral-
loben sind im wesentlichen dieselben wie bei den übrigen Homopteren. Besonders klar
tritt auf Horizontalschnitten (Abb. 105) der Tractus opticus posterior (Tr. opt. post.) in E rscheinung.
Bei oberflächlicher Betrachtung erhält man den Eindruck, als verbinde dieser
Tractus einfach die beiden II. optischen Ganglien. In Wirklichkeit aber handelt es sich um
eine Faserüberkreuzung. Die Endigungen der Faserzüge liegen jedoch nicht in dem II. Ganglion,
sondern z. T. in einem laterocaudalen, dichtstrukturierten Bezirk des Hauptlappens,
z. T. außerdem im caudalen Teil des Protocerebrums, wo sie m it den Endigungen der Ocellennerven
in Beziehung treten, und schließlich zieht ein dünnes Faserblindel des T ractus opticus
Zoologien. Heft 93. 9