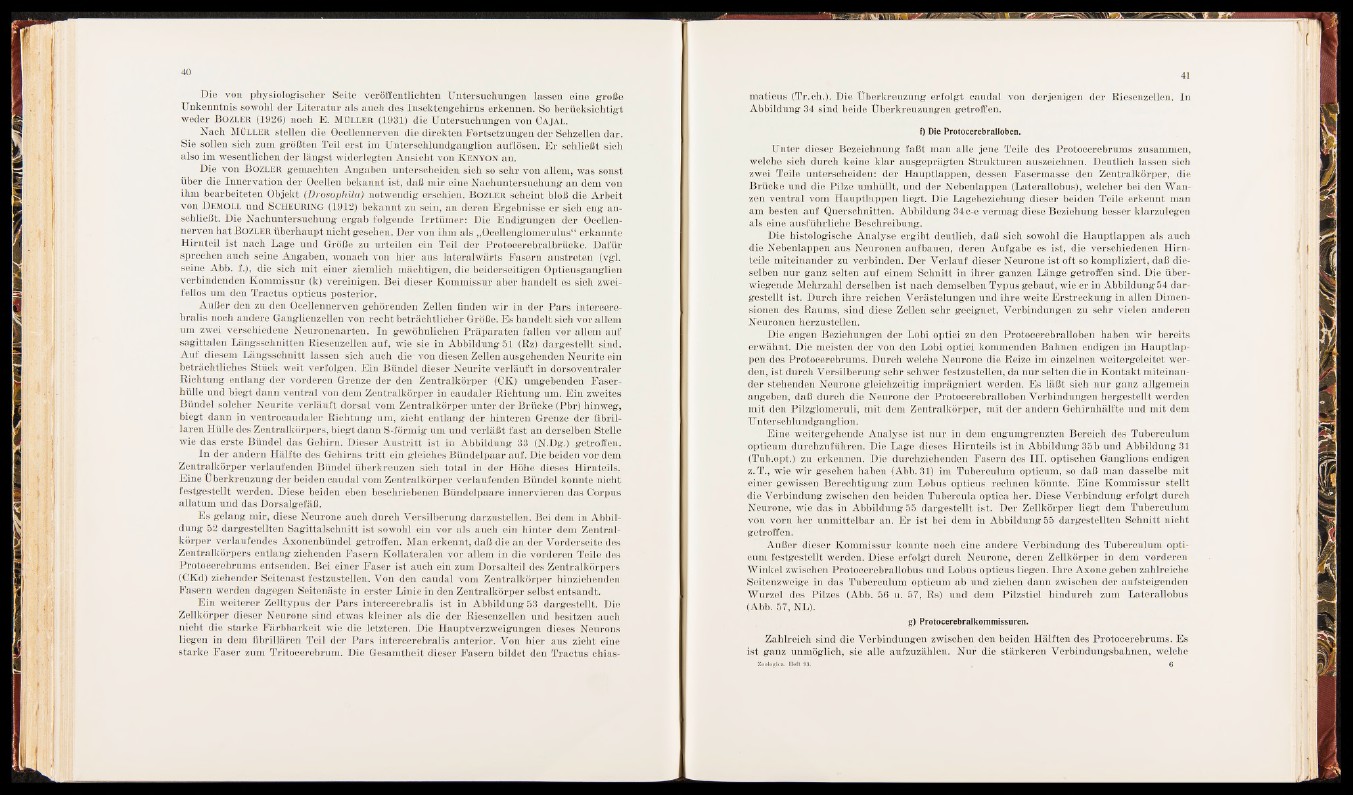
Die von physiologischer Seite veröffentlichten Untersuchungen lassen eine große
Unkenntnis sowohl der Literatur als auch des Insektengehirns erkennen. So berücksichtigt
weder Bozler (1926) noch E. Müller (1931) die Untersuchungen von Cajal.
Nach Müller stellen die Ocellennerven die direkten Fortsetzungen der Sehzellen dar.
Sie sollen sich zum größten Teil erst im Unterschlundganglion auf lösen. Er schließt sich
also im wesentlichen der längst widerlegten Ansicht von K enyon an.
Die von Bozler gemachten Angaben unterscheiden sich so sehr von allem, was sonst
über die Innervation der Ocellen bekannt ist, daß mir eine Nachuntersuchung an dem von
ihm bearbeiteten Objekt (Drosophila) notwendig erschien. Bozler scheint bloß die Arbeit
von Demoll und Scheuring (1912) bekannt zu sein, an deren Ergebnisse er sich eng anschließt.
Die Nachuntersuchung ergab folgende Irrtümer: Die Endigungen der Ocellennerven
hat Bozler überhaupt nicht gesehen. Der von ihm als „Ocellenglomerulus“ erkannte
Hirnteil ist nach Lage und Größe zu urteilen ein Teil der Protocerebralbrücke. Dafür
sprechen auch seine Angaben, wonach von hier aus lateralwärts Fasern austreten (vgl.
seine Abb. f.), die sich mit einer ziemlich mächtigen, die beiderseitigen Opticusganglien
verbindenden Kommissur (k) vereinigen. Bei dieser Kommissur aber handelt es sich zweifellos
um den Tr actus opticus posterior.
Außer den zu den Ocellennerven gehörenden Zellen finden wir in der Pars intercere-
bralis noch andere Ganglienzellen von recht beträchtlicher Größe. E s handelt sich vor allem
um zwei verschiedene Neuronenarten. In gewöhnlichen Präparaten fallen vor allem auf
sagittalen Längsschnitten Biesenzellen auf, wie sie in Abbildung 51 (Kz) dargestellt sind.
Auf diesem Längsschnitt lassen sich auch die* von diesen Zellen ausgehenden Neurite ein
beträchtliches Stück weit verfolgen. Ein Bündel dieser Neurite verläuft in dorsoventraler
Kichtung entlang der vorderen Grenze der den Zentralkörper (CK) umgebenden Faserhülle
und biegt dann ventral von dem Zentralkörper in caudaler Bichtung um. Ein zweites
Bündel solcher Neurite verläuft dorsal vom Zentralkörper unter der B rücke (Pbr) hinweg,
biegt dann in ventrocaudaler Bichtung um, zieht entlang der hinteren Grenze der fibrillären
Hülle des Zentralkörpers, biegt dann S-förmig um und verläßt fast an derselben Stelle
wie das erste Bündel das Gehirn. Dieser Austritt ist in Abbildung 33 (N.Dg.) getroffen.
In der ändern Hälfte des Gehirns tritt ein gleiches Bündelpaar auf. Die beiden vor dem
Zentralkörper verlaufenden Bündel überkreuzen sich total in der Höhe dieses Hirnteils.
Eine Uberkreuzung der beiden caudal vom Zentralkörper verlaufenden Bündel konnte nicht
festgestellt werden. Diese beiden eben beschriebenen Bündelpaare innervieren das Corpus
allatum und das Dorsalgefäß.
Es gelang mir, diese Neurone auch durch Versilberung darzustellen. Bei dem in Abbildung
52 dargestellten Sagittalschnitt ist sowohl ein vor als auch ein hinter dem Zentralkörper
verlaufendes Axonenbündel getroffen. Man erkennt, daß die an der Vorderseite des
Zentralkörpers entlang ziehenden Fasern Kollateralen vor allem in die vorderen Teile des
Protocerebrums entsenden. Bei einer Faser ist auch ein zum Dorsalteil des Zentralkörpers
(CKd) ziehender Seitenast festzustellen. Von den caudal vom Zentralkörper hinziehenden
Fasern werden dagegen Seitenäste in erster Linie in den Z entralkörper selbst entsandt.
Ein weiterer Zelltypus der Pars intercerebralis ist in Abbildung 53 dargestellt. Die
Zellkörper dieser Neurone sind etwas kleiner als die der Biesenzellen und besitzen auch
nicht die starke Färbbarkeit wie die letzteren. Die Hauptverzweigungen dieses Neurons
liegen in dem fibrillären Teil der Pars intercerebralis anterior. Von hier aus zieht eine
starke Faser zum Tritocerebrum. Die Gesamtheit dieser Fasern bildet den Tractus chiasmaticus
(Tr.eh.). Die Überkreuzung erfolgt caudal von derjenigen der Biesenzellen. In
Abbildung 34 sind beide Überkreuzungen getroffen.
f) Die Protocerebralloben.
Unter dieser Bezeichnung faßt man alle jene Teile des Protocerebrums zusammen,
welche sich durch keine klar ausgeprägten Strukturen auszeichnen. Deutlich lassen sich
zwei Teile unterscheiden: der Hauptlappen, dessen Fasermasse den Zentralkörper, die
Brücke und die Pilze umhüllt, und der Nebenlappen (Laterallobus), welcher bei den Wanzen
ventral vom Hauptlappen liegt. Die Lagebeziehung dieser beiden Teile erkennt man
am besten auf Querschnitten. Abbildung 34c-e vermag diese Beziehung besser klarzulegen
als eine ausführliche Beschreibung.
Die histologische Analyse ergibt deutlich, daß sich sowohl die Hauptlappen als auch
die Nebenlappen aus Neuronen aufbauen, deren Aufgabe es ist, die verschiedenen Hirnteile
miteinander zu verbinden. Der Verlauf dieser Neurone ist oft so kompliziert, daß dieselben
nur ganz selten auf einem Schnitt in ihrer ganzen Länge getroffen sind. Die überwiegende
Mehrzahl derselben ist nach demselben Typus gebaut, wie er in Abbildung 54 d argestellt
ist. Durch ihre reichen Verästelungen und ihre weite Erstreckung in allen Dimensionen
des Baums, sind diese Zellen sehr geeignet, Verbindungen zu sehr vielen anderen
Neuronen herzustellen.
Die engen Beziehungen der Lobi optici zu den Protocerebralloben haben wir bereits
erwähnt. Die meisten der von den Lobi optici kommenden Bahnen endigen im Hauptlappen
des .Protocerebrums. Durch welche Neurone die Beize im einzelnen weitergeleitet werden,
ist durch Versilberung sehr schwer festzustellen, da nur selten die in Kontakt m iteinander
stehenden Neurone gleichzeitig imprägniert werden. Es läßt sich nur ganz allgemein
angeben, daß durch die Neurone der Protocerebralloben Verbindungen hergestellt werden
mit den Pilzglomeruli, mit dem Zentralkörper, mit der ändern Gehirnhälfte und mit dem
U nter schlundganglion.
Eine weiter gehende Analyse ist nur in dem engumgrenzten Bereich des Tuberculum
opticum durchzuführen. Die Lage dieses Hirnteils ist in Abbildung 35 b und Abbildung 31
(Tub.opt.) zu erkennen. Die durchziehenden Fasern des III. optischen Ganglions endigen
z.T., wie wir gesehen haben (Abb.31) im Tuberculum opticum, so daß man dasselbe mit
einer gewissen Berechtigung zum Lobus opticus rechnen könnte. Eine Kommissur stellt
die Verbindung zwischen den beiden Tubercula optica her. Diese Verbindung erfolgt durch
Neurone, wie das in Abbildung 55 dargestellt ist. Der Zellkörper liegt dem Tuberculum
von vorn her unmittelbar an. E r ist bei dem in Abbildung 55 dargestellten Schnitt nicht
getroffen.
Außer dieser Kommissur konnte noch eine andere Verbindung des Tuberculum opticum
festgestellt werden. Diese erfolgt durch Neurone, deren Zellkörper in dem vorderen
Winkel zwischen Protocerebrallobus und Lobus opticus liegen. Ihre Axone geben zahlreiche
Seitenzweige in das Tuberculum opticum ab und ziehen dann zwischen der aufsteigenden
Wurzel des Pilzes (Abb. 56 u. 57, Bs) und dem Pilzstiel hindurch zum Laterallobus
(Abb. 57, NL).
g) Protocerebralkommissuren.
Zahlreich sind die Verbindungen zwischen den beiden Hälften des Protocerebrums. Es
ist ganz unmöglich, sie alle aufzuzählen. Nur die stärkeren Verbindungsbahnen, welche