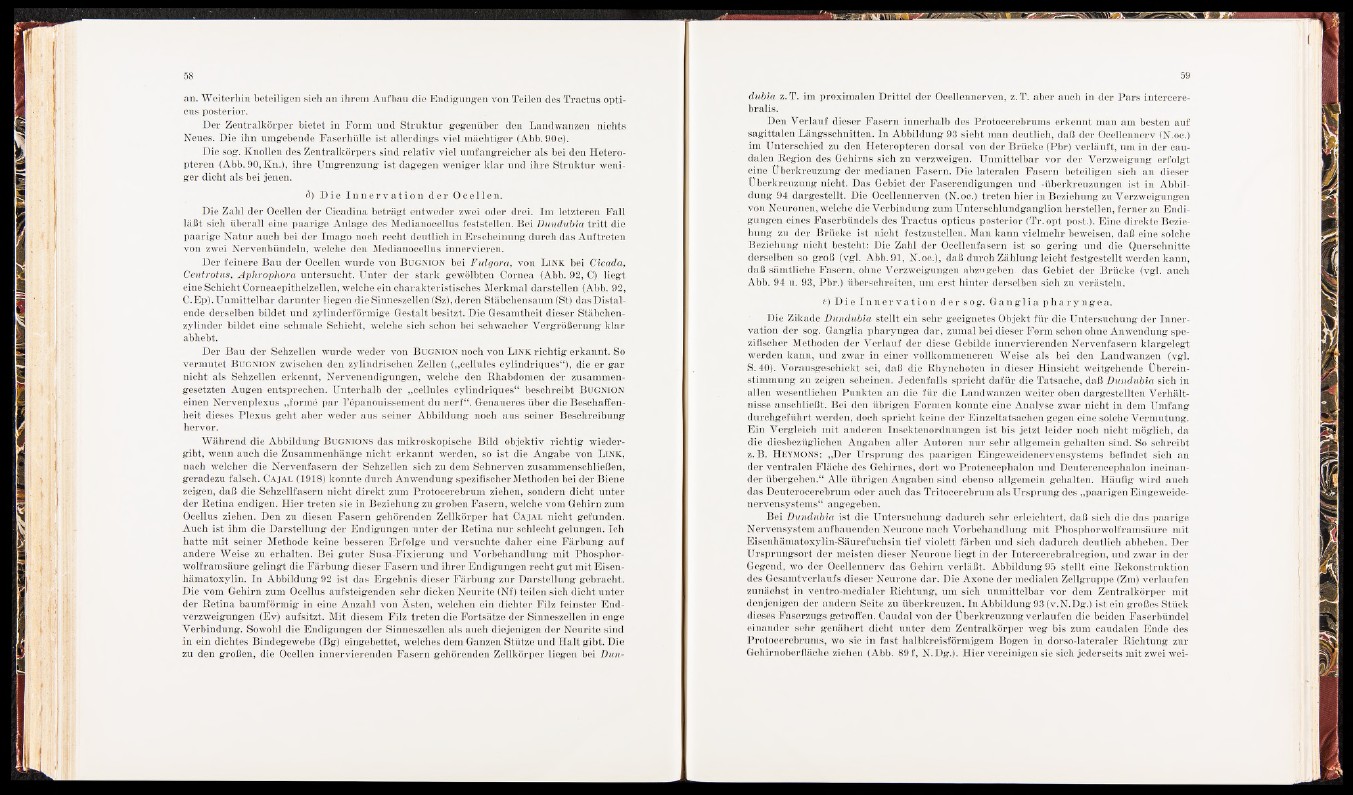
an. Weiterhin beteiligen sich an ihrem Aufbau die Endigungen von Teilen des Tractus opticus
posterior.
Der Zentralkörper bietet in Form und Struktur gegenüber den Landwanzen nichts
Neues. Die ihn umgebende Faserhülle ist allerdings viel mächtiger (Abb. 90c).
Die sog. Knollen des Z entralkörpers sind relativ viel umfangreicher als bei den Hetero-
pteren (Abb. 90, Kn.), ihre Umgrenzung ist dagegen weniger klar und ihre Struktur weniger
dicht als bei jenen.
<5) Di e I n n e r v a t i o n der O c e l l e n.
Die Zahl der Ocellen der Cicadina beträgt entweder zwei oder drei. Im letzteren Fall
läßt sich überall eine paarige Anlage des Medianocellus feststellen. Bei Dundubia tritt die
paarige Natur auch bei der Imago noch recht deutlich in Erscheinung durch das A uftreten
von zwei Nervenbündeln, welche den Medianocellus innervieren.
Der feinere Bau der Ocellen wurde von B u g n io n hei Fulgora, von L in k hei Cicada,
Centrotus, Aphrophora untersucht. Unter der stark gewölbten Cornea (Abb. 92, C) liegt
eine Schicht Corneaepithelzellen, welche ein charakteristisches Merkmal darstellen (Abb. 92,
C.Ep). Unmittelbar darunter liegen die Sinneszellen (Sz), deren Stäbchensaum (St) das Distalende
derselben bildet und zylinderförmige Gestalt besitzt. Die Gesamtheit dieser Stäbchenzylinder
bildet eine schmale Schicht, welche sich schon bei schwacher Vergrößerung klar
abhebt.
Der Bau der Sehzellen wurde weder von B u g n io n noch von L in k richtig erkannt. So
vermutet B u g n io n zwischen den zylindrischen Zellen („cellules cylindriques“), die er gar
nicht als Sehzellen erkennt, Nervenendigungen, welche den Rhabdomen der zusammengesetzten
Augen entsprechen. Unterhalb der „cellules cylindriques“ beschreibt B ug n io n
einen Nervenplexus „formé par l’épanouissement du nerf“. Genaueres über die Beschaffenheit
dieses Plexus geht aber weder aus seiner Abbildung noch aus seiner Beschreibung
hervor.
Während die Abbildung B u g n io n s das mikroskopische Bild objektiv richtig wiedergibt,
wenn auch die Zusammenhänge nicht erkannt werden, so ist die Angabe von L in k ,
nach welcher die Nervenfasern der Sehzellen sich zu dem Sehnerven zusammenschließen,
geradezu falsch. C a ja l (1918) konnte durch Anwendung spezifischer Methoden bei der Biene
zeigen, daß die Sehzellfasern nicht direkt zum Protocerebrum ziehen, sondern dicht unter
der Retina endigen. Hier treten sie in Beziehung zu groben Fasern, welche vom Gehirn zum
Ocellus ziehen. Den zu diesen Fasern gehörenden Zellkörper hat C a ja l nicht gefunden.
Auch ist ihm die Darstellung der Endigungen unter der Retina nur schlecht gelungen. Ich
hatte mit seiner Methode keine besseren Erfolge und versuchte daher eine Färbung auf
andere Weise zu erhalten. Bei guter Susa-Fixierung und Vorbehandlung mit Phosphorwolframsäure
gelingt die Färbung dieser Fasern und ihrer Endigungen recht gut m it Eisen-
hämatoxylin. In Abbildung 92 ist das Ergebnis dieser Färbung zur Darstellung gebracht.
Die vom Gehirn zum Ocellus aufsteigenden sehr dicken Neurite (Nf) teilen sich dicht unter
der Retina haumförmig in eine Anzahl von Ästen, welchen ein dichter Filz feinster Endverzweigungen
(Ev) aufsitzt. Mit diesem Filz treten die Fortsätze der Sinneszellen in enge
Verbindung. Sowohl die Endigungen der Sinneszellen als auch diejenigen der Neurite sind
in ein dichtes Bindegewebe (Bg) eingebettet, welches dem Ganzen Stütze und Halt gibt. Die
zu den großen, die Ocellen innervierenden Fasern gehörenden Zellkörper liegen bei Dundubia
z. T. im proximalen Drittel der Ocellennerven, z. T. aber auch in der Pars intercere-
bralis.
Den Verlauf dieser Fasern innerhalb des Protocerebrums erkennt man am besten auf
sagittalen Längsschnitten. In Abbildung 93 sieht man deutlich, daß der Ocellennerv (N.oc.)
im Unterschied zu den Heteropteren dorsal von der Brücke (Pbr) verläuft, um in der cau-
dalen Region des Gehirns sich zu verzweigen. Unmittelbar vor der Verzweigung erfolgt
eine Überkreuzung der medianen Fasern. Die lateralen Fasern beteiligen sich an dieser
Überkreuzung nicht. Das Gebiet der Faserendigungen und -Überkreuzungen ist in Abbildung
94 dargestellt. Die Ocellennerven (N.oc.) treten hier in Beziehung zu Verzweigungen
von Neuronen, welche die Verbindung zum Unterschlundganglion hersteilen, ferner zu Endigungen
eines Faserbündels des Tractus opticus posterior (Tr.opt post.). Eine direkte Beziehung
zu der Brücke ist nicht festzustellen. Man kann vielmehr beweisen, daß eine solche
Beziehung nicht besteht: Die Zahl der Ocellenfasern ist so gering und die Querschnitte
derselben so groß (vgl. Abb. 91, N.oc.), daß durch Zählung leicht festgestellt werden kann,
daß sämtliche Fasern, ohne Verzweigungen abzu gehen das Gebiet der Brücke (vgl. auch
Abb. 94 u. 93, Pbr.) überschreiten, um erst hinter derselben sich zu verästeln.
e) D ie I n n e r v a t i o n d e r s o g . G a n g l i a p h a r y n g e a .
Die Zikade Dundubia stellt ein sehr geeignetes Objekt für die Untersuchung der Innervation
der sog. Ganglia pharyngea dar, zumal hei dieser Form schon ohne Anwendung spezifischer
Methoden der Verlauf der diese Gebilde innervierenden Nervenfasern klargelegt
werden kann, und zwar in einer vollkommeneren Weise als bei den Landwanzen (vgl.
S. 40). Vorausgeschickt sei, daß die Rhynchoten in dieser Hinsicht weitgehende Übereinstimmung
zu zeigen scheinen. Jedenfalls spricht dafür die Tatsache, daß Dundubia sich in
allen wesentlichen Punkten an die für die Landwanzen weiter oben dargestellten Verhältnisse
anschließt. Bei den übrigen Formen konnte eine Analyse zwar nicht in dem Umfang
durchgeführt werden, doch spricht keine der Einzeltatsachen gegen eine solche Vermutung.
Ein Vergleich mit anderen Insektenordnungen ist bis jetzt leider noch nicht möglich, da
die diesbezüglichen Angaben aller Autoren nur sehr allgemein gehalten sind. So schreibt
z.B. H eymons: „Der Ursprung des paarigen Eingeweidenervensystems befindet sich an
der ventralen Fläche des Gehirnes, dort wo Protencephalon und Deuterencephalon ineinander
übergehen.“ Alle übrigen Angaben sind ebenso allgemein gehalten. Häufig wird auch
das Deuterocerehrum oder auch das Tritocerebrum als Ursprung des „paarigen Eingeweidenervensystems“
angegeben.
Bei Dundubia ist die Untersuchung dadurch sehr erleichtert, daß sich die das paarige
Nervensystem auf bauenden Neurone nach Vorbehandlung mit Phosphor wolframsäure mit
Eisenhämatoxylin-Säurefuchsin tief violett färben und sich dadurch deutlich abheben. Der
Ursprungsort der meisten dieser Neurone liegt in der Intercerehralregion, und zwar in der
Gegend, wo der Ocellennerv das Gehirn verläßt. Abbildung 95 stellt eine Rekonstruktion
des Gesamtverlaufs dieser Neurone dar. Die Axone der medialen Zellgruppe (Zm) verlaufen
zunächst in ventro-medialer Richtung, um sich unmittelbar vor dem Zentralkörper mit
denjenigen der ändern Seite zu überkreuzen. In Abbildung 93 (v.N.Dg.) ist ein großes Stück
dieses Faserzugs getroffen. Caudal von der Überkreuzung verlaufen die beiden Faserbündel
einander sehr genähert dicht unter dem Zentralkörper weg bis zum caudalen Ende des
Protocerebrums, wo sie in fast halbkreisförmigem Bogen in dorso-lateraler Richtung zur
Gehirnoberfläche ziehen (Abb. 89 f, N. Dg.). Hier vereinigen sie sich jederseits mit zwei wei