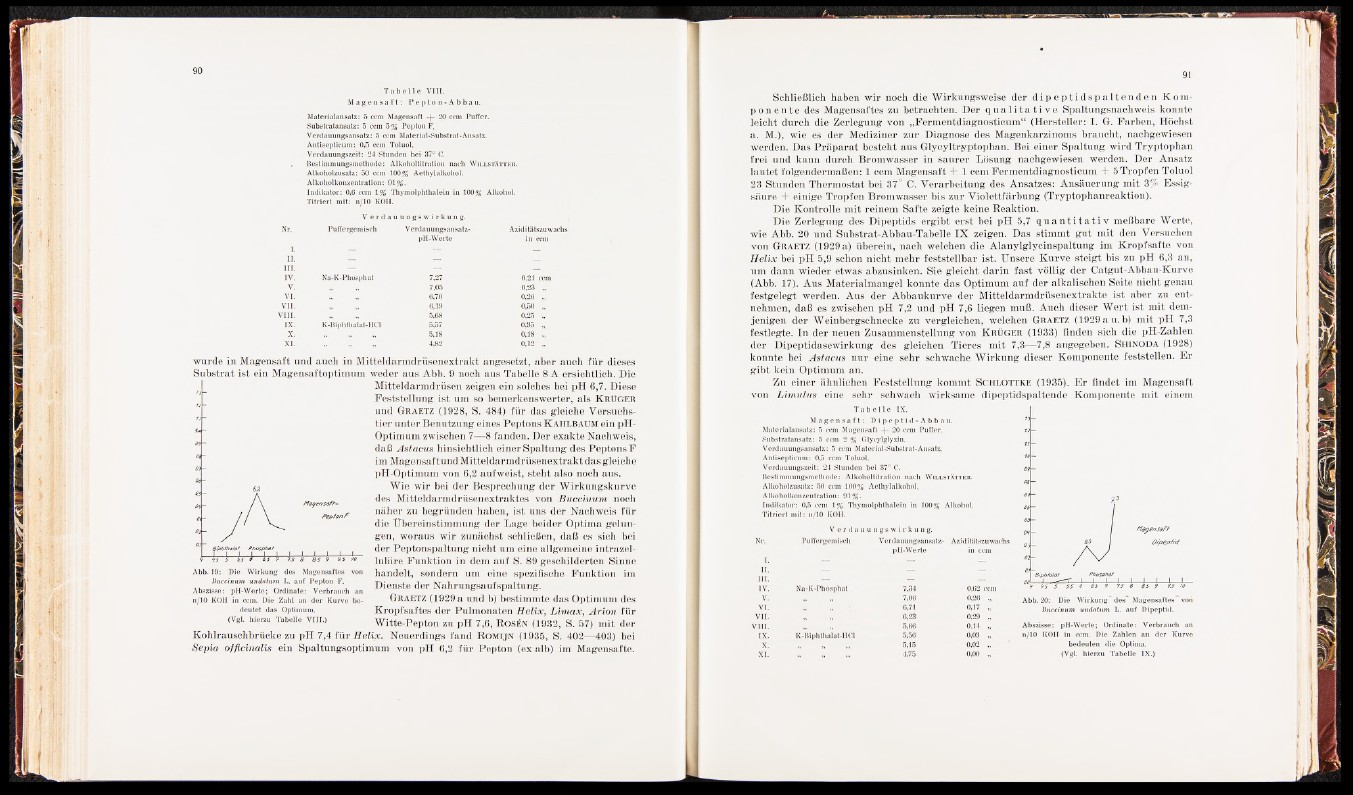
T a b e l l e VIII.
M a g e n s a f t : P e p t o n - A b b a u .
Materialansatz: 5 ccm Magensaft -J- 20 ccm Puffer.
Substratansatz: 5 ccm 5% Pepton F.
Verdauungsansatz: 5 ccm Material-Substrat-Ansatz.
Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.
Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.
Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W il l stä t t e r .
Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.
Alkoholkonzentration: 91 %.
Indikator: 0,6 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.
Titriert mit: n/10 KOH.
V e r d a u u n g s w i r k u n g .
Puffergemisch VerdauungsansatzpH
Werte
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Na-K-Phosphat
K-Biphthalat-HCl
6,70
6,19
5,68
5,57
5,18
4,82
Aziditätszuwachs1
in ccm
0,21 (
0,23
0,26
0,50
0,25
0,35
0,18
0,12
wurde in Magensaft und auch in Mitteldarmdrüsenextrakt angesetzt, aber auch für dieses
Substrat ist ein Magensaftoptimum weder aus Abb. 9 noch aus Tabelle 8 A ersichtlich. Die
Mitteldarmdrüsen zeigen ein solches bei pH 6,7. Diese
Feststellung ist um so bemerkenswerter, als K rüger
und Graetz (1928, S. 484) für das gleiche Versuchstier
unter Benutzung eines Peptons K ahlbaum ein pH-
Optimum zwischen 7—8 fanden. Der exakte Nachweis,
daß Astacus hinsichtlich einer Spaltung des Peptons F
im Magensaftund Mitteldarmdrüsenextrakt das gleiche
pH-Optimum von 6,2 aufweist, steht also noch aus.
Wie wir bei der Besprechung der Wirkungskurve
des Mitteldarmdrüsenextraktes von Buccinum noch
näher zu begründen haben, ist uns der Nachweis für
die Übereinstimmung der Lage beider Optima gelungen,
woraus wir zunächst schließen, daß es sich bei
der Peptonspaltung nicht um eine allgemeine intrazelluläre
Funktion in dem auf S. 89 geschilderten Sinne
handelt, sondern um eine spezifische Funktion im
Dienste der Nahrungsaufspaltung.
G r a e t z (1929 a und b) bestimmte das Optimum des
Kropfsaftes der Pulmonaten Helix, Limax, Arion für
Witte-Pepton zu pH 7,6, RosiN (1932, S. 57) mit der
Abb. 19: Die Wirkung des Magensaftes vor
Buccinum undatum L. auf Pepton F.
Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch ar
n/10 KOH in ccm. Die Zahl an der Kurve bedeutet
das Optimum.
(Vgl. hierzu Tabelle VIII.)
Kohlrauschbrücke zu pH 7,4 fü r Helix. Neuerdings fand R o m i j n (1935, S. 402—403) bei
Sepia officinalis ein Spaltungsoptimum von pH 6,2 für Pepton (ex alb) im Magensafte.
Schließlich haben wir noch die Wirkungsweise der d i p e p t i d s p a l t e n d e n Kom p
o n e n t e des Magensaftes zu betrachten. Der q u a l i t a t i v e Spaltungsnachweis konnte
leicht durch die Zerlegung von „Fermentdiagnosticum“ (Hersteller: I. G. Farben, Höchst
a. M.), wie es der Mediziner zur Diagnose des Magenkarzinoms braucht, nachgewiesen
werden. Das P räp a ra t besteht aus Glycyltryptophan. Bei einer Spaltung wird Tryptophan
frei und kann durch Bromwasser in saurer Lösung nachgewiesen werden. Der Ansatz
lautet folgendermaßen: 1 ccm Magensaft + 1 ccm Fermentdiagnosticum + 5 Tropfen Toluol
23 Stunden Thermostat bei 37° C. Verarbeitung des Ansatzes: Ansäuerung mit 3% Essigsäure
+ einige Tropfen Bromwasser bis zur Violettfärbung (Tryptophanreaktion).
Die Kontrolle mit reinem Safte zeigte keine Reaktion.
Die Zerlegung des Dipeptids ergibt erst hei pH 5,7 q u a n t i t a t i v meßbare Werte,
wie Abb. 20 und Substrat-Abbau-Tabelle IX zeigen. Das stimmt gut mit den Versuchen
von G r a e t z (1929 a) überein, nach welchen die Alanylglycinspaltung im Kropfsafte von
Helix hei pH 5,9 schon nicht mehr feststellbar ist. Unsere Kurve steigt bis zu pH 6,3 an,
um dann wieder etwas ahzusinken. Sie gleicht darin fast völlig der Catgut-Abbau-Kurve
(Abb. 17). Aus Materialmangel konnte das Optimum auf der alkalischen Seite nicht genau
festgelegt werden. Aus der Ahbaukurve der Mitteldarmdrüsenextrakte ist aber zu entnehmen,
daß es zwischen pH 7,2 und pH 7,6 liegen muß. Auch dieser Wert ist mit demjenigen
der Weinbergschnecke zu vergleichen, welchen G r a e t z (1929a u .b ) mit pH 7,3
festlegte. In der neuen Zusammenstellung von K r ü g e r (1933) finden sich die pH-Zahlen
der Dipeptidasewirkung des gleichen Tieres mit 7,3—7,8 angegeben. S h in o d a (1928)
konnte bei Astacus nur eine sehr schwache Wirkung dieser Komponente feststellen. Er
gibt kein Optimum an.
Zu einer ähnlichen Feststellung kommt S c h l o t t k e (1935). E r findet im Magensaft
von Limulus eine sehr schwach wirksame dipeptidspaltende Komponente mit einem
T a b e l l e IX.
M a g e n s a f t : D i p e p t i d - A b b a u .
Materialansatz: 5 ccm Magensaft -|- 20 ccm Puffer.
Substratansatz: 5 ccm 2 % Glycylglyzin.
Verdauungsansatz: 5 ccm Material-Substrat-Ansatz.
Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.
Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.
Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W il l s tä t t er .
Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.
Alkoholkonzentration: 91%.
Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.
Titriert mit: n/10 KOH.
II.
III.
VIII.
IX.
Verdi
Puffergemisch
Na-K-Phosphat
K-Biphthalat-HCl
u u n g s
Vei
Wirkung.
dauungsansatzpH
Werte
6,71
6,23
5,66
5,56
5,15
Aziditätszuwachs
0,62 <
0,26
0,17
0,29
0,14
0,03
Abb. 20: Die Wirkung des Magensaftes von
Buccinum undatum L. auf Dipeptid.
Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an
n/10 KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve
bedeuten die Optima.
(Vgl. hierzu Tabelle IX.)