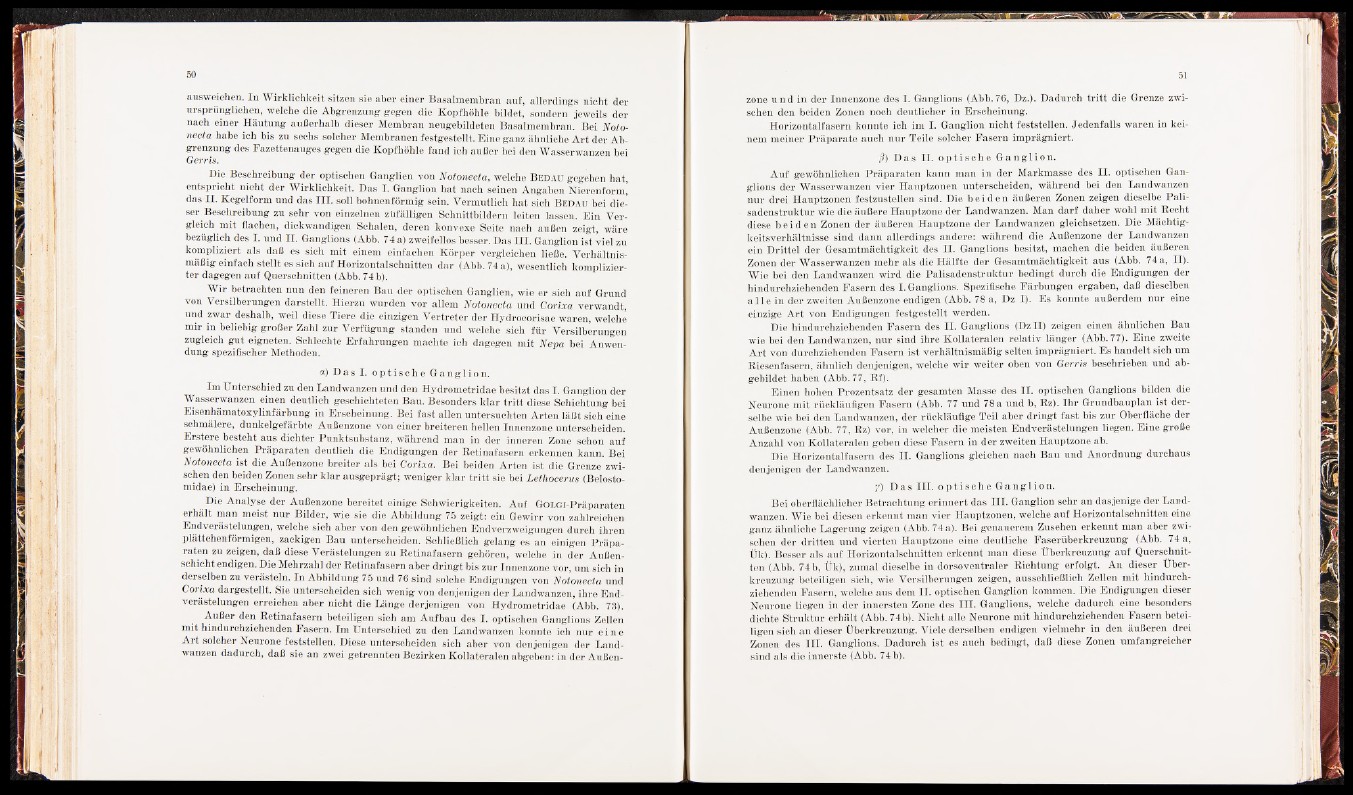
ausweichen. In Wirklichkeit sitzen sie aber einer Basalmembran auf, allerdings nicht der
ursprünglichen, welche die Abgrenzung gegen die Kopf höhle bildet, sondern jeweils der
nach einer Häutung außerhalb dieser Membran neugebildeten Basalmembran. Bei Noto-
necta habe ich bis zu sechs solcher Membranen festgestellt. E ine ganz ähnliche A rt der Abgrenzung
des Fazettenauges gegen die Kopfhöhle fand ich außer bei den Wasserwanzen hei
Gerris.
Die Beschreibung der optischen Ganglien von Notonecta, welche B ed a u gegeben hat,
entspricht nicht der Wirklichkeit. Das I. Ganglion hat nach seinen Angaben Nierenform,
das-II. Kegelform und das III. soll bohnenförmig sein. Vermutlich hat sich B ed a u beidie-
ser Beschreibung zu sehr von einzelnen zufälligen Sehnittbildern leiten lassen. Ein Vergleich
mit flachen, dickwandigen Schalen, deren konvexe Seite nach außen zeigt, wäre
bezüglich des I. und II. Ganglions (Abh. 74 a) zweifellos besser. Das III. Ganglion ist viel zu
kompliziert als daß es sich mit einem einfachen Körper vergleichen ließe. Verhältnismäßig
einfach stellt es sich auf Horizontalschnitten dar (Abb. 74 a), wesentlich komplizierter
dagegen auf Querschnitten (Abb. 74 b).
Wir betrachten nun den feineren Bau der optischen Ganglien, wie er sich auf Grund
von Versilberungen darstellt. Hierzu wurden vor allem Notonecta und Corixa verwandt,
und zwar deshalb, weil diese Tiere die einzigen Vertreter der Hydrocorisae waren, welche
mir in beliebig großer Zahl zur Verfügung standen und welche sich für Versilberungen
zugleich gut eigneten. Schlechte Erfahrungen machte ich dagegen mit Nepa bei Anwendung
spezifischer Methoden.
a) D a s I . o p t i s c h e G a n g l i o n .
Im Unterschied zu den Landwanzen und den Hydrometridae besitzt das I. Ganglion der
Wasserwanzen einen deutlich geschichteten Bau. Besonders klar tritt diese Schichtung bei
Eisenhämatoxylinfärbung in Erscheinung. Bei fast allen untersuchten Arten läßt sich eine
schmälere, dunkelgefärbte Außenzone von einer breiteren hellen Innenzone unterscheiden.
Erstere besteht aus dichter Punktsubstanz, während man in der inneren Zone schon auf
gewöhnlichen Präparaten deutlich die Endigungen der Betinafasern erkennen kann. Bei
Notonecta ist die Außenzone breiter als bei Corixa. Bei beiden Arten ist die Grenze zwischen
den beiden Zonen sehr klar ausgeprägt; weniger klar tritt sie bei Lethocerus (Belosto-
midae) in Erscheinung.
Die Analyse der Außenzone bereitet einige Schwierigkeiten. Auf GOLGI-Präparaten
erhält man meist nur Bilder, wie sie die Abbildung 75 zeigt: ein Gewirr von zahlreichen
Endverästelungen, welche sich aber von den gewöhnlichen Endverzweigungen durch ihren
plättehenförmigen, zackigen Bau unterscheiden. Schließlich gelang es an einigen Präp a raten
zu zeigen, daß diese Verästelungen zu Betinafasern gehören, welche in der Außenschicht
endigen. Die Mehrzahl der Betinafasern aber dringt bis zur Innenzone vor, um sich in
derselben zu verästeln. In Abbildung 75 und 76 sind solche Endigungen von Notonecta und
Corixa dargestellt. Sie unterscheiden sieh wenig von denjenigen der Landwanzen, ihre Endverästelungen
erreichen aber nicht die Länge derjenigen von Hydrometridae (Abb. 73).
Außer den Betinafasern beteiligen sich am Aufbau des I. optischen Ganglions Zellen
mit hindurchziehenden Fasern. Im Unterschied zu den Landwanzen konnte ich nur e ine
Art solcher Neurone feststellen. Diese unterscheiden sich aber von denjenigen der Landwanzen
dadurch, daß sie an zwei getrennten Bezirken Kollateralen abgeben: in der Außenzone
u n d in der Innenzone des I. Ganglions (Abb.76, Dz.). Dadurch tritt die Grenze zwischen
den beiden Zonen noch deutlicher in Erscheinung.
Horizontalfasern konnte ich im I. Ganglion nicht feststellen. Jedenfalls waren in keinem
meiner Präparate auch nur Teile solcher Fasern imprägniert.
ß) D a s II. o p t i s c h e Ga n g l io n .
Auf gewöhnlichen Präparaten kann man in der Markmasse des II. optischen Ganglions
der Wasserwanzen vier Hauptzonen unterscheiden, während bei den Landwanzen
nur drei Hauptzonen festzustellen sind. Die b e i d e n äußeren Zonen zeigen dieselbe Pa lisadenstruktur
wie die äußere Hauptzone der Landwanzen. Man darf daher wohl mit Becht
diese b e i d e n Zonen der äußeren Hauptzone der Landwanzen gleiehsetzen. Die Mächtigkeitsverhältnisse
sind dann allerdings andere: während die Außenzone der Landwanzen
ein Drittel der Gesamtmächtigkeit des II. Ganglions besitzt, machen die beiden äußeren
Zonen der Wasserwanzen mehr als die Hälfte der Gesamtmächtigkeit aus (Abb. 74 a, II).
Wie bei den Landwanzen wird die Palisadenstruktur bedingt durch die Endigungen der
hindurehziehenden Fasern des I. Ganglions. Spezifische Färbungen ergaben, daß dieselben
a l l e in der zweiten Außenzone endigen (Abb. 78 a, Dz I). Es konnte außerdem nur eine
einzige Art von Endigungen festgestellt werden.
Die hindurchziehenden Fasern des II. Ganglions (Dz II) zeigen einen ähnlichen Bau
wie bei den Landwanzen, nur sind ihre Kollateralen relativ länger (Abb. 77). Eine zweite
Art von durchziehenden Fasern ist verhältnismäßig selten imprägniert. Es handelt sich um
Kiesenfasern, ähnlich denjenigen, welche wir weiter oben von Gerris beschrieben und abgebildet
haben (Abb. 77, Bf).
Einen hohen Prozentsatz der gesamten Masse des II. optischen Ganglions bilden die
Neurone mit rückläufigen Fasern (Abb. 77 und 78a und b, Bz). Ih r Grundbauplan ist derselbe
wie bei den Landwanzen, der rückläufige Teil aber dringt fast bis zur Oberfläche der
Außenzone (Abb. 77, Bz) vor, in welcher die meisten Endverästelungen liegen. Eine große
Anzahl von Kollateralen geben diese Fasern in der zweiten Hauptzone ab.
Die Horizontalfasern des II. Ganglions gleichen nach Bau und Anordnung durchaus
denjenigen der Landwanzen.
y) D a s III. o p t i s c h e Ga ngl i on.
Bei oberflächlicher B etrachtung erinnert das III. Ganglion sehr an dasjenige der L andwanzen.
Wie bei diesen erkennt man vier Hauptzonen, welche auf Horizontalschnitten eine
ganz ähnliche Lagerung zeigen (Abb. 74a). Bei genauerem Zusehen erkennt man aber zwischen
der dritten und vierten Hauptzone eine deutliche Faserüberkreuzung (Abb. 74 a,
Ük). Besser als auf Horizontalschnitten erkennt man diese tlberkreuzung auf Querschnitten
(Abb. 74b, Ük), zumal dieselbe in dorsoventraler Bichtung erfolgt. An dieser Überkreuzung
beteiligen sich, wie Versilberungen zeigen, ausschließlich Zellen mit hindurchziehenden
Fasern, welche aus dem II. optischen Ganglion kommen. Die Endigungen dieser
Neurone liegen in der innersten Zone des III. Ganglions, welche dadurch eine besonders
dichte Struktur erhält (Abh. 74b). Nicht alle Neurone mit hindurchziehenden Fasern beteiligen
sich an dieser Überkreuzung. Viele derselben endigen vielmehr in den äußeren drei
Zonen des III. Ganglions. Dadurch ist es auch bedingt, daß diese Zonen umfangreicher
sind als die innerste (Abb. 74 b).