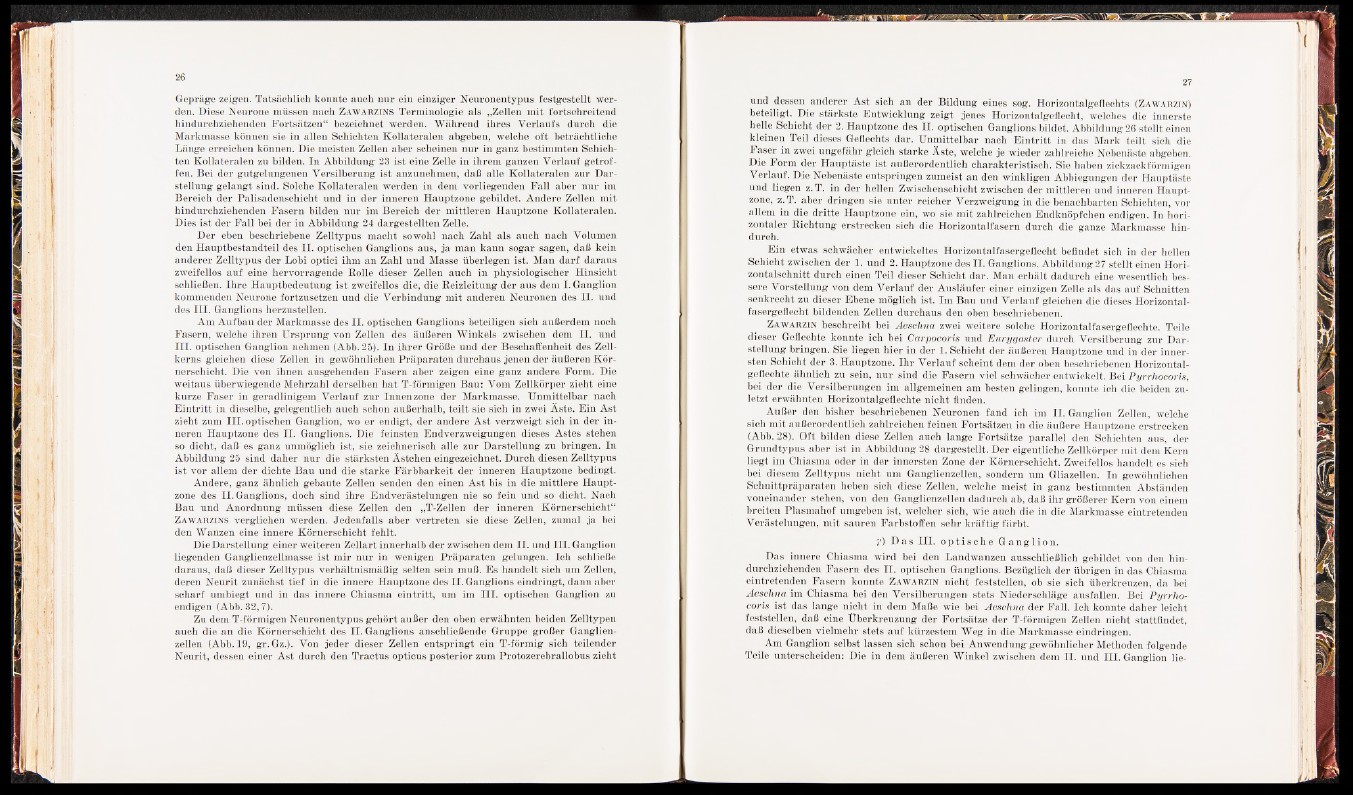
Gepräge zeigen. Tatsächlich konnte auch nur ein einziger Neuronentypus festgestellt werden.
Diese Neurone müssen nach Z a w a r z in s Terminologie als „Zellen mit fortschreitend
hindurchziehenden Fortsätzen“ bezeichnet werden. Während ihres Verlaufs durch die
Markmasse können sie in allen Schichten Kollateralen abgeben, welche oft beträchtliche
Länge erreichen können. Die meisten Zellen aber scheinen nur in ganz bestimmten Schichten
Kollateralen zu bilden. In Abbildung 23 ist eine Zelle in ihrem ganzen Verlauf getroffen.
Bei der gutgelungenen Versilberung ist anzunehmen, daß alle Kollateralen zur Darstellung
gelangt sind. Solche Kollateralen werden in dem vorliegenden Fall aber nur im
Bereich der Palisadenschicht und in der inneren Hauptzone gebildet. Andere Zellen mit
hindurchziehenden Fasern bilden nur im Bereich der mittleren Hauptzone Kollateralen.
Dies ist der Fall bei der in Abbildung 24 dargestellten Zelle.
Der eben beschriebene Zelltypus macht sowohl nach Zahl als auch nach Volumen
den Hauptbestandteil des II. optischen Ganglions aus, ja man kann sogar sagen, daß kein
anderer Zelltypus der Lobi optici ihm an Zahl und Masse überlegen ist. Man darf daraus
zweifellos auf eine hervorragende Rolle dieser Zellen auch in physiologischer Hinsicht
schließen. Ihre Hauptbedeutung ist zweifellos die, die Reizleitung der aus dem I. Ganglion
kommenden Neurone fortzusetzen und die Verbindung mit anderen Neuronen des II. und
des III. Ganglions herzustellen.
Am Aufbau der Markmasse des II. optischen Ganglions beteiligen sich außerdem noch
Fasern, welche ihren Ursprung von Zellen des äußeren Winkels zwischen dem II. und
III. optischen Ganglion nehmen (Abb. 25). In ihrer Größe und der Beschaffenheit des Zellkerns
gleichen diese Zellen in gewöhnlichen Präparaten durchaus jenen der äußeren K örnerschicht.
Die von ihnen ausgehenden Fasern aber zeigen eine ganz andere Form. Die
weitaus überwiegende Mehrzahl derselben hat T-förmigen Bau: Vom Zellkörper zieht eine
kurze Faser in geradlinigem Verlauf zur Innen zone der Markmasse. Unmittelbar nach
E in tritt in dieselbe, gelegentlich auch schon außerhalb, teilt sie sich in zwei Äste. Ein Ast
zieht zum III. optischen Ganglion, wo er endigt, der andere Ast verzweigt sich in der inneren
Hauptzone des II. Ganglions. Die feinsten Endverzweigungen dieses Astes stehen
so dicht, daß es ganz unmöglich ist, sie zeichnerisch alle zur Darstellung zu bringen. In
Abbildung 25 sind daher nur die stärksten Ästchen eingezeichnet. Durch diesen Zelltypus
ist vor allem der dichte Bau und die starke Färbbarkeit der inneren Hauptzone bedingt.
Andere, ganz ähnlich gebaute Zellen senden den einen Ast bis in die mittlere Hauptzone
des II. Ganglions, doch sind ihre End Verästelungen nie so fein und so dicht. Nach
Bau und Anordnung müssen diese Zellen den „T-Zellen der inneren Körnerschicht“
Z a w a r z in s verglichen werden. Jedenfalls aber vertreten sie diese Zellen, zumal ja bei
den Wanzen eine innere Körnerschicht fehlt.
Die Darstellung einer weiteren Zellart innerhalb der zwischen dem II. und III. Ganglion
liegenden Ganglienzellmasse ist mir nur in wenigen Präparaten gelungen. Ich schließe
daraus, daß dieser Zelltypus verhältnismäßig selten sein muß. Es handelt sich um Zellen,
deren Neurit zunächst tief in die innere Hauptzone des II. Ganglions eindringt, dann aber
scharf umbiegt und in das innere Chiasma eintritt, um im III. optischen Ganglion zu
endigen (Abb. 32,7).
Zu dem T-förmigen Neuronentypus gehört außer den oben erwähnten beiden Zelltypen
auch die an die Körnerschicht des II. Ganglions anschließende Gruppe großer Ganglienzellen
(Abb. 19, gr. Gz.). Von jeder dieser Zellen entspringt ein T-förmig sich teilender
Neurit, dessen einer Ast durch den Tractus opticus posterior zum Protozerebrallobus zieht
und dessen anderer Ast sich an der Bildung eines sog. Horizontalgeflechts (Z a w a r z in )
beteiligt. Die stärkste Entwicklung zeigt jenes Horizontalgeflecht, welches die innerste
helle Schicht der 2. Hauptzone des II. optischen Ganglions bildet. Abbildung 26 stellt einen
kleinen Teil dieses Geflechts dar. Unmittelbar nach E in tritt in das Mark teilt sich die
Easer in zwei ungefähr gleich starke Äste, welche je wieder zahlreiche Nebenäste abgeben.
Die Form der Hauptäste ist außerordentlich charakteristisch. Sie haben zickzackförmigen
Verlauf. Die Nebenäste entspringen zumeist an den winkligen Abbiegungen der Hauptäste
und liegen z.T. in der hellen Zwischenschicht zwischen der mittleren und inneren Hauptzone,
z. T. aber dringen sie unter reicher Verzweigung in die benachbarten Schichten, vor
allem in die dritte Hauptzone ein, wo Sie mit zahlreichen Endknöpfchen endigen. In horizontaler
Richtung erstrecken sich die Horizontalfasern durch die ganze Markmasse hindurch.
Ein etwas schwächer entwickeltes Horizontalfasergeflecht befindet sich in der hellen
Schicht zwischen der 1. und 2. Hauptzone des II. Ganglions. Abbildung 27 stellt einen Hori-
zontalschnitt durch einen Teil dieser Schicht dar. Man erhält dadurch eine wesentlich bes-
sere Vorstellung von dem Verlauf der Ausläufer einer einzigen Zelle als das auf Schnitten
senkrecht zu dieser Ebene möglich ist. Im Bau und Verlauf gleichen die diesessHorizontalfasergeflecht
bildenden Zellen durchaus den oben beschriebenen.
Z a w a r z in beschreibt bei Aeschna zwei weitere solche Horizontalfasergefleehte. Teile
dieser Geflechte konnte ich bei Garpocoris und Eurygaster durch Versilberung zur Darstellung
bringen. Sie liegen hier in der 1. Schicht der äußeren Hauptzone und in der innersten
Schicht der 3. Hauptzone. Ih r Verlauf scheint dem der oben beschriebenen Horizontalgeflechte
ähnlich zu sein, nur sind die Fasern viel schwächer entwickelt. Bei Pyrrhocoris,
hei der die Versilberungen im allgemeinen am besten gelingen, konnte ich die beiden zuletzt
erwähnten Horizontalgefleehte nicht finden.
Außer den bisher beschriebenen Neuronen fand ich im II. Ganglion Zellen, welche
sich mit außerordentlich zahlreichen feinen Fortsätzen in die äußere Hauptzone erstrecken
(Abb. 28). Oft bilden diese Zellen auch lange Fortsätze parallel den Schichten aus, der
Grundtypus aber ist in Abbildung 28 dargestellt. Der eigentliche Zellkörper mit dem Kern
liegt im Chiasma oder in der innersten Zone der Körnerschicht, Zweifellos handelt es sich
bei diesem Zelltypus nicht um Ganglienzellen, sondern um Gliazellen. In gewöhnlichen
Sehnittpräparaten heben sich diese Zellen, welche meist in ganz bestimmten Abständen
voneinander stehen, von den Ganglienzellen dadurch ab, daß ihr größerer K ern von einem
breiten Plasmahof umgeben ist, welcher sieh, wie auch die in die Markmasse eintretenden
Verästelungen, mit sauren Farbstoffen sehr kräftig färbt.
’/) D a s in. o p t i s c h e Ga n g l io n .
Das innere Chiasma wird bei den Landwanzen ausschließlich gebildet von den hindurehziehenden
Fasern des II. optischen Ganglions. Bezüglich der übrigen in das Chiasma
eintretenden Fasern konnte ZAWARZIN nicht feststellen, ob sie sich überkreuzen, da bei
Aeschna im Chiasma bei den Versilberungen stets Niederschläge ausfallen. Bei Pyrrhocoris
ist das lange nicht in dem Maße wie bei Aeschna der Fall. Ich konnte daher leicht
feststellen, daß eine Üherkreuzung der Fortsätze der T-förmigen Zellen nicht stattfindet,
daß dieselben vielmehr stets auf kürzestem Weg in die Markmasse eindringen.
Am Ganglion selbst lassen sieh schon bei Anwendung gewöhnlicher Methoden folgende
Teile unterscheiden: Die in dem äußeren Winkel zwischen dem II. und III. Ganglion lie