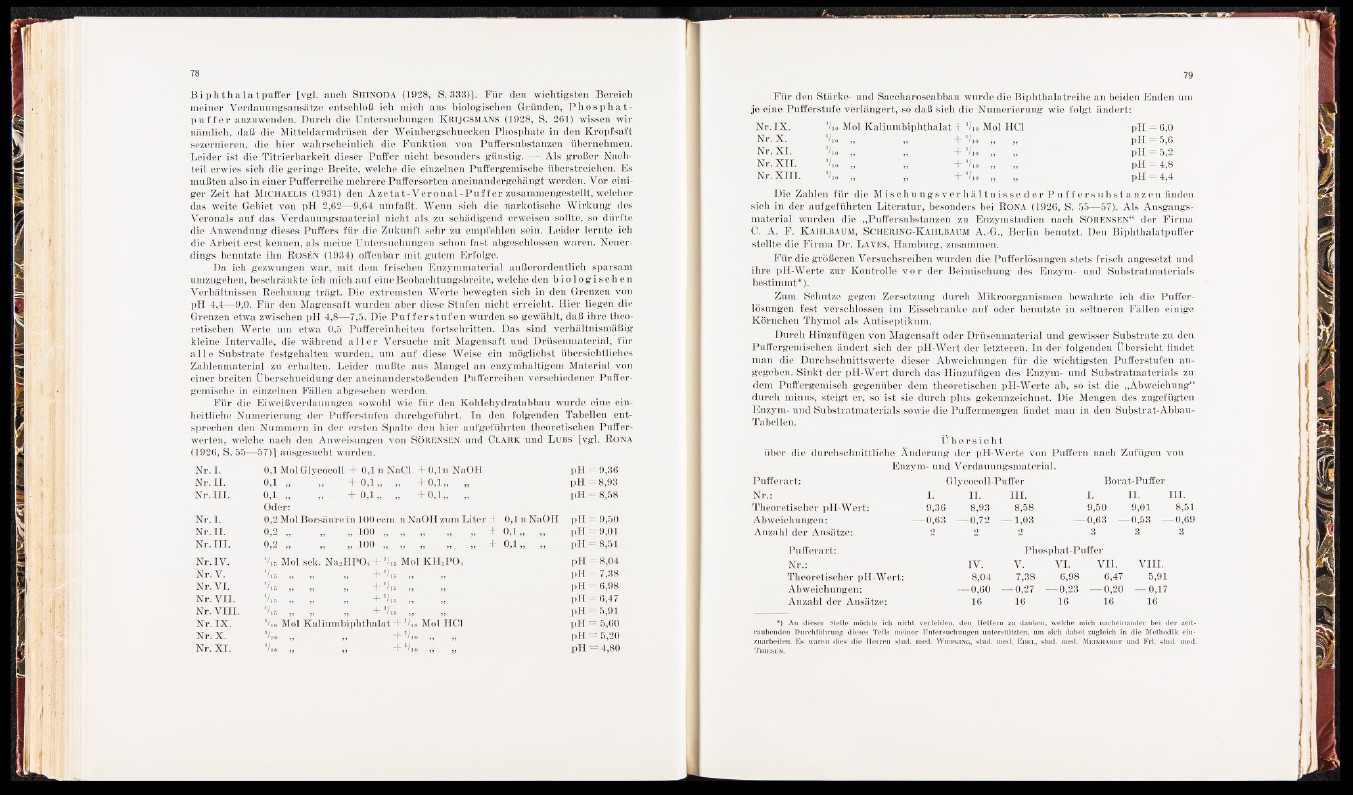
B i p h t h a l a t puffer [vgl. auch Shinoda (1928, S. 333)]. Fü r den wichtigsten Bereich
meiner Verdauungsansätze entschloß ich mich aus biologischen Gründen, P h o s p h a t p
u f f e r anzuwenden. Durch die Untersuchungen KRIJGSMANS (1928, S. 261) wissen wir
nämlich, daß die Mitteldarmdrüsen der Weinbergschnecken Phosphate in den Kropfsaft
sezernieren, die hier wahrscheinlich die Funktion von Puffersubstanzen übernehmen.
Leider ist die Titrierbarkeit dieser Puffer nicht besonders günstig. — Als großer Nachteil
erwies sich die geringe Breite, welche die einzelnen Puffergemische über streichen. Es
mußten also in einer Pufferreihe mehrere Puffersorten aneinandergehängt werden. Vor einiger
Zeit hat Michaelis (1931) den Az e t a t -Ve r on a l -Pu f f er zusammengestellt, welcher
das weite Gebiet von pH 2,62—9,64 umfaßt. Wenn sich die narkotische Wirkung des
Veronals auf das Verdauungsmaterial nicht als zu schädigend erweisen sollte, so dürfte
die Anwendung dieses Puffers für die Zukunft sehr zu empfehlen sein. Leider lernte ich
die Arbeit erst kennen, als meine Untersuchungen schon fast abgeschlossen waren. Neuerdings
benutzte ihn Bosen (1934) offenbar mit gutem Erfolge.
Da ich gezwungen war, mit dem frischen Enzymmaterial außerordentlich sparsam
umzugehen, beschränkte ich mich auf eine Beobachtungsbreite, welche den b i o l o g i s c h e n
Verhältnissen Kechnung trägt. Die extremsten Werte bewegten sich in den Grenzen von
pH 4,4—9,0. F ü r den Magensaft wurden aber diese Stufen nicht erreicht. Hier liegen die
Grenzen etwa zwischen pH 4,8—7,5. Die Pu f f e r s t u f en wurden so gewählt, daß ihre theoretischen
Werte um etwa 0,5 Puffereinheiten fortschritten. Das sind verhältnismäßig
kleine Intervalle, die während a l l e r Versuche mit Magensaft und Drüsenmaterial, für
a l l e Substrate festgehalten wurden, um auf diese Weise ein möglichst übersichtliches
Zahlenmaterial zu erhalten. Leider mußte aus Mangel an enzymhaltigem Material von
einer breiten Überschneidung der aneinanderstoßenden Pufferreihen verschiedener Puffergemische
in einzelnen Fällen abgesehen werden.
F ü r die Ei weiß Verdauungen sowohl wie fü r den Kohlehydratabbau wurde eine einheitliche
Numerierung der Pufferstufen durchgeführt. In den folgenden Tabellen entsprechen
den Nummern in der ersten Spalte den hier aufgeführten theoretischen Pufferwerten,
welche nach den Anweisungen von Sorensen und Clark und Lubs [vgl. Bona
(1926, S. 55—57)] ausgesucht wurden.
Nr. I. 0,1 MolGlyeocol! + 0,1 n NaCl + 0,ln NaOlI pH == 9,36
Nr. II. 0,1 „ ■ a o,i „ „ J 0,1„ „ pH == 8,93
Nr. III. 0,1 „ „ + 0,1,, „ + 0,1 ,, „ pH == 8,58
Oder:
Nr. I. 0,2 Mol Borsäure in 100 ccm n NaOH zum Liter1 ! 0,1 n NaOH pH == 9,50
Nr, II. 0,2 „ „ 100 „ „ ,, ,, ,, + 0,1 „ „ pH == 9,01
Nr. III. 0,2 „ „ 100 „ „ „ „ „ Q 0,1 „ „ pH == 8,51
Nr. IV. Vjr, Mol sek. Na2HPOi + Mol KH2PO4 pH = 8,04
Nr. V. m 1 I + '/l5 >1 PH -= 7,38
Nr. VI. H •> 1 „ + 1ll5 ,, ,, PH == 6,98
Nr. VII. n „ „ „ +l/lS „ „ pH -= 6,47
Nr. VIII. n „ i I + v ,, ,, PH == 5,91
Nr. IX. Mol Kaliurnbiphthalat V 3'ho Mol HCl pH == 5,60
Nr. X. n i + ’[h o „ „ pH == 5,20
Nr. XI. ■ „ Hl/io „ 1 pH == 4,80
F ü r den Stärke- und Saccharoseabbau wurde die B iphthalatreihe an beiden Enden um
je eine Pufferstufe verlängert, so daß sich die Numerierung wie folgt ändert:
Nr. IX. 710 Mol Kaliumbiphthalat + 7 10 Mol HCl pH = 6,0
Nr. X. Vjo „ „ + 7 10 „ „ pH = 5,6
Nr. X I. 710 „ „ + 7 10 „ „ pH = 5,2
Nr. X II. 7,0 „ „ + 7 10 „ „ pH = 4,8
Nr. X III. 7,0 „ „ + '7 10 „ „ pH = 4,4
Die Zahlen für die Mi s c h u n g s v e r h ä l t n i s s e d e r P u f f e r s u b s t a n z e n finden
sich in der aufgeführten Literatur, besonders bei Bona (1926, S. 55—57). Als Ausgangsmaterial
wurden die „Puffersubstanzen zu Enzymstudien nach SÖRENSEN“ der Firma
C. A. F. K ahlbaum, Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin benutzt. Den Biphthalatpuffer
stellte die Firma Dr. L aves, Hamburg, zusammen.
F ü r die größeren Versuchsreihen wurden die Pufferlösungen stets frisch angesetzt und
ihre pH-Werte zur Kontrolle v o r der Beimischung des Enzym- und Substratmaterials
bestimmt*).
Zum Schutze gegen Zersetzung durch Mikroorganismen bewahrte ich die Pufferlösungen
fest verschlossen im Eisschranke auf oder benutzte in seltneren Fällen einige
Körnchen Thymol als Antiseptikum.
Durch Hinzufügen von Magensaft oder Drüsenmaterial und gewisser Substrate zu den
Puffergemischen ändert sich der pH-Wert der letzteren. In der folgenden Übersicht findet
man die Durchschnittswerte dieser Abweichungen für die wichtigsten Pufferstufen angegeben.
Sinkt der pH-Wert durch das Hinzufügen des Enzym- und Substratmaterials zu
dem Puffergemisch gegenüber dem theoretischen pH-Werte ab, so ist die „Abweichung“
durch minus, steigt er, so ist sie durch plus gekennzeichnet. Die Mengen des zugefügten
Enzym- und Substratmaterials sowie die Puffermengen findet man in den Substrat-Abbau-
Tabellen.
Ü b e r s i c h t
über die durchschnittliche Änderung der pH-Werte von Puffern nach Zufügen von
Enzym- und Verdauungsmaterial.
Pufferart: Glycocoll-Puffer Borat-Puffer
Nr.: I. II. III. I. II. III.
Theoretischer pH-Wert: 9,36 8,93 8,58 9,50 9,01 8,51
Abweichungen: — 0,63 — 0,72 — 1,03 H o ,63 - -0,53 — 0,69
Anzahl der Ansätze: 2 2 2 3 3 3
Pufferart: Phosphat-Puff er
Nr.: IV. V. VI. VII. VIII.
Theoretischer pH-Wert: 8,04 7,38 6,98 6,47 5,91
Abweichungen: — 0,60 B L 27 B l , 23 H b , 20 H o ,17