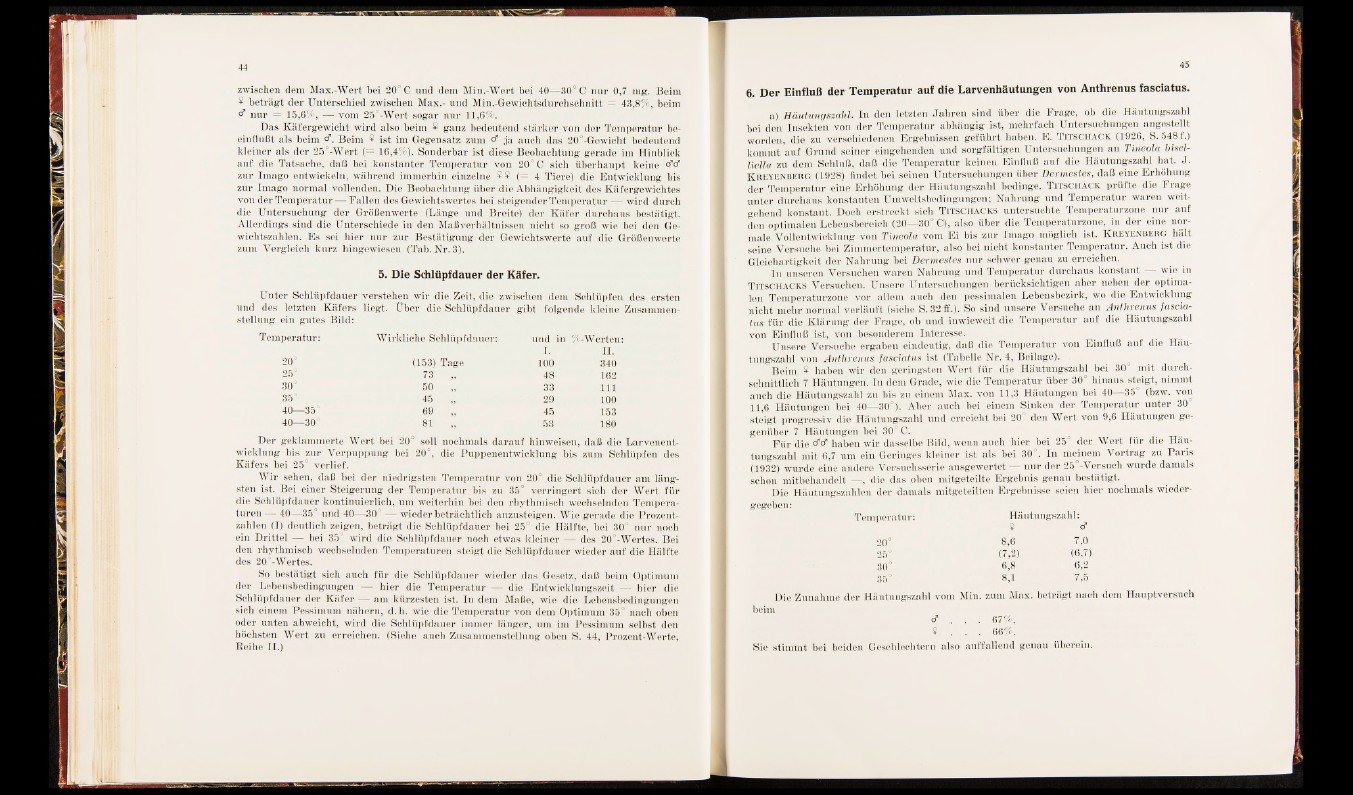
zwischen dem Max.-Wert bei 20° C und dem Min.-Wert bei 40—30° C nur 0,7 mg. Beim
2 beträgt der Unterschied zwischen Max.- und Min.-Gewichtsdurchschnitt = 43,8%, beim
d" nur = 15,6%, — vom 25°-Wert sogar nur 1 1 ,6%'.
Das Käfergewicht wird also beim 2 ganz bedeutend stärker von der Temperatur beeinflußt
als beim d1. Beim 2 ist im Gegensatz zum d1 ja auch das 20°-Gewicht bedeutend
kleiner als der 25°-Wert (= 16,4%). Sonderbar ist diese Beobachtung gerade im Hinblick
auf die Tatsache, daß bei konstanter Temperatur von 20° C sich überhaupt keine dV
zur Imago entwickeln, während immerhin einzelne 22 ( = 4 Tiere) die Entwicklung bis
zur Imago normal vollenden. Die Beobachtung über die Abhängigkeit des Käfergewichtes
von der Temperatur — Fallen des Gewichtswertes bei steigender Temperatur — wird durch
die Untersuchung der Größenwerte (Länge und Breite) der Käfer durchaus bestätigt.
Allerdings sind die Unterschiede in den Maß Verhältnissen nicht so groß wie bei den Gewichtszahlen.
Es sei hier nur zur Bestätigung der Gewichtswerte auf die Größenwerte
zum Vergleich kurz hingewiesen (Tab. Nr. 3).
5. Die Sdilüpfdauer der Käfer.
Unter Schlüpfdauer verstehen wir die Zeit, die zwischen dem Schlüpfen des ersten
und des letzten Käfers liegt. Über die Schlüpfdauer gibt folgende kleine Zusammenstellung
ein gutes Bild:
Temperatur: Wirkliche Schlüpfdauer: und in %-Werten
I. II.
20° (153) Tage 100 340
25° 73 48 162
30° 50 33 1 11
35° 45 „ 29 100
40—35° 69 45 153
oCO
o
81 53 180
Der geklammerte Wert bei 20° soll nochmals darauf hinweisen, daß die Larvenentwicklung
bis zur Verpuppung bei 20°, die Puppenentwicklung bis zum Schlüpfen des
Käfers bei 25° verlief.
Wir sehen, daß bei der niedrigsten Temperatur von 20° die Schlüpfdauer am längsten
ist. Bei einer Steigerung der Temperatur bis zu 35° verringert sich der Wert für
die Schlüpfdauer kontinuierlich, um weiterhin bei den rhythmisch wechselnden Temperatu
re n— 40—35° und 40—30° — wieder beträchtlich anzusteigen. Wie gerade die Prozentzahlen
(I) deutlich zeigen, beträgt die Schlüpfdauer bei 25° die Hälfte, bei 30° nur noch
ein D ritte lE - bei 35° wird die Schlüpfdauer noch etwas kleiner — des 20°-Wertes. Bei
den rhythmisch wechselnden Temperaturen steigt die Schlüpfdauer wieder auf die Hälfte
des 20°-Wertes.
So bestätigt sich auch für die Schlüpfdauer wieder das Gesetz, daß beim Optimum
der Lebensbedingungen — hier die Temperatur — die Entwicklungszeit I S | hier die
Schlüpfdauer der Käfer — am kürzesten ist. In dem Maße, wie die Lebensbedingungen
sich einem Pessimum nähern, d.h. wie die Temperatur von dem Optimum 35° nach oben
oder unten abweicht, wird die Schlüpfdauer immer länger, um im Pessimum selbst den
höchsten Wert zu erreichen. (Siehe auch Zusammenstellung oben S. 44, Prozent-Werte,
Reihe II.)
6. Der Einfluß der Temperatur auf die Larvenhäutungen von Anthrenus fasciatus.
a) Häutungszahl. In den letzten Jah ren sind über die Frage, ob die Häutungszahl
bei den Insekten von der Temperatur abhängig ist, mehrfach Untersuchungen angestellt
worden, die zu verschiedenen Ergebnissen geführt haben. E. TlTSCHACK (1926, S. 548 f.)
kommt auf Grund seiner eingehenden und sorgfältigen Untersuchungen an Tineola bisel-
liella zu dem Schluß, daß die Temperatur keinen Einfluß auf die Häutnngszahl hat. J.
K reyenberg (1928), findet bei seinen-Untersuchungen über Dermestes, daß eine Erhöhung
der Temperatur eine Erhöhung der Häutungszahl bedinge. TlTSCHACK prüfte die Frage
unter durchaus konstanten Umweltsbedingungen; Nahrung Und Temperatur waren weitgehend
konstant. Doch erstreckt sich TlTSCHACKS untersuchte Temperaturzone nur auf
den optimalen Lebensbereich (20—30° G), also über die Temperaturzone, in der eine normale
Vollentwieklung von Tineola vom Ei bis, zur Imago möglich isfcsKRETENBEBG hält
Seine Versuche bei Zimmertemperatur, also, bei nicht konstanter Temperatur. Auch ist die
Gleichartigkeit dgS Nahrung bei Dermestes nur schwer genau zu erreichen.
In unseren Versuchen waren Nahrung und Temperatur durchaus konstant wie in
Titschacks Versuchen. Unsere Untersuchungen berücksichtigen aber neben der optimalen
Temperaturzone vor allem auch den pessimalen Lebensbezirk, wo die Entwicklung
nicht mehr normal verläuft (siehe S. 82 ff.). So sind unsere Versuche an Anthrenus fascia-
lusi für die Klärung der Frage, ob und inwieweit die Temperatur auf die Häutungszahl
von Einfluß ist, u B besonderem Interesse.
Unsere Versuche ergaben eindeutig, daß die Temperatur von Einfluß auf die Häutungszahl
von Anthrenus fasciatus ist (Tabelle Nr. 4, Beilage).
Beim,® haben wir den geringsten Wert für die Häutungszahl bei 30° mit durchschnittlich
7 Häutungen. In dem Grade, wie die SlMperatur über 30° hinaus steigt, nimmt
auch die Häutungszahl zu bis zu einem Max. von 11,3 Häutungen bei 40—35° (bzw. von
11,6 Häutungen hei 40—30°). Aber auch bef einem Sinken der Temperatur unter 30°
steigt progressiv die Häutungszahl und erreicht bei 20° den Wert von 9,6 Häutungen gegenüber
7 Häutungen bei 30° C.
F ü r die d’cf haben wir dasselbe Bild, wenn auch hier bei 25 der Wert für die Häutungszahl
mit 6,7 um ein Geringes kleiner ist als bei 30°. In meinem Vortrag zu Paris
(1932) wurde eine andere Versuchsserie ausgewertet — nur der 25 -Versuch wurde damals
Schon mitbehandelBM die das oben mitgeteilte Ergebnis genau bestätigt.
Die Häutungszahlen der damals mitgeteilten Ergebnisse seien hier nochmals wiedergegeben:
Temperatur: Häutungszahl:
I g i : ^
20° 8,6 7,0
25° ' (7,2) (6,7)
30° 6,8 6,2
35 ' I ' 7,5
Die Zunahme der Häutungszahl vom Min. zum Max. beträgt nach dem Hauptversuch
beim
cf . . . 67%, •
Sie stimmt hei beiden Geschlechtern also auffallend genau überein.