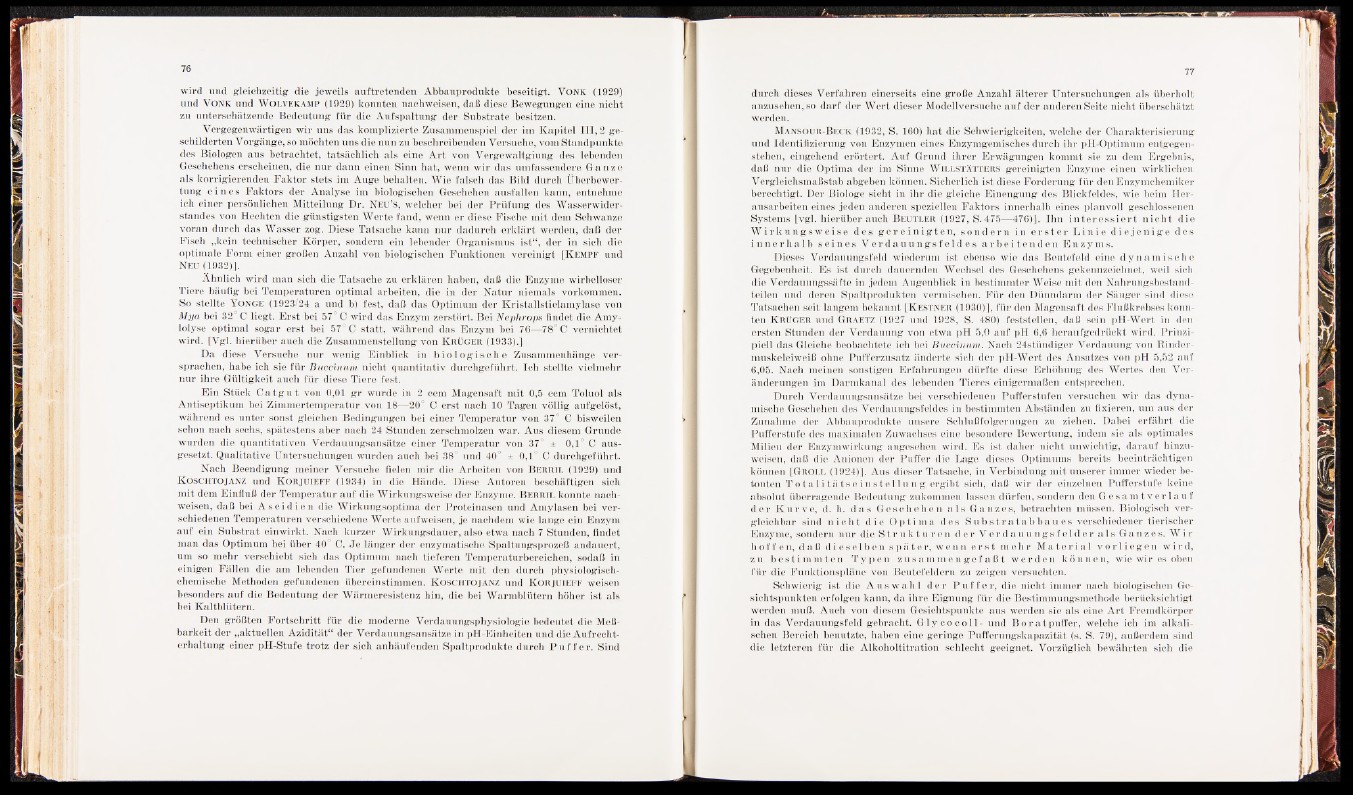
wird und gleichzeitig die jeweils auftretenden Abbauprodukte beseitigt. Vonk (1929)
und Vonk und Wolvekamp (1929) konnten nachweisen, daß diese Bewegungen eine nicht
zu unterschätzende Bedeutung für die Aufspaltung der Substrate besitzen.
Vergegenwärtigen wir uns das komplizierte Zusammenspiel der im Kapitel 111,2 geschilderten
Vorgänge, so möchten uns die nun zu beschreibenden Versuche, vom Standpunkte
des Biologen aus betrachtet, tatsächlich als eine Art von Vergewaltgiung des lebenden
Geschehens erscheinen, die nur dann einen Sinn hat, wenn wir das umfassendere Ga nz e
als korrigierenden Faktor stets im Auge behalten. Wie falsch das Bild durch Überbewertung
e i n e s Faktors der Analyse im biologischen Geschehen ausfallen kann, entnehme
ich einer persönlichen Mitteilung Dr. Neu’s, welcher bei der Prüfung des Wasserwiderstandes
von Hechten die günstigsten Werte fand, wenn er diese Fische mit dem Schwänze
voran durch das Wasser zog. Diese Tatsache kann nur dadurch erklärt werden, daß der
Fisch „kein technischer Körper, sondern ein lebender Organismus ist“ , der in sich die
optimale Form einer großen Anzahl von biologischen Funktionen verein igt [Kempf und
Neu (1932)].
Ähnlich wird man sich die Tatsache zu erklären haben, daß die Enzyme wirbelloser
Tiere häufig bei Temperaturen optimal arbeiten, die in der Natur niemals Vorkommen.
So stellte Yonge (1923/24 a und b) fest, daß das Optimum der Kristallstielamylase von
Mya bei 32° C liegt. E rst bei 57° C wird das Enzym zerstört. Bei Nephrops findet die Amy-
lolyse optimal sogar erst bei 57° C statt, während das Enzym bei 76—78° C vernichtet
wird. [Vgl. hierüber auch die Zusammenstellung von K rüger (1933).]
Da diese Versuche nur wenig Einblick in b i o l o g i s c h e Zusammenhänge versprachen,
habe ich sie für Buccinum nicht quantitativ durchgeführt. Ich stellte vielmehr
nur ihre Gültigkeit auch für diese Tiere fest.
Ein Stück C a t g u t von 0,01 gr wurde in 2 ccm Magensaft mit 0,5 ccm Toluol als
Antiseptikum bei Zimmertemperatur von 18—20° C erst nach 10 Tagen völlig aufgelöst,
während es unter sonst gleichen Bedingungen bei einer Temperatur von 37° C bisweilen
schon nach sechs, spätestens aber nach 24 Stunden zerschmolzen war. Aus diesem Grunde
wurden die quantitativen Verdauungsansätze einer Temperatur von 37° ± 0,1° C ausgesetzt.
Qualitative Untersuchungen wurden auch bei 38° und 40° ± 0,1° C durchgeführt.
Nach Beendigung meiner Versuche fielen mir die Arbeiten von Berril (1929) und
K oschtojanz und K orjuieff (1934) in die Hände. Diese Autoren beschäftigen sich
mit dem Einfluß der Temperatur auf die Wirkungsweise der Enzyme. Berril konnte nachweisen,
daß bei As c i d i e n die Wirkungsoptima der Proteinasen und Amylasen bei verschiedenen
Temperaturen verschiedene Werte auf weisen, je nachdem wie lange ein Enzym
auf ein Substrat ein wirkt. Nach kurzer Wirkungsdauer, also etwa nach 7 Stunden, findet
man das Optimum bei über 40° C. J e länger der enzymatische Spaltungsprozeß andauert,
um so mehr verschiebt sich das Optimum nach tieferen Temperaturbereichen, sodaß in
einigen Fällen die am lebenden Tier gefundenen Werte mit den durch physiologischchemische
Methoden gefundenen überein stimmen. K oschtojanz und K orjuieff weisen
besonders auf die Bedeutung der Wärmeresistenz hin, die bei Warmblütern höher ist als
bei Kaltblütern.
Den größten Fortschritt für die moderne Verdauungsphysiologie bedeutet die Meßbarkeit
der „aktuellen Azidität“ der Verdauungsansätze in pH-Einheiten und die Aufrechterhaltung
einer pH-Stufe trotz der sich anhäufenden Spaltprodukte durch P u f f e r . Sind
durch dieses Verfahren einerseits eine große Anzahl älterer Untersuchungen als überholt
anzusehen, so darf der Wert dieser Modellversuche auf der anderen Seite nicht überschätzt
werden.
Mansour-Beck (1932, S. 160) h a t die Schwierigkeiten, welche der Charakterisierung
und Identifizierung von Enzymen eines Enzymgemisches durch ihr pH-Optimum entgegenstehen,
eingehend erörtert. Auf Grund ihrer Erwägungen kommt sie zu dem Ergebnis,
daß nur die Optima der im Sinne WlLLSTÄTTERS gereinigten Enzyme einen wirklichen
Vergleichsmaßstab abgeben können. Sicherlich ist diese Forderung für den Enzymchemiker
berechtigt. Der Biologe sieht in ihr die gleiche Einengung des Blickfeldes, wie beim Herausarbeiten
eines jeden anderen speziellen Faktors innerhalb eines planvoll geschlossenen
Systems [vgl. hierüber auch Beutler (1927, S. 475—476)]. Ihn i nt e r e s s i e r t ni cht die
Wi r k u n g s w e i s e des g e r e i n i g t e n , s o n d e r n in e r s t e r L i n i e d i e j e n i g e des
i n n e r h a l b s e i n e s V e r d a u u n g s f e l d e s a r b e i t e n d e n E n z yms .
Dieses Verdauungsfeld wiederum ist ebenso wie das Beutefeld eine d y n ami s c h e
Gegebenheit. Es ist durch dauernden Wechsel des Geschehens gekennzeichnet, weil sich
die Verdauungssäfte in jedem Augenblick in bestimmter Weise mit den Nahrungsbestandteilen
und deren Spaltprodukten vermischen. F ü r den Dünndarm der Säuger sind diese
Tatsachen seit langem bekannt [Kestner (1930)], für den Magensaft des Flußkrebses konnten
K rüger und Graetz (1927 und 1928, S. 480) feststellen, daß sein pH-Wert in den
ersten Stunden der Verdauung von etwa pH 5,0 auf pH 6,6 heraufgedrückt wird. Prinzipiell
das Gleiche beobachtete ich bei Buccinum. Nach 24stündiger Verdauung von Rindermuskeleiweiß
ohne Pufferzusatz änderte sich der pH-Wert des Ansatzes von pH 5,52 auf
6,05. Nach meinen sonstigen Erfahrungen dürfte diese Erhöhung des Wertes den Veränderungen
im Darmkanal des lebenden Tieres einigermaßen entsprechen.
Durch Verdauungsansätze bei verschiedenen Pufferstufen versuchen wir das dynamische
Geschehen des Verdauungsfeldes in bestimmten Abständen zu fixieren, um aus der
Zunahme der Abbauprodukte unsere Schlußfolgerungen zu ziehen. Dabei erfährt die
Pufferstufe des maximalen Zuwachses eine besondere Bewertung, indem sie als optimales
Milieu der Enzym Wirkung angesehen wird. Es ist daher nicht unwichtig, darauf hinzuweisen,
daß die Anionen der Puffer die Lage dieses Optimums bereits beeinträchtigen
können [Groll (1924)]. Aus dieser Tatsache, in Verbindung mit unserer immer wieder betonten
T o t a l i t ä t s e i n s t e l l u n g ergibt sich, daß wir der einzelnen Pufferstufe keine
absolut überragende Bedeutung zukommen lassen dürfen, sondern den G e s am t v e r l a u f
d e r Kur v e , d. h. d a s G e s c h e h e n a l s Ganze s , betrachten müssen. Biologisch vergleichbar
sind n i c h t di e Op t i m a des S u b s t r a t a b b a u e s verschiedener tierischer
Enzyme, sondern nur die S t r u k t u r e n d e r V e r d a u u n g s f e l d e r al s Ganz e s . Wi r
h of f en, d a ß d i e s e l b e n s p ä t e r , w e nn e r s t m e h r Ma t e r i a l v o r l i e g e n wi rd,
zu b e s t i mmt e n T y p e n z u s am m e n g e f a ß t we r d e n könne n, wie wir es oben
für die Funktionspläne von Beutefeldern zu zeigen versuchten.
Schwierig ist die A u sw a h l d e r P u f f e r , die nicht immer nach biologischen Gesichtspunkten
erfolgen kann, da ihre Eignung für die Bestimmungsmethode berücksichtigt
werden muß. Auch von diesem Gesichtspunkte aus werden sie als eine Art Fremdkörper
in das Verdauungsfeld gebracht. G l y c o c o l l - und Boratpuf fer , welche ich im alkalischen
Bereich benutzte, haben eine geringe Pufferungskapazität (s. S. 79), außerdem sind
die letzteren für die Alkoholtitration schlecht geeignet. Vorzüglich bewährten sich die