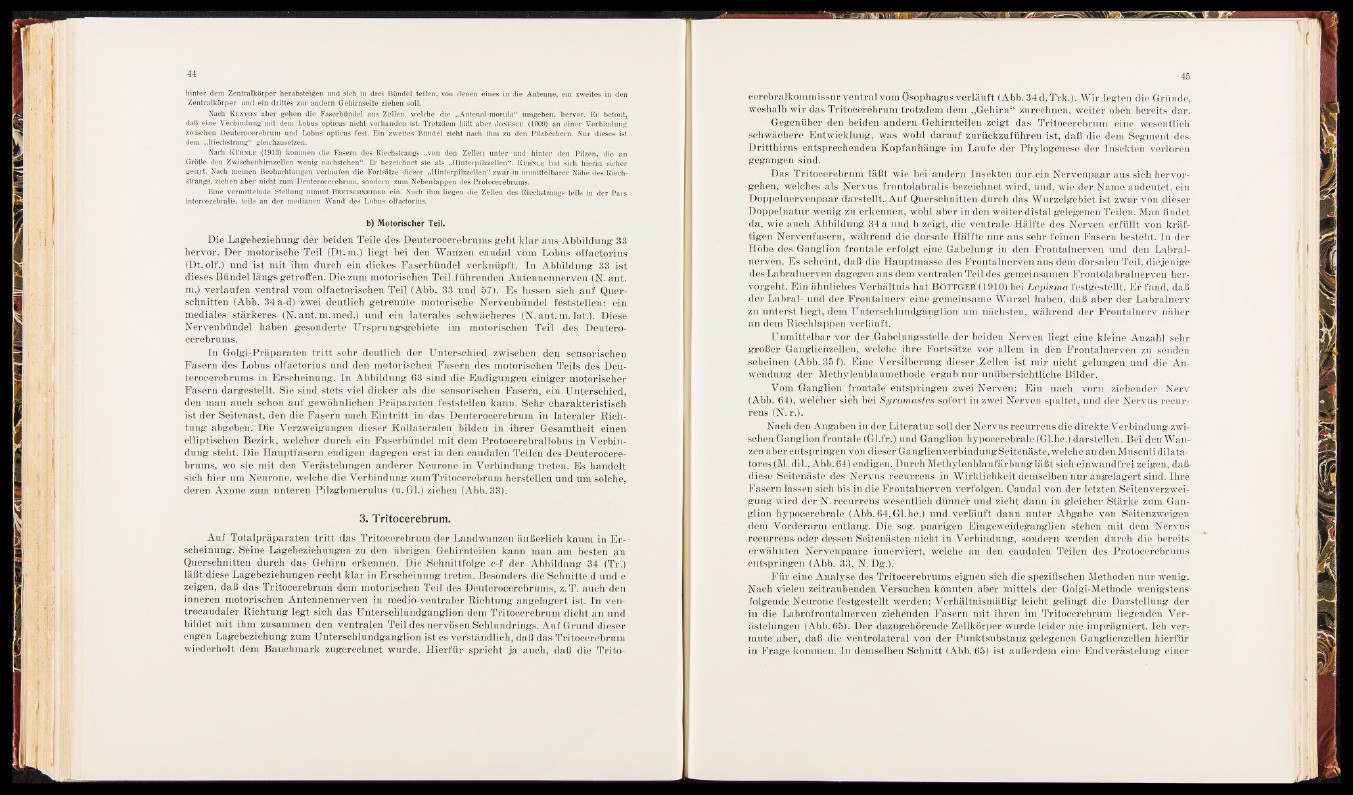
hinter dem Zentralkörper herabsteigen und sich in drei Bündel teilen, von denen eines in die Antenne, ein zweites in den
Zentralkörper und ein drittes zur ändern Gehirnseite ziehen soll.
Nach K e n y o n aber gehen die Fäserbündel aus Zellen, welche die „Antenal-morula“ umgeben, hervor. Er betont,
daß eine Verbindung mit dem Lobus opticus nicht vorhanden ist. Trotzdem hält aber J o n e s c u (1909) an einer Verbindung
zwischen Deuterocerebrum und Lobus opticus fest. Ein zweites Bündel zieht nach ihm zu den Pilzbechern. Nur dieses ist
dem „Riechstrang“ gleichzusetzen.
Nach K ü h n l e (1913) kommen die Fasern des Riechstrangs „von den Zellen unter und hinter den Pilzen, die an
Größe den Zwischenhirnzellen wenig nachstehen“. Er bezeichnet sie als „Hinterpilzzellen“. K ü h n l e hat sich hierin sicher
geirrt. Nach meinen Beobachtungen verlaufen die Fortsätze dieser „Hinterpilzzellen“ zwar in Unmittelbarer Nähe des Riechstrangs,
ziehen aber nicht zum Deuterocerebrum, sondern zum Nebenlappen des Protocerebrums.
Eine vermittelnde Stellung nimmt B r e t s c h n e id e r ein. Nach ihm liegen die Zellen des Riechstrangs teils in der Pars
intercerebralis, teils an der medianen Wand des Lobus olfactorius.
b) Motorischer Teil.
Die Lagebeziehung der beiden Teile des Deuterocerebrums gebt klar aus Abbildung 33
hervor. Der motorische Teil (Dt. m.) liegt bei den Wanzen caudal vom Lobus olfactorius
(Dt. olf.) und ist mit ihm durch ein dickes Faserbündel verknüpft. In Abbildung 33 ist
dieses Bündel längs getroffen. Die zum motorischen Teil führenden Antennennerven (N. ant.
m.) verlaufen ventral vom olfactorischen Teil (Abb. 33 und 57). Es lassen sich auf Querschnitten
(Abb. 34a-d) zwei deutlich getrennte motorische Nervenbündel feststellen: ein
mediales stärkeres (N. ant. m. med.) und ein laterales schwächeres (N. ant. m. lat.). Diese
Nervenbündel haben gesonderte Ursprungsgebiete im motorischen Teil des Deuterocerebrums.
In Golgi-Präparaten tritt sehr deutlich der Unterschied zwischen den sensorischen
Fasern des Lobus olfactorius und den motorischen Fasern des motorischen Teils des Deuterocerebrums
in Erscheinung. In Abbildung 63 sind die Endigungen einiger motorischer
Fasern dargestellt. Sie sind stets viel dicker als die sensorischen Fasern, ein Unterschied,
den man auch schon auf gewöhnlichen Präparaten feststellen kann. Sehr charakteristisch
ist der Seitenast, den die Fasern nach E in tritt in das Deuterocerebrum in lateraler Richtung
abgeben. Die Verzweigungen dieser Kollateralen bilden in ihrer Gesamtheit einen
elliptischen Bezirk, welcher durch ein Faserbündel mit dem Protocerebrallobus in Verbindung
steht. Die Hauptfasern endigen dagegen erst in den caudalen Teilen des Deuterocerebrums,
wo sie mit den Verästelungen anderer Neurone in Verbindung treten. Es handelt
sich hier um Neurone, welche die Verbindung zumTritocerebrum hersteilen und um solche,
deren Axone zum unteren Pilzglomerulus (u. Gl.) ziehen (Abb. 33).
3. Tritocerebrum.
Auf Totalpräparaten tritt das Tritocerebrum der Landwanzen äußerlich kaum in E rscheinung.
Seine Lagebeziehungen zu den übrigen Gehirnteilen kann man am besten an
Querschnitten durch das Gehirn erkennen. Die Schnittfolge c-f der Abbildung 34 (Tr.)
läßt diese Lagebeziehungen recht klar in Erscheinung treten. Besonders die Schnitte d und e
zeigen, daß das Tritocerebrum dem motorischen Teil des Deuterocerebrums, z. T. auch den
inneren motorischen Antennennerven in medio-ventraler Richtung angelagert ist. In ven-
trocaudaler Richtung legt sich das Unterschlundganglion dem Tritocerebrum dicht an und
bildet mit ihm zusammen den ventralen Teil des nervösen Schlundrings. Auf Grund dieser
engen Lagebeziehung zum Unterschlundganglion ist es verständlich, daß das Tritocerebrum
wiederholt dem Bauchmark zugerechnet wurde. Hierfür spricht ja auch, daß die Tritocerebralkommissur
ventral vom Ösophagus verlauft (Abb. 34d,Trk.). Wir legten die Gründe,
weshalb wir das Tritocerebrum trotzdem dem „Gehirn“ zurechnen, weiter oben bereits dar.
Gegenüber den beiden ändern Gehirnteilen zeigt das Tritocerebrum eine wesentlich
schwächere Entwicklung, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß die dem Segment des
Dritthirns entsprechenden Kopfanhänge im Laufe der Phylogenese der Insekten verloren
gegangen sind.
Das Tritocerebrum läßt wie bei ändern Insekten nur ein N ervenpaar aus sich hervorgehen,
welches als Nervus frontolabralis bezeichnet wird, und, wie der Name andeutet, ein
Doppelnervenpaar darstellt. Auf Querschnitten durch das Wurzelgebiet ist zwar von dieser
Doppelnatur wenig zu erkennen, wohl aber in den weiter distal gelegenen Teilen. Man findet
da, wie auch Abbildung 34 a und b zeigt, die ventrale Hälfte des Nerven erfüllt von krä ftigen
Nervenfasern, während die dorsale Hälfte nur aus sehr feinen Fasern besteht. In der
Höhe des Ganglion frontale erfolgt eine Gabelung in den Frontalnerven und den Labrainerven.
Es scheint, daß die Hauptmasse des Frontalnerven aus dem dorsalen Teil, diejenige
des Labrainerven dagegen aus dem ventralen Teil des gemeinsamen Frontolabralnerven hervorgeht.
Ein ähnliches Verhältnis hat B ö t t g e r (1910) bei Lepisma festgestellt. E r fand, daß
der Labral- und der Frontalnerv eine gemeinsame Wurzel haben, daß aber der Labralnerv
zu unterst liegt, dem Unterschlundganglion am nächsten, während der Frontalnerv näher
an dem Riechlappen verläuft.
Unmittelbar vor der Gabelungsstelle der beiden Nerven liegt eine kleine Anzahl sehr
großer Ganglienzellen, welche ihre Fortsätze vor allem in den Frontalnerven zu senden
scheinen (Abb. 35 f). Eine Versilberung dieser Zellen ist mir nicht gelungen und die Anwendung
der Methylenblaumethode ergab nur unübersichtliche Bilder.
Vom Ganglion frontale entspringen zwei Nerven: Ein nach vorn ziehender Nerv
(Abb. 64), welcher sich bei Syromastes sofort in zwei Nerven spaltet, und der Nervus recurrens
(N. r.).
Nach den Angaben in der L iteratur soll der Nervus recurrens die direkte Verbindung zwischen
Ganglion frontale (Gl.fr.) und Ganglion hypocerebrale (Gl.hc.) darstellen. Bei den Wanzen
aber entspringen von dieser GanglienverbindungSeitenäste, welche an den Musculidilata-
tores (M. dil., Abb. 64) endigen. Durch Methylenblaufärbung läßt sich einwandfrei zeigen, daß
diese Seitenäste des Nervus recurrens in Wirklichkeit demselben nur angelagert sind. Ihre
Fasern lassen sich bis in die Frontalnerven verfolgen. Caudal von der letzten Seitenverzweigung
wird der N. recurrens wesentlich dünner und zieht dann in gleicher Stärke zum Ganglion
hypocerebrale (Abb. 64, Gl.hc.) und verläuft dann unter Abgabe von Seitenzweigen
dem Vorderarm entlang. Die sog. paarigen Eingeweideganglien stehen mit dem Nervus
recurrens oder dessen Seitenästen nicht in Verbindung, sondern werden durch die bereits
erwähnten Nervenpaare innerviert, welche an den caudalen Teilen des Protocerebrums
entspringen (Abb. 33, N. Dg.).
Für eine Analyse des Tritocerebrums eignen sich die spezifischen Methoden nur wenig.
Nach vielen zeitraubenden Versuchen konnten aber mittels der Golgi-Methode wenigstens
folgende Neurone festgestellt werden: Verhältnismäßig leicht gelingt die Darstellung der
in die Labrofrontalnerven ziehenden Fasern mit ihren im Tritocerebrum liegenden Verästelungen
(Abb. 65). Der dazugehörende Zellkörper wurde leider nie imprägniert. Ich vermute
aber, daß die ventrolateral von der Punktsubstanz gelegenen Ganglienzellen hierfür
in Frage kommen. In demselben Schnitt (Abb. 65) ist außerdem eine Endverästelung einer