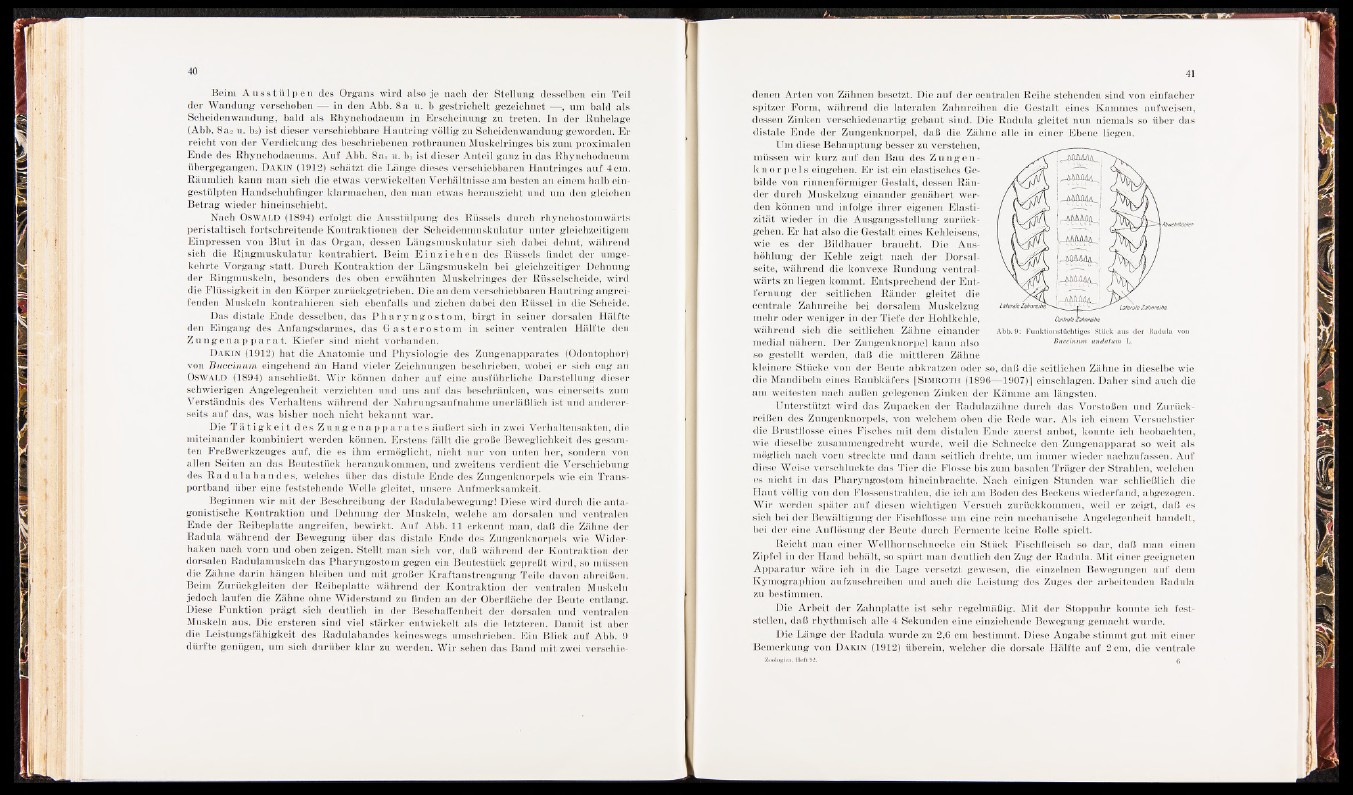
Beim A u s s t ü l p e n des Organs wird also je nach der Stellung desselben ein Teil
der Wandung verschoben — in den Abb. 8 a u. b gestrichelt gezeichnet—, um bald als
Scbeidenwandung, bald als Bhynchodaeum in Erscheinung zu treten. In der Buhelage
(Abb. 8a2 u. b2) ist dieser verschiebbare Hautring völlig zu Scheidenwandung geworden. Er
reicht von der Verdickung des beschriebenen rotbraunen Muskelringes bis zum proximalen
Ende des Khynchodaeums. Auf Abb. 8ai u. bi ist dieser Anteil ganz in das Bhynchodaeum
übergegangen. Dakin (1912) schätzt die Länge dieses verschiebbaren Hautringes auf 4 cm.
Bäumlich kann man sich die etwas verwickelten Verhältnisse am besten an einem halb eingestülpten
Handschuhfinger klarmachen, den man etwas herauszieht und um den gleichen
Betrag wieder hineinschiebt.
Nach Oswald (1894) erfolgt die Ausstülpung des Biissels durch rhynchostomwärts
peristaltisch fortschreitende Kontraktionen der Scheidenmuskulatur unter gleichzeitigem
Einpressen von Blut in das Organ, dessen Längsmuskulatur sich dabei dehnt, während
sich die Bingmuskulatur kontrahiert. Beim E i n z i e h e n des Büssels findet der umgekehrte
Vorgang statt. Durch Kontraktion der Längsmuskeln bei gleichzeitiger Dehnung
der Bingmuskeln, besonders des oben erwähnten Muskelringes der Biisselscheide, wird
die Flüssigkeit in den Körper zurückgetrieben. Die an dem verschiebbaren H autring angreifenden
Muskeln kontrahieren sich ebenfalls und ziehen dabei den Küssel in die Scheide.
Das distale Ende desselben, das P h a r y n g o s t om, birgt in seiner dorsalen Hälfte
den Eingang des Anfangsdarmes, das G a s t e r o s t o m in seiner ventralen Hälfte den
Z u n g e n a p p a r a t . Kiefer sind nicht vorhanden.
Dakin (1912) hat die Anatomie und Physiologie des Zungenapparates (Odontophor)
von Buccinum eingehend an Hand vieler Zeichnungen beschrieben, wobei er sich eng an
Oswald (1894) anschließt. Wir können daher auf eine ausführliche Darstellung dieser
schwierigen Angelegenheit verzichten und uns auf das beschränken, was einerseits zum
Verständnis des Verhaltens während der Nahrungsaufnahme unerläßlich ist und andererseits
auf das, was bisher noch nicht bekannt war.
Die T ä t i g k e i t des Z u n g e n a p p a r a t e s äußert sich in zwei Verhaltensakten, die
miteinander kombiniert werden können. Erstens fällt die große Beweglichkeit des gesamten
Freßwerkzeuges auf, die es ihm ermöglicht, nicht nur von unten her, sondern von
allen Seiten an das Beutestück heranzukommen, und zweitens verdient die Verschiebung
des B a d u l a b a n d e s , welches über das distale Ende des Zungenknorpels wie ein Transportband
über eine feststehende Welle gleitet, unsere Aufmerksamkeit.
Beginnen wir mit der Beschreibung der Badulabewegung! Diese wird durch die antagonistische
Kontraktion und Dehnung der Muskeln, welche am dorsalen und ventralen
Ende der Beibeplatte angreifen, bewirkt. Auf Abb. 11 erkennt man, daß die Zähne der
Badula während der Bewegung über das distale Ende des Zungenknorpels wie Widerhaken
nach vorn und oben zeigen. Stellt man sich vor, daß während der Kontraktion der
dorsalen Badulamuskeln das Pharyngostom gegen ein Beutestück gepreßt wird, so müssen
die Zähne darin hängen bleiben und mit großer Kraftanstrengung Teile davon abreißen.
Beim Zurückgleiten der Beibeplatte während der Kontraktion der ventralen Muskeln
jedoch laufen die Zähne ohne Widerstand zu finden an der Oberfläche der Beute entlang.
Diese Funktion prägt sich deutlich in der Beschaffenheit der dorsalen und ventralen
Muskeln aus. Die ersteren sind viel stärker entwickelt als die letzteren. Damit ist aber
die Leistungsfähigkeit des Badulabandes keineswegs umschrieben. Ein Blick auf Abb. 9
dürfte genügen, um sich darüber klar zu werden. Wir sehen das Band mit zwei verschiedenen
Arten von Zähnen besetzt. Die auf der centralen Beihe stehenden sind von einfacher
spitzer Form, während die lateralen Zahnreihen die Gestalt eines Kammes aufweisen,
dessen Zinken verschiedenartig gebaut sind. Die Badula gleitet nun niemals so über das
distale Ende der Zungenknorpel, daß die Zähne alle in einer Ebene liegen.
Um diese B ehauptung besser zu verstehen,
müssen wir kurz auf den Bau des Z u n g e n k
n o r p e l s eingehen. E r ist ein elastisches Gebilde
von rinnenförmiger Gestalt, dessen Bänder
durch Muskelzug einander genähert werden
können und infolge ihrer eigenen Elastizität
wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen.
E r hat also die Gestalt eines Kehleisens,
wie es der Bildhauer braucht. Die Aushöhlung
der Kehle zeigt nach der Dorsalseite,
während die konvexe Bundung ventral-
wärts zu liegen kommt. Entsprechend der Entfernung
der seitlichen Bänder gleitet die
centrale Zahnreihe bei dorsalem Muskelzug
mehr oder weniger in der Tiefe der Hohlkehle,
während sich die seitlichen Zähne einander
medial nähern. Der Zungenknorpel kann also
so gestellt werden, daß die mittleren Zähne
kleinere Stücke von der Beute abkratzen oder so, daß die seitlichen Zähne in dieselbe wie
die Mandibeln eines Baubkäfers [Simroth (1896—1907)] einschlagen. Daher sind auch die
am weitesten nach außen gelegenen Zinken der Kämme am längsten.
Unterstützt wird das Zupacken der Badulazähne durch das Vorstoßen und Zurückreißen
des Zungenknorpels, von welchem oben die Bede war. Als ich einem Versuchstier
die Brustflosse eines Fisches mit dem distalen Ende zuerst anbot, konnte ich beobachten,
wie dieselbe zusammengedreht wurde, weil die Schnecke den Zungenapparat so weit als
möglich nach vorn streckte und dann seitlich drehte, um immer wieder nachzufassen. Auf
diese Weise verschluckte das Tier die Flosse bis zum basalen T räger der Strahlen, welchen
es nicht in das Pharyngostom hineinbrachte. Nach einigen Stunden war schließlich die
Haut völlig von den Flossenstrahlen, die ich am Boden des Beckens wiederfand, abgezogen.
Wir werden später auf diesen wichtigen Versuch zurückkommen, weil er zeigt, daß es
sich bei der Bewältigung der Fischflosse um eine rein mechanische Angelegenheit handelt,
bei der eine Auflösung der Beute durch Fermente keine Bolle spielt.
Beicht man einer Wellhornschnecke ein Stück Fischfleisch so dar, daß man einen
Zipfel in der Hand behält, so spürt man deutlich den Zug der Badula. Mit einer geeigneten
Apparatur wäre ich in die Lage versetzt gewesen, die einzelnen Bewegungen auf dem
Kymographion aufzuschreiben und auch die Leistung des Zuges der arbeitenden Badula
zu bestimmen.
Die Arbeit der Zahnplatte ist sehr regelmäßig. Mit der Stoppuhr konnte ich feststellen,
daß rhythmisch alle 4 Sekunden eine einziehende Bewegung gemacht wurde.
Die Länge der Badula wurde zu 2,6 cm bestimmt. Diese Angabe stimmt gut mit einer
Bemerkung von Dakin (1912) überein, welcher die dorsale Hälfte auf 2 cm, die ventrale