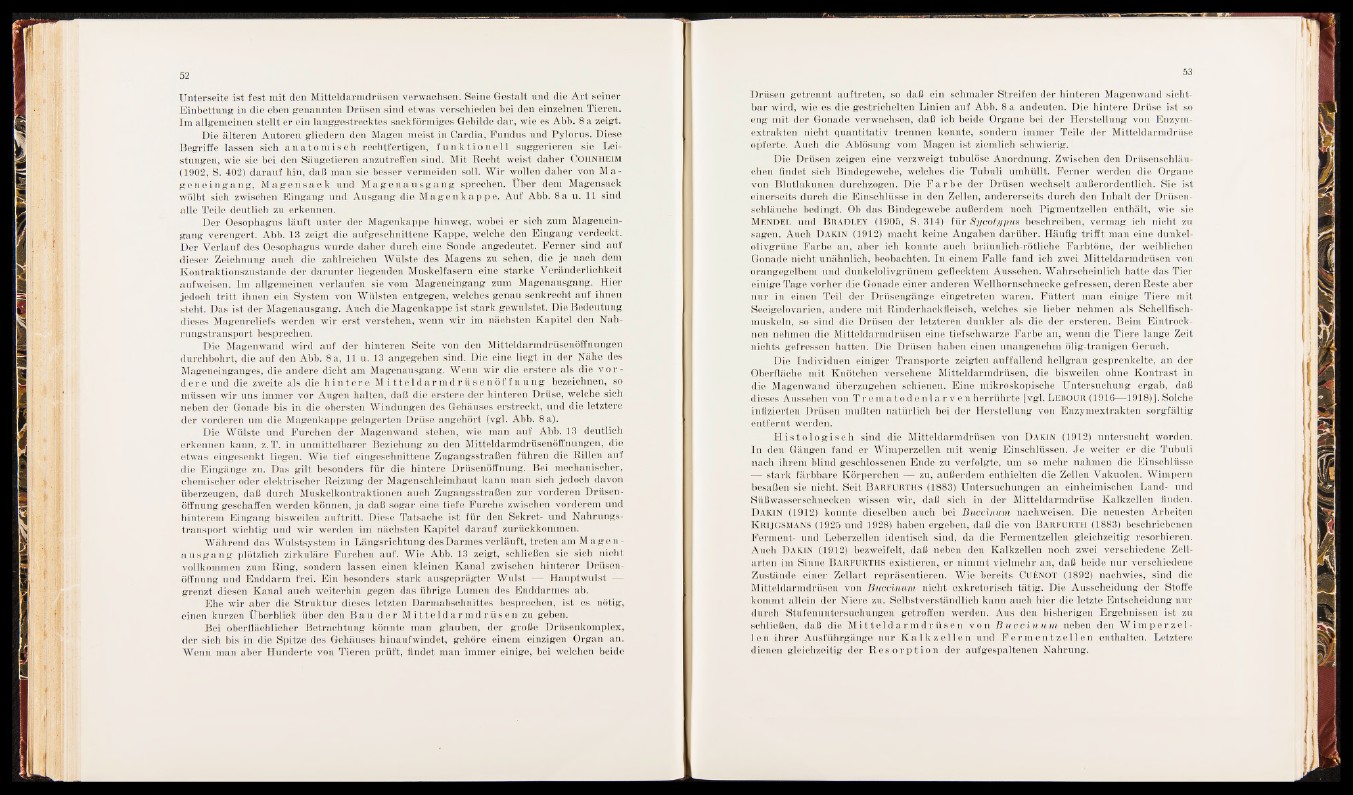
Unterseite ist fest mit den Mitteldarmdrüsen verwachsen. Seine Gestalt und die Art seiner
Einbettung in die eben genannten Drüsen sind etwas verschieden bei den einzelnen Tieren.
Im allgemeinen stellt er ein langgestrecktes sackförmiges Gebilde dar, wie es Abb. 8 a zeigt.
Die älteren Autoren gliedern den Magen meist in Cardia, Fundus und Pylorus. Diese
Begriffe lassen sich a n a t omi s c h rechtfertigen, f u n k t i o n e l l suggerieren sie Leistungen,
wie sie bei den Säugetieren anzutreffen sind. Mit Recht weist daher Co h n h e im
(1902, S. 402) darauf hin, daß man sie besser vermeiden soll. Wir wollen daher von M a g
e n e i n g a n g , Ma g e n s a c k und Ma g e n a u s g a n g sprechen. Über dem Magensack
wölbt sich zwischen Eingang und Ausgang die Ma g e n k a p p e . Auf Abb. 8 a u. 11 sind
alle Teile deutlich zu erkennen.
Der Oesophagus läuft unter der Magenkappe hinweg, wobei er sich zum Mageneingang
verengert. Abb. 13 zeigt die auf geschnittene Kappe, welche den Eingang verdeckt.
Der Verlauf des Oesophagus wurde daher durch eine Sonde angedeutet. Ferner sind auf
dieser Zeichnung auch die zahlreichen Wülste des Magens zu sehen, die je nach dem
Kontraktionszustande der darunter liegenden Muskelfasern eine starke Veränderlichkeit
auf weisen. Im allgemeinen verlaufen sie vom Mageneingang zum Magenausgang. Hier
jedoch tritt ihnen ein System von Wülsten entgegen, welches genau senkrecht auf ihnen
steht. Das ist der Magenausgang. Auch die Magenkappe ist stark gewulstet. Die Bedeutung
dieses Magenreliefs werden wir erst verstehen, wenn wir im nächsten Kapitel den Nahrungstransport
besprechen.
Die Magenwand wird auf der hinteren Seite von den Mitteldarmdrüsenöffnungen
durchbohrt, die auf den Abb. 8 a, 11 u. 13 angegeben sind. Die eine liegt in der Nähe des
Mageneinganges, die andere dicht am Magenausgang. Wenn wir die erstere als die v o r d
e r e und die zweite als die h i n t e r e M i t t e l d a rm d r ü s e n ö f f n u n g bezeichnen, so
müssen wir uns immer vor Augen halten, daß die erstere der hinteren Drüse, welche sich
neben der Gonade bis in die obersten Windungen des Gehäuses erstreckt, und die letztere
der vorderen um die Magenkappe gelagerten Drüse angehört (vgl. Abb. 8 a).
Die Wülste und Furchen der Magen wand stehen, wie man auf Abb. 13 deutlich
erkennen kann, z. T. in unmittelbarer Beziehung zu den Mitteldarmdrüsenöffnungen, die
etwas eingesenkt liegen. Wie tief eingeschnittene Zugangsstraßen führen die Rillen auf
die Eingänge zu. Das gilt besonders für die hintere Drüsenöffnung. Bei mechanischer,
chemischer oder elektrischer Reizung der Magenschleimhaut kann man sich jedoch davon
überzeugen, daß durch Muskelkontraktionen auch Zugangsstraßen zur vorderen Drüsenöffnung
geschaffen werden können, ja daß sogar eine tiefe Furche zwischen vorderem und
hinterem Eingang bisweilen auf tritt. Diese Tatsache ist für den Sekret- und Nahrungstransport
wichtig und wir werden im nächsten Kapitel darauf zurückkommen.
Während das Wulstsystem in Längsrichtung des Darmes verläuft, treten am M a g e n -
a u s g a n g plötzlich zirkuläre Furchen auf. Wie Abb. 13 zeigt, schließen sie sich nicht
vollkommen zum Ring, sondern lassen einen kleinen Kanal zwischen hinterer Drüsenöffnung
und Enddarm frei. Ein besonders stark ausgeprägter Wulst — Hauptwulst —
grenzt diesen Kanal auch weiterhin gegen das übrige Lumen des Enddarmes ab.
Ehe wir aber die Struktur dieses letzten Darmabschnittes besprechen, ist es nötig,
einen kurzen Überblick über den B a u d e r Mi t t e l d a rm d r ü s e n zu geben.
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man glauben, der große Drüsenkomplex,
der sich bis in die Spitze des Gehäuses hinauf windet, gehöre einem einzigen Organ an.
Wenn man aber Hunderte von Tieren prüft, findet man immer einige, bei welchen beide
Drüsen getrennt auftreten, so daß ein schmaler Streifen der hinteren Magenwand sichtbar
wird, wie es die gestrichelten Linien auf Abb. 8 a andeuten. Die hintere Drüse ist so
eng mit der Gonade verwachsen, daß ich beide Organe bei der Herstellung von Enzymextrakten
nicht quantitativ trennen konnte, sondern immer Teile der Mitteldarmdrüse
opferte. Auch die Ablösung vom Magen ist ziemlich schwierig.
Die Drüsen zeigen eine verzweigt tubulöse Anordnung. Zwischen den Drüsenschläuchen
findet sich Bindegewebe, welches die Tubuli umhüllt. Ferner werden die Organe
von Blutlakunen durchzogen. Die F a r b e der Drüsen wechselt außerordentlich. Sie ist
einerseits durch die Einschlüsse in den Zellen, andererseits durch den Inhalt der Drüsenschläuche
bedingt. Ob das Bindegewebe außerdem noch Pigmentzellen enthält, wie sie
Men d e l und B rad ley (1905, S. 314) fü r Sycotypus beschreiben, vermag ich nicht zu
sagen. Auch D a k in (1912) macht keine Angaben darüber. Häufig trifft man eine dunkelolivgrüne
Farbe an, aber ich konnte auch bräunlich-rötliche Farbtöne, der weiblichen
Gonade nicht unähnlich, beobachten. In einem Falle fand ich zwei Mitteldarmdrüsen von
orangegelbem und dunkelolivgrünem geflecktem Aussehen. Wahrscheinlich hatte das Tier
einige Tage vorher die Gonade einer anderen Wellhornschnecke gefressen, deren Reste aber
nur in einen Teil der Drüsengänge eingetreten waren. F ü ttert man einige Tiere mit
Seeigelovarien, andere mit Rinderhackfleisch, welches sie lieber nehmen als Schellfischmuskeln,
so sind die Drüsen der letzteren dunkler als die der ersteren. Beim Eintrocknen
nehmen die Mitteldarmdrüsen eine tiefschwarze Farbe an, wenn die Tiere lange Zeit
nichts gefressen hatten. Die Drüsen haben einen unangenehm ölig-tranigen Geruch.
Die Individuen einiger Transporte zeigten auffallend hellgrau gesprenkelte, an der
Oberfläche mit Knötchen versehene Mitteldarmdrüsen, die bisweilen ohne Kontrast in
die Magen wand überzugehen schienen. Eine mikroskopische Untersuchung ergab, daß
dieses Aussehen von T r emat o d e n l a r v e n h e r r ü h r t e [vgl. L ebo u r (1916—1918)]. Solche
infizierten Drüsen mußten natürlich bei der Herstellung von Enzymextrakten sorgfältig
entfernt werden.
H i s t o l o g i s c h sind die Mitteldarmdrüsen von D a k in (1912) untersucht worden.
In den Gängen fand er Wimperzellen mit wenig Einschlüssen. J e weiter er die Tubuli
nach ihrem blind geschlossenen Ende zu verfolgte, um so mehr nahmen die Einschlüsse
— stark färbbare Korperchentíp zu, außerdem enthielten die Zellen Vakuolen. Wimpern
besaßen sie nicht. Seit B a r fu r th s (1883) Untersuchungen an einheimischen Land- und
Süßwasserschnecken wissen wir, daß sich in der Mitteldarmdrüse Kalkzellen finden.
D a k in (1912) konnte dieselben auch bei Buccinum nach weisen. Die neuesten Arbeiten
K rijg sm ans (1925 und 1928) haben ergeben, daß die von B a r fu r th (1883) beschriebenen
Ferment- und Leberzellen identisch sind, da die Fermentzellen gleichzeitig resorbieren.
Auch D akin (1912) bezweifelt, daß neben den Kalkzellen noch zwei verschiedene Zellarten
im Sinne B a r fu r th s existieren, er nimmt vielmehr an, daß beide nur verschiedene
Zustände einer Zellart repräsentieren. Wie bereits Cu én o t (1892) nach wies, sind die
Mitteldarmdrüsen von Buccinum nicht exkretorisch tätig. Die Ausscheidung der Stoffe
kommt allein der Niere zu. Selbstverständlich kann auch hier die letzte Entscheidung nur
durch Stufenuntersuchungen getroffen werden. Aus den bisherigen Ergebnissen ist zu
schließen, daß die Mi t t e l d a rm d r ü s e n von B u c c i n u m neben den Wim p e r z e l l
en ihrer Ausführgänge nur K a l k z e l l e n und F e rme n t z e l l e n enthalten. Letztere
dienen gleichzeitig der R e s o r p t i o n der aufgespaltenen Nahrung.