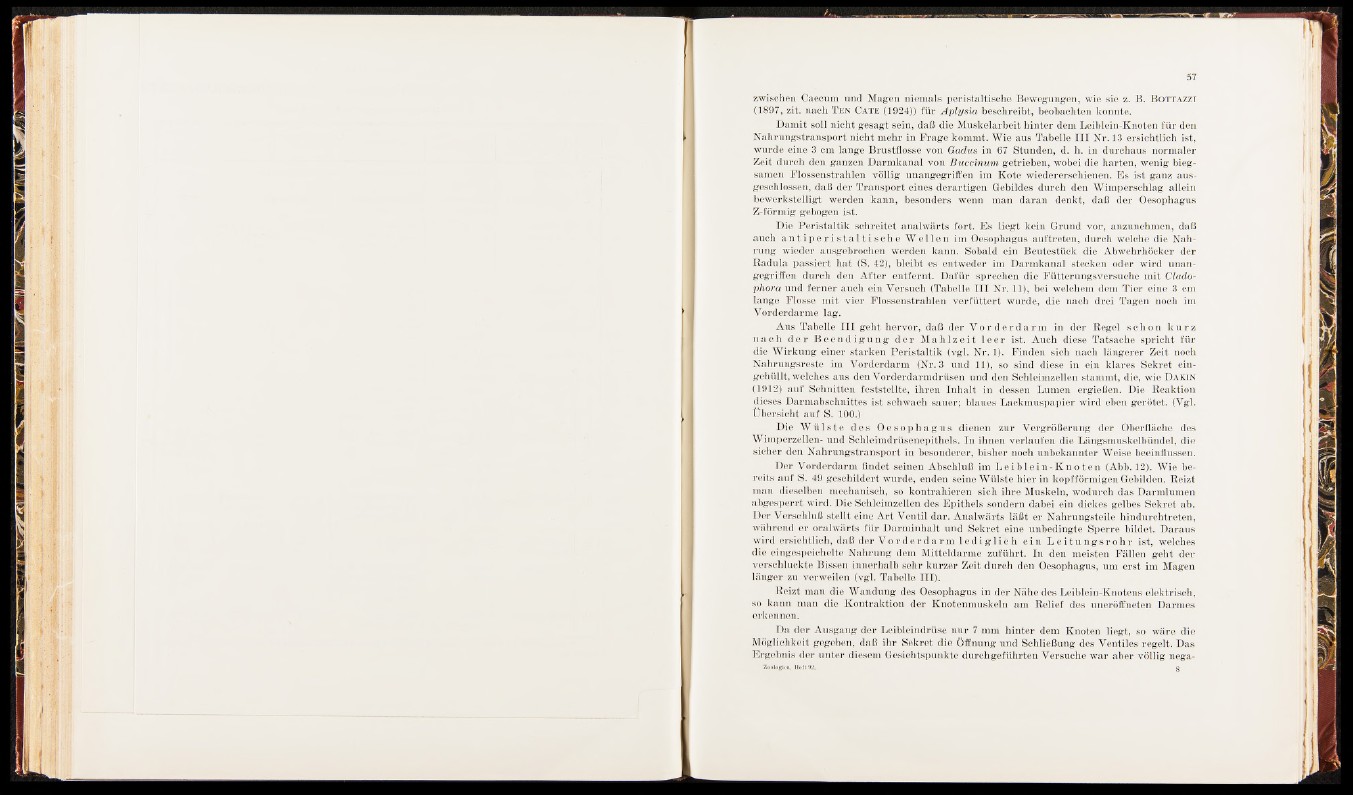
1
N
zwischen Caecum und Magen niemals p eristaltische Bewegungen, wie sie z. B. Bottazzi
(1897, zit. nach Ten Cate (1924)) für Aplysia beschreibt, beobachten konnte.
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Muskelarbeit hinter dem Leiblein-Knoten für den
Nahrungstransport nicht m ehr in Frage kommt. Wie aus Tabelle I I I Nr. 13 ersichtlich ist,
wurde eine 3 cm lange Brustflosse von Gadus in 67 Stunden, d. h. in durchaus normaler
Zeit durch den ganzen Darmkanal von Buccinum getrieben, wobei die harten, wenig biegsamen
Flossenstrahlen völlig unangegriffen im Kote wiedererschienen. Es ist ganz ausgeschlossen,
daß der Transport eines derartigen Gebildes durch den Wimperschlag allein
bewerkstelligt werden kann, besonders wenn man daran denkt, daß der Oesophagus
Z-förmig gebogen ist.
Die Peristaltik schreitet analwärts fort. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen, daß
auch a n t i p e r i s t a l t i s c h e W e l l e n im Oesophagus auftreten, durch welche die Nahrung
wieder ausgebrochen werden kann. Sobald ein Beutestück die Abwehrhöcker der
Radula passiert hat (S. 42), bleibt es entweder im Darmkanal stecken oder wird unangegriffen
durch den After entfernt. Dafür sprechen die Fütterungsversuche mit Clado-
phora und ferner auch ein Versuch (Tabelle I I I Nr. 11), bei welchem dem Tier eine 3 cm
lange Flosse mit vier Flossenstrahlen verfüttert wurde, die nach drei Tagen noch im
Vorderdarme lag.
Aus Tabelle I I I geht hervor, daß der V o r d e r d a rm in der Regel s c h o n K u r z
n a c h d e r B e e n d i g u n g d e r Ma h l z e i t l e e r ist. Auch diese Tatsache spricht für
die Wirkung einer starken Peristaltik (vgl. Nr. lj. Finden sich nach längerer Zeit noch
Nahrungsreste im Vorderdarm (Nr. 3 und 11), so sind diese in ein klares Sekret eingehüllt,
welches aus den Vorderdarmdrüsen und den Schleimzellen stammt, die, wie Dakin
(1912) auf Schnitten feststellte, ihren Inhalt in dessen Lumen ergießen. Die Reaktion
dieses Darmabschnittes ist schwach sauer; blaues Lackmuspapier wird eben gerötet. (Vgl.
Übersicht auf S. 100.)
Die Wü l s t e de s Oe s o p h a g u s dienen zur Vergrößerung der Oberfläche des
Wimperzellen- und Schleimdrüsenepithels. In ihnen verlaufen die Längsmuskelbündel, die
sicher den Nahrungstransport in besonderer, bisher noch unbekannter Weise beeinflussen.
Der Vorderdarm findet seinen Abschluß im L e i b l e i n -K n o t e n (Abb. 12). Wie bereits
auf S. 49 geschildert wurde, enden seine Wülste hier in köpf förmigen Gebilden. Reizt
man dieselben mechanisch, so kontrahieren sich ihre Muskeln, wodurch das Darmlumen
abgesperrt wird. Die Schleimzellen des Epithels sondern dabei ein dickes gelbes Sekret ab.
Der Verschluß stellt eine Art Ventil dar. Analwärts läßt er Nahrungsteile hindurchtreten,
während er oralwärts für Darminhalt und Sekret eine unbedingte Sperre bildet. Daraus
wird ersichtlich, daß der V o r d e r d a rm l e d i g l i c h e in L e i t u n g s r o h r ist, welches
die eingespeichelte Nahrung dem Mitteldarme zuführt. In den meisten Fällen geht der
verschluckte Bissen innerhalb sehr kurzer Zeit durch den Oesophagus, um erst im Magen
länger zu verweilen (vgl. Tabelle III).
Reizt man die Wandung des Oesophagus in der Nähe des Leiblein-Knotens elektrisch,
so kann man die Kontraktion der Knotenmuskeln am Relief des uneröffneten Darmes
erkennen.
Da der Ausgang der Leibleindrüse nur 7 mm hinter dem Knoten liegt, so wäre die
Möglichk eit gegeben, daß ihr Sekret die Öffnung und Schließung des Ventiles regelt. Das
Ergebnis der unter diesem Gesichtspunkte durch geführten Versuche war aber völlig nega-
Zoologica, Heit 92. . |