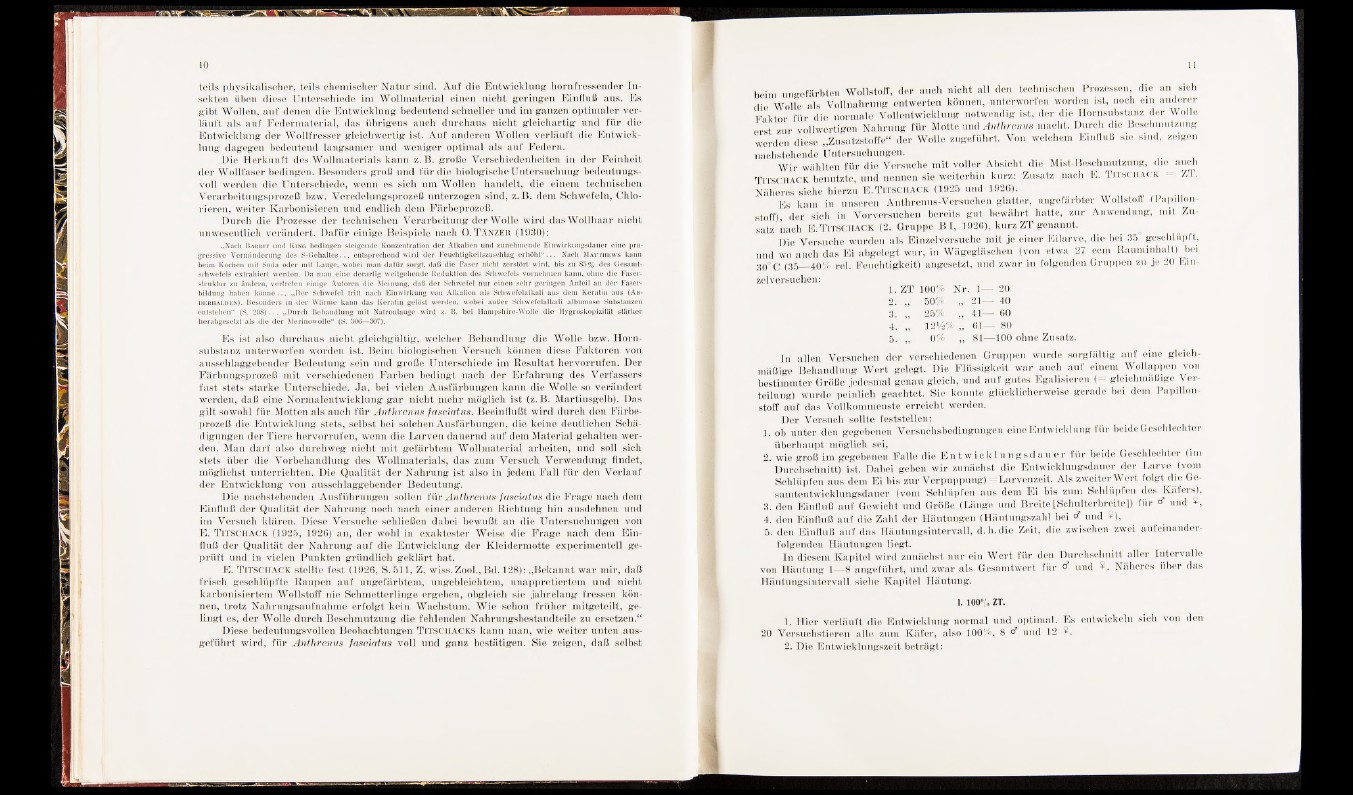
teils physikalischer, teils chemischer Natur sind. Auf die Entwicklung hornfressender In sekten
üben diese Unterschiede im Wollmaterial einen nicht geringen Einfluß aus. Es
gibt Wollen, auf denen die Entwicklung bedeutend schneller und im ganzen optimaler verläuft
als auf Federmaterial, das übrigens auch durchaus nicht gleichartig und für die
Entwicklung der Wollfresser gleichwertig ist. Auf anderen Wollen verläuft die Entwicklung
dagegen bedeutend langsamer und weniger optimal als auf Federn.
Die Herkunft des Wollmaterials kann z. B. große Verschiedenheiten in der Feinheit
der Wollfaser bedingen. Besonders groß und für die biologische Untersuchung bedeutungsvoll
werden die Unterschiede, wenn es sich um Wollen handelt, die einem technischen
Verarbeitungsprozeß bzw. Veredelungsprozeß unterzogen sind, z.B. dem Schwefeln, Chlorieren,
weiter Karbonisieren und endlich dem Färbeprozeß.
Durch die Prozesse der technischen Verarbeitung der Wolle wird dasWollhaar nicht
unwesentlich verändert. Dafür einige Beispiele nach 0 . Tänzer (1930):
„Nach B a r r it und K in g bedingen steigende Konzentration der Alkalien und zunehmende Einwirkungsdauer eine progressive
Verminderung des S-Gehaltes. . . entsprechend wird der Feuchtigkeitszuschlag erhöht“ . . . Nach M a t t h e w s kann
beim Kochen mit Soda oder mit Lauge, wobei man dafür sorgt, daß die Faser nicht zerstört wird, bis zu 85% des Gesamtschwefels
extrahiert werden. Da man eine derartig weitgehende Reduktion des Schwefels vornehmen kann, ohne die Faser-
strulctur zu ändern, vertreten einige Autoren die Meinung, daß der Schwefel nur einen sehr geringen Anteil an der Faserbildung
haben könne. . . „Der Schwefel tritt nach Einwirkung von Alkalien als Schwefelalkali aus dem Keratin aus (A b d
e r h a l d e n ) . Besonders in der Wärme kann das Keratin gelöst werden, wobei außer Schwefelalkali albumose Substanzen
entstehen“ (S. 298) . . . „Durch Behandlung mit Natronlauge wird z. B. bei Hampshire-Wolle die Hygroskopizität stärker
herabgesetzt als die der Merinowolle“ (S. 306—307).
Es ist also durchaus nicht gleichgültig, welcher Behandlung die Wolle bzw. Hornsubstanz
unterworfen worden ist. Beim biologischen Versuch können diese Faktoren von
ausschlaggebender Bedeutung sein und große Unterschiede im Resultat hervorrufen. Der
Färbungsprozeß mit verschiedenen Farben bedingt nach der Erfahrung des Verfassers
fast stets starke Unterschiede. Ja , bei vielen Ausfärbungen kann die Wolle so verändert
werden, daß eine Normalentwicklung gar nicht mehr möglich ist (z.B. Martiusgelb). Das
gilt sowohl für Motten als auch für Anthrenus fasciatus. Beeinflußt wird durch den Färbeprozeß
die Entwicklung stets, selbst bei solchen Ausfärbungen, die keine deutlichen Schädigungen
der Tiere hervorrufen, wenn die Larven dauernd auf dem Material gehalten werden.
Man darf also durchweg nicht mit gefärbtem Wollmaterial arbeiten, und soll sich
stets über die Vorbehandlung des Wollmaterials, das zum Versuch Verwendung findet,
möglichst unterrichten. Die Qualität der Nahrung ist also in jedem Fall für den Verlauf
der Entwicklung von ausschlaggebender Bedeutung.
Die nachstehenden Ausführungen sollen für Anthrenus fasciatus die Frage nach dem
Einfluß der Qualität der Nahrung noch nach einer anderen Richtung hin ausdehnen und
im Versuch klären. Diese Versuche schließen dabei bewußt an die Untersuchungen von
E. T it s c h a c k (1925, 1926) an, der wohl in exaktester Weise die Frage nach dem Einfluß
der Qualität der Nahrung auf die Entwicklung der Kleidermotte experimentell geprüft
und in vielen Punkten gründlich geklärt hat.
E. Titschack stellte fest (1926, S. 511, Z. wiss.Zool.,Bd. 128): „Bekannt war mir, daß
frisch geschlüpfte Raupen auf ungefärbtem, ungebleichtem, unappretiertem und nicht
karbonisiertem Wollstoff nie Schmetterlinge ergeben, obgleich sie jahrelang fressen können,
trotz Nahrungsaufnahme erfolgt kein Wachstum. Wie schon früher mitgeteilt, gelingt
es, der Wolle durch Beschmutzung die fehlenden Nahrungsbestandteile zu ersetzen.“
Diese bedeutungsvollen Beobachtungen Titschacks kann man, wie weiter unten ausgeführt
wird, für Anthrenus fasciatus voll und ganz bestätigen. Sie zeigen, daß selbst
beim ungefärbten Wollstoff, der auch nicht all den technischen Prozessen, die an sich
die Wolle als Vollnahrung entwerten können, unterworfen worden ist, noch ein anderer
Faktor für die normale Vollentwicklung notwendig ist, der die Hornsubstanz der Wolle
erst zur vollwertigen Nahrung für Motte und Anthrenus macht. Durch die Beschmutzung
werden diese „Zusatzstoffe“ der Wolle zugeführt. Von welchem Einfluß sie sind, zeigen
nachstehende Untersuchungen.
Wir wählten für die Versuche mit voller Absicht die Mist-Beschmutzung, die^auch
Txtsci-iack benutzte, und nennen sie weiterhin kurz: Zusatz nach E. Titschack = ZT.
Näheres siehe hierzu E. TITSCHACK (1925 und 1926).
Es kam in unseren Anthrenus-Versuchen glatter, ungefärbter Wollstoff (Papillon-
stoff), der sich in Vorversuchen bereits gut bewährt hatte, zur Anwendung, mit Zusatz
nach E .Titschack (2. Gruppe B I, 1926), kurz ZT genannt.
Die Versuche wurden als Einzelversuche mit je einer Eilarve, die bei 35 geschlüpft,
und wo auch das Ei abgelegt war, in Wägegläschen (von etwa 27 ccm Bauminhalt) bei
30° C (35__40% rel. Feuchtigkeit) angesetzt, und zwar in folgenden Gruppen zu je 20 Einzelversuchen:
1. ZT 100% Nr. 1— 20
2. „ 50% „ 21— 40
3. „ 25% „ 41— 60
4. „ 12y2% „ 61— 80
5. „ 0% „ 81—100 ohne Zusatz.
In allen Versuchen der verschiedenen Gruppen wurde sorgfältig auf eine gleichmäßige
Behandlung Wert gelegt. Die Flüssigkeit war auch auf einem Wollappen von
bestimmter Größe jedesmal genau gleich, und auf gutes Egalisieren (= gleichmäßige Verteilung)
wurde peinlich geachtet. Sie konnte glücklicherweise gerade hei dem Papillon-
stoff auf das Vollkommenste erreicht werden.
Der Versuch sollte feststellen:
1. ob unter den gegebenen Versuchsbedingungen eine Entwicklung für beide Geschlechter
überhaupt möglich sei,
2. wie groß im gegebenen Falle d i e E n tw i e k l u n g s d a u e r für beide Geschlechter (im
Durchschnitt) ist. Dabei geben wir zunächst die Entwicklungsdauer der Larve (vom
Schlüpfen aus dem Ei bis zur Verpuppung) =Larvenzeit. Als zweiter Wert folgt die Gesamtentwicklungsdauer
(vom Schlüpfen aus dem Ei bis zum Schlüpfen des Käfers),
3. den Einfluß auf Gewicht und Größe (Länge und Breite [Schulterbreite]) für <? und 2,
4. den Einfluß auf die Zahl der Häutungen (Häutungszahl bei d und ?),
5. den Einfluß auf das Häutungsintervall, d. h. die Zeit, die zwischen zwei aufeinander-
folgenden Häutungen liegt.
In diesem Kapitel wird zunächst nur ein Wert für den Durchschnitt aller Intervalle
von Häutung 1— 8 angeführt, und zwar als Gesamtwert für cf und 2. Näheres über das
Häutungsintervall siehe Kapitel Häutung.
I. 100°/0 ZT.
1. Hier verläuft die Entwicklung normal und optimal. Es entwickeln sich von den
20 Versuchstieren alle zum Käfer, also 100%, 8 c? und 12
2. Die Entwicklungszeit beträgt: