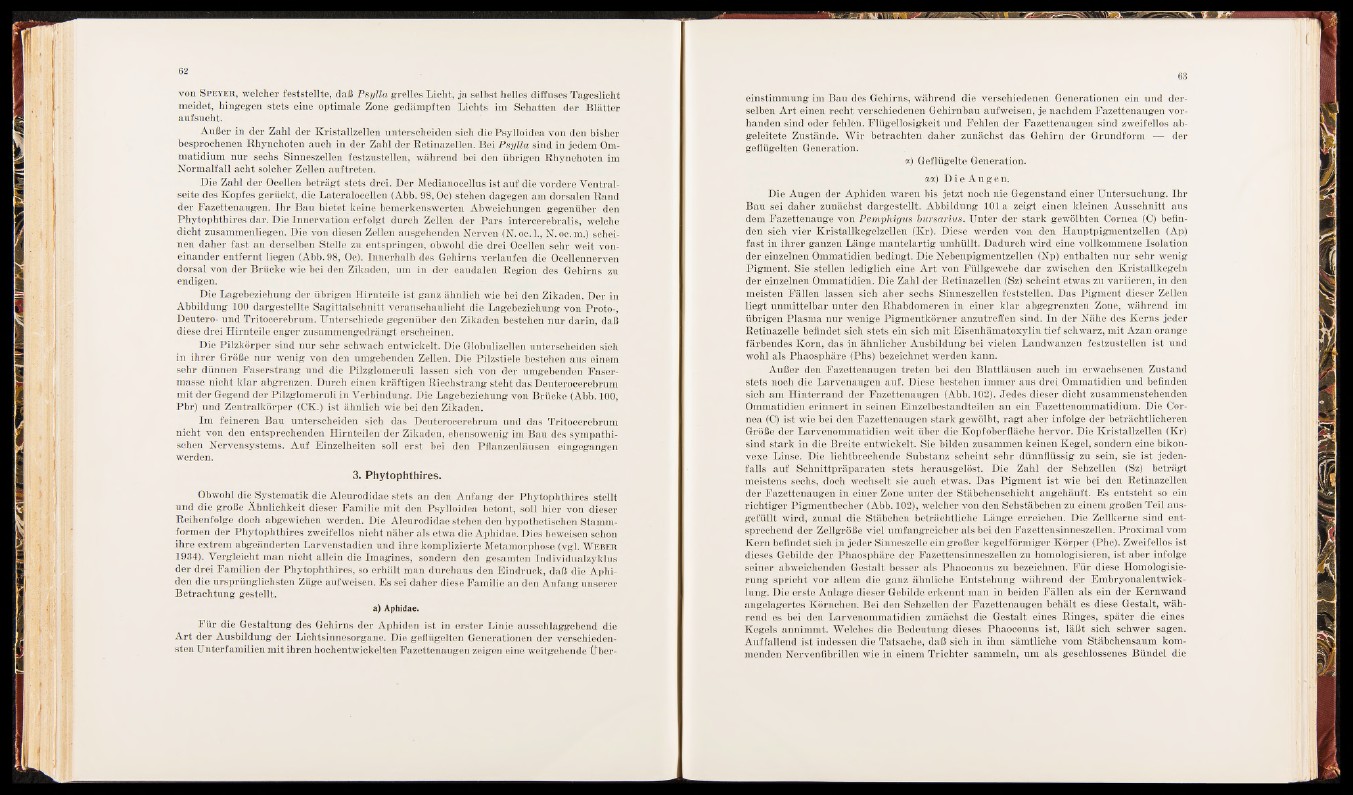
von Sp ey e r , welcher feststellte, daß Psylla grelles Licht, ja selbst helles diffuses Tageslicht
meidet, hingegen stets eine optimale Zone gedämpften Lichts im Schatten der Blätter
aufsucht.
Außer in der Zahl der Kristallzellen unterscheiden sich die Psylloidea von den bisher
besprochenen Rhynchoten auch in der Zahl der Retinazellen. Bei Psylla sind in jedem Om-
matidium nur sechs Sinneszellen festzustellen, während bei den übrigen Rhynchoten im
Normalfall acht solcher Zellen auftreten.
Die Zahl der Ocellen beträgt stets drei. Der Medianocellus ist auf die vordere V entralseite
des Kopfes gerückt, die Lateralocellen (Abb. 98, Oc) stehen dagegen am dorsalen Rand
der Fazettenaugen. Ih r Bau bietet keine bemerkenswerten Abweichungen gegenüber den
Phytophthires dar. Die Innervation erfolgt durch Zellen der Pars intercerebralis, welche
dicht zusammenliegen. Die von diesen Zellen ausgehenden Nerven (N. oc. H N. oc. m.) scheinen
daher fast an derselben Stelle zu entspringen, obwohl die drei Ocellen sehr weit voneinander
entfernt liegen (Abb. 98, Oc). Innerhalb des Gehirns verlaufen die Ocellennerven
dorsal von der Brücke wie bei den Zikaden, um in der caudalen Region des Gehirns zu
endigen.
Die Lagebeziehung der übrigen Hirnteile ist ganz ähnlich wie bei den Zikaden. Der in
Abbildung 100 dargestellte Sagittalschnitt veranschaulicht die Lagebeziehung von Proto-,
Deutero- und Tritoeerehrum. Unterschiede gegenüber den Zikaden bestehen nur darin, daß
diese drei Hirnteile enger zusammengedrängt erscheinen.
Die Pilzkörper sind nur sehr schwach entwickelt. Die Globulizellen unterscheiden sich
in ihrer Größe nur wenig von den umgebenden Zellen. Die Pilzstiele bestehen aus einem
sehr dünnen Faserstrang und die Pilzglomeruli lassen sich von der umgebenden Fasermasse
nicht klar abgrenzen. Durch einen kräftigen Riechstrang steht das Deuterocerehrum
mit der Gegend der Pilzglomeruli in Verbindung. Die Lagebeziehung von Brücke (Abh. 100,
Pbr) und Zentralkörper (CK.) ist ähnlich wie hei den Zikaden.
Im feineren Bau unterscheiden sich das Deuterocerehrum und das Tritoeerehrum
nicht von den entsprechenden Hirnteilen der Zikaden, ebensowenig im Bau des sympathischen
Nervensystems. Auf Einzelheiten soll erst hei den Pflanzenläusen eingegangen
werden.
3. Phytophthires.
Obwohl die Systematik die Aleurodidae stets an den Anfang der Phytophthires stellt
und die große Ähnlichkeit dieser Familie mit den Psylloidea betont, soll hier von dieser
Reihenfolge doch ahgewichen werden. Die Aleurodidae stehen den hypothetischen Stammformen
der Phytophthires zweifellos nicht näher als etwa die Aphidae. Dies beweisen schon
ihre extrem ahgeänderten Larvenstadien und ihre komplizierte Metamorphose (vgl. W eber
1934). Vergleicht man nicht allein die Imagines, sondern den gesamten Individualzyklus
der drei Familien der Phytophthires, so erhält man durchaus den Eindruck, daß die Aphi-
den die ursprünglichsten Züge auf weisen. Es sei daher diese Familie an den Anfang unserer
Betrachtung gestellt.
a) Aphidae.
F ü r die Gestaltung des Gehirns der Aphiden ist in erster Linie ausschlaggebend die
Art der Ausbildung der Lichtsinnesorgane. Die geflügelten Generationen der verschiedensten
Unterfamilien mit ihren hochentwickelten Fazettenaugen zeigen eine weitgehende Übereinstimmung
im Bau des Gehirns, während die verschiedenen Generationen ein und derselben
Art einen recht verschiedenen Gehirnhau aufweisen, je nachdem Fazettenaugen vorhanden
sind oder fehlfen. Flügellosigkeit und Fehlen der Fazettenaugen sind zweifellos abgeleitete
Zustände. Wir betrachten daher zunächst das Gehirn der Grundform - 3 der
geflügelten Generation.
a) Geflügelte Generation.
««) D ie Auge n.
Die Augen der Aphiden waren bis jetzt noch nie Gegenstand einer Untersuchung. Ih r
Bau sei daher zunächst dargestellt. Abbildung 101a zeigt einen kleinen Ausschnitt aus
dem Fazettenauge von Pemphigus hursarius. Unter der stark gewölbten Cornea (C) befinden
sich vier Kristallkegelzellen (Kr). Diese werden von den Hauptpigmentzellen (Ap)
fast in ihrer ganzen Länge mantelartig umhüllt. Dadurch wird eine vollkommene Isolation
der einzelnen Ommatidien bedingt. Die Nebenpigmentzellen (Np) enthalten nur sehr wenig
Pigment. Sie stellen lediglich eine A rt von Füllgewebe dar zwischen den Kristallkegeln
der einzelnen Ommatidien. Die Zahl der Retinazellen (Sz) scheint etwas zu variieren, in den
meisten Fällen lassen sich aber sechs Sinneszellen feststellen. Das Pigment dieser Zellen
liegt unmittelbar unter den Rhabdomeren in einer klar abgegrenzten Zone, während im
übrigen Plasma nur wenige Pigmentkörner anzutreffen sind. In der Nähe des Kerns jeder
Retinazelle befindet sich stets ein sich mit Eisenhämatoxylin tief schwarz, mit Azan orange
färbendes Korn, das in ähnlicher Ausbildung bei vielen Landwanzen festzustellen ist und
wohl als Phaosphäre (Phs) bezeichnet werden kann.
Außer den Fazettenaugen treten bei den Blattläusen auch im erwachsenen Zustand
stets noch die Larvenaugen auf. Diese bestehen immer aus drei Ommatidien und befinden
sich am Hinterrand der Fazettenaugen (Abb. 102). Jedes dieser dicht zusammenstehenden
Ommatidien erinnert in seinen Einzelbestandteilen an ein Fazettenommatidium. Die Cornea
(C) ist wie bei den Fazettenaugen stark gewölbt, rag t aber infolge der beträchtlicheren
Größe der Larvenommatidien weit über die Kopfoberfläche hervor. Die Kristallzellen (Kr)
sind stark in die Breite entwickelt. Sie bilden zusammen keinen Kegel, sondern eine bikonvexe
Linse. Die lichtbrechende Substanz scheint sehr dünnflüssig zu sein, sie ist jedenfalls
auf Schnittpräparaten stets herausgelöst. Die Zahl der Sehzellen (Sz) beträgt
meistens sechs, doch wechselt sie auch etwas. Das Pigment ist wie bei den Retinazellen
der Fazettenaugen in einer Zone unter der Stäbchenschicht angehäuft. Es entsteht so ein
richtiger Pigmentbecher (Abb. 102), welcher von den Sehstäbchen zu einem großen Teil ausgefüllt
wird, zumal die Stäbchen beträchtliche Länge erreichen. Die Zellkerne sind entsprechend
der Zellgröße viel umfangreicher als bei den Fazettensinneszellen. Proximal vom
Kern befindet sich in jeder Sinneszelle ein großer kegelförmiger K örper (Phc). Zweifellos ist
dieses Gebilde der Phaosphäre der Fazettensinneszellen zu homologisieren, ist aber infolge
seiner abweichenden Gestalt besser als Phaoconus zu bezeichnen. F ü r diese Homologisierung
spricht vor allem die ganz ähnliche Entstehung während der Embryonalentwicklung.
Die erste Anlage dieser Gebilde erkennt man in beiden Fällen als ein der Kernwand
angelagertes Körnchen. Bei den Sehzellen der Fazettenaugen behält es diese Gestalt, während
es hei den Larvenommatidien zunächst die Gestalt eines Ringes, später die eines
Kegels annimmt. Welches die Bedeutung dieses Phaoconus ist, läßt sich schwer sagen.
Auffallend ist indessen die Tatsache, daß sich in ihm sämtliche vom Stäbchensaum kommenden
Nervenfibrillen wie in einem Trichter sammeln, um als geschlossenes Bündel die