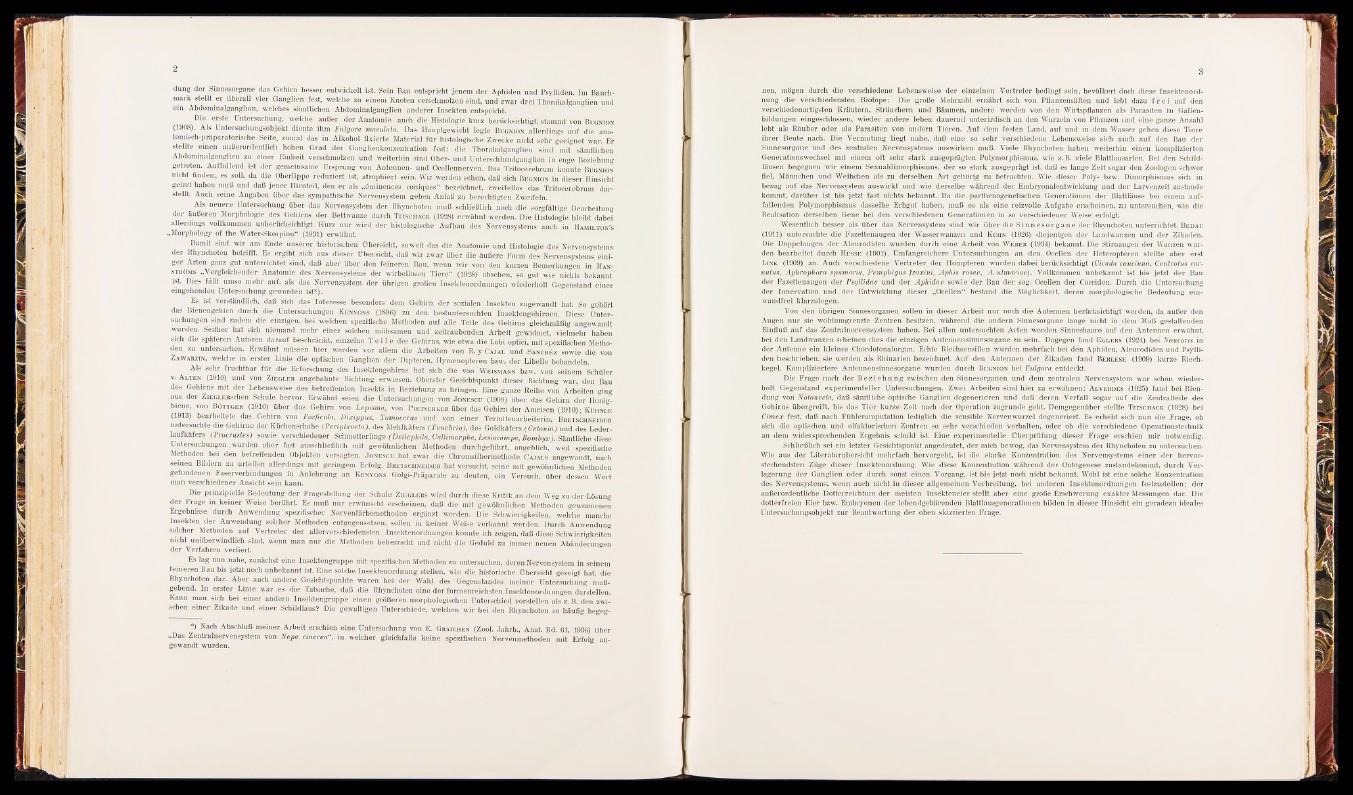
düng der Sinnesorgane das Gehirn besser entwickelt ist. Sein Bau entspricht jenem der Aphiden und Psylliden. Im Bauchmark
stellt er überall vier Ganglien fest, welche zu einem Knoten verschmolzen sind, und zwar drei Thorakalganglien und
ein Abdominalganglion, welches sämtlichen Abdominalganglien anderer Insekten entspricht.
Die erste Untersuchung, welche außer der Anatomie auch die Histologie kurz berücksichtigt, stammt von B u g n io n
(1908). Als Untersuchungsobjekt diente ihm Fulgora maculata. Das Hauptgewicht legte B u g n io n allerdings auf die ana-
tomisch-präparatorische Seite, zumal das in Alkohol fixierte Material für histologische Zwecke nicht sehr geeignet war. Er
stellte einen außerordentlich hohen Grad der Ganglienkonzentration fest: die Thorakalganglien sind mit* sämtlichen
Abdominalganglien zu einer Einheit verschmolzen und weiterhin sind Ober- und Unterschlundganglion in enge Beziehung
getreten. Auffallend ist der gemeinsame Ursprung von Antennen- und Ocellennerven. Das Tritocerebrum konnte B u g n io n
nicht finden; es soll, da die Oberlippe reduziert ist, atrophiert sein. Wir werden sehen, daß sich B u g n io n in dieser Hinsicht
geirrt haben muß und daß jener Hirnteil, den er als „éminences coniques“ bezeichnet, zweifellos das Tritocerebrum darstellt.
Auch seine Angaben über das sympathische Nervensystem geben Anlaß zu berechtigten Zweifeln.
Als neuere Untersuchung über das Nervensystem der Rhynchoten muß schließlich noch die sorgfältige Bearbeitung
der äußeren Morphologie des Gehirns der Bettwanze durch T it s c h a c k (1928) erwähnt werden. Die Histologie bleibt dabei
allerdings vollkommen unberücksichtigt. Kurz nur wird der histologische Aufbau des Nervensystems auch in H a m e l t o n ’s
„Morphology of the Water-Skorpion“ (1931) erwähnt.
Damit sind wir am Ende unserer historischen Übersicht, soweit das die Anatomie und Histologie des Nervensystems
der Rhynchoten betrifft. Es ergibt sich aus dieser Übersicht, daß wir zwar über die äußere Form des Nervensystems einiger
Arten ganz gut unterrichtet sind, daß aber über den feineren Bau, wenn wir von den kurzen Bemerkungen in H a n -
s t r ö m s „Vergleichender Anatomie des Nervensystems der wirbellosen Tiere“ (1 9 2 8 ) absehen, so gut wie nichts bekannt
ist. Dies fällt umso mehr auf, als das Nervensystem der übrigen großen Insektenordnungen wiederholt Gegenstand einer
eingehenden Untersuchung geworden ist*).
Es ist verständlich, daß sich das Interesse besonders dem Gehirn der sozialen Insekten zugewandt hat. So gehört
das Bienengehirn durch die Untersuchungen K e n y o n s (1896) zu den bestuntersuchten Insektengehirnen. Diese Untersuchungen
sind zudem die einzigen, bei welchen spezifische Methoden auf alle Teile des Gehirns gleichmäßig angewandt
wurden. Seither hat sich niemand mehr einer solchen mühsamen und zeitraubenden Arbeit gewidmet, vielmehr haben
sich die späteren Autoren darauf beschränkt, einzelne T e i 1 e des Gehirns, wie etwa die Lobi optici, mit spezifischen Methoden
zu untersuchen. Erwähnt müssen hier werden vor allem die Arbeiten von R. y C a ja l und S a n c h é z sowie die von
Z a w a r z in , welche in erster Linie die optischen Ganglien der Dipteren, Hymenopteren bzw. der Libelle behandeln.
Als sehr fruchtbar für die Erforschung des Insektengehirns hat sich die von W e is m a n n bzw. von seinem Schüler
v. A l t e n (1910) und von Z ie g l e r angebahnte Richtung erwiesen. Oberster Gesichtspunkt dieser Richtung war, den Bau
des Gehirns mit der Lebensweise des betreffenden Insekts in Beziehung zu bringen. Eine ganze Reihe von Arbeiten ging
aus der ZiEGLERschen Schule hervor. Erwähnt seien die Untersuchungen von J o n e s c u (1909) über das Gehirn der Honigbiene,
von B ö t t g e r (1910) über das Gehirn von Lepisma, von P ie t s c h k e r über das Gehirn der Ameisen (1910) ; K ü h n l e
(1913) bearbeitete das Gehirn von Forficula, Dixippus, Tomocerus und von einer Termitenarbeiterin, B r e t s c h n e id e r
untersuchte die Gehirne der Küchenschabe (Periplaneta), des Mehlkäfers (Tenebrio), des Goldkäfers (Cetonia) und des Lederlaufkäfers
(Procrustes) sowie verschiedener Schmetterlinge (Deilephila, Callimorpha, Lasiocampa, Bombyx). Sämtliche diese
Untersuchungen wurden aber fast ausschließlich mit gewöhnlichen Methoden durchgeführt, angeblich, weil spezifische
Methoden bei den betreffenden Objekten versagten. J o n e s c u hat zwar die Chromsilbermethode C a ja l s angewandt, nach
seinen Bildern zu urteilen allerdings mit geringem Erfolg. B r e t s c h n e id e r hat versucht, seine mit gewöhnlichen Methoden
gefundenen Faserverbindungen in Anlehnung an K e n y o n s Golgi-Präparate zu deuten, ein Versuch, über dessen Wert
man verschiedener Ansicht sein kann.
Die prinzipielle Bedeutung der Fragestellung der Schule Z i e g l e r s wird durch diese Kritik an dem Weg zu der Lösung
der Frage in keiner Weise berührt. Es muß nur erwünscht erscheinen, daß die mit gewöhnlichen Methoden gewonnenen
Ergebnisse durch Anwendung spezifischer Nervenfärbemethoden ergänzt werden. Die Schwierigkeiten, welche manche
Insekten der Anwendung solcher Methoden entgegensetzen, sollen in keiner Weise verkannt werden. Durch Anwendung
solcher Methoden auf Vertreter der allerverschiedensten Insektenordnungen konnte ich zeigen, daß diese Schwierigkeiten
nicht unüberwindlich sind, wenn man nur die Methoden beherrscht und nicht die Geduld zu immer neuen Abänderungen
der Verfahren verliert.
Es lag nun nahe, zunächst eine Insektengruppe mit spezifischen Methoden zu untersuchen, deren Nervensystem in seinem
feineren Bau bis jetzt noch unbekannt ist. Eine solche Insektenordnung stellen, wie die historische Übersicht gezeigt hat, die
Rhynchoten dar. Aber auch andere Gesichtspunkte waren bei der Wahl des Gegenstandes meiner Untersuchung maßgebend.
In erster Linie war es die Tatsache, daß die Rhynchoten eine der formenreichsten Insektenordnungen darstellen.
Kann man sich bei einer ändern Insektengruppe einen größeren morphologischen Unterschied vorstellen als z. B. den zwischen
einer Zikade und einer Schildlaus? Die gewaltigen Unterschiede, welchen wir bei den Rhynchoten so häufig begeg*)
Nach Abschluß meiner Arbeit erschien eine Untersuchung von E. G r a ic h e n (Zool. Jahrb., Anat. Bd. 61, 1936) über
„Das Zentralnervensystem von Nepa cinerea“, in welcher gleichfalls keine spezifischen Nervenmethoden mit Erfolg angewandt
wurden.
nen, mögen durch die verschiedene Lebensweise der einzelnen Vertreter bedingt sein, bevölkert doch diese Insektenordnung
die verschiedensten Biotope: Die große Mehrzahl ernährt sich von Pflanzensäften und lebt dazu f r e i auf den
verschiedenartigsten Kräutern, Sträuchern und Bäumen, andere werden von den Wirtspflanzen als Parasiten in Gallen-
bildüngen eingeschlossen, wieder andere leben dauernd unterirdisch an den Wurzeln von Pflanzen und eine ganze Anzahl
lebt als Räuber oder als Parasiten von ändern Tieren. Auf dem festen Land, auf und in dem Wasser gehen diese Tiere
ihrer Beute nach. Die Vermutung liegt nahe, daß eine so sehr verschiedene Lebensweise sich auch auf den Bau der
Sinnesorgane und des zentralen Nervensystems auswirken muß. Viele Rhynchoten haben weiterhin einen komplizierten
Generationswechsel mit einem oft sehr stark ausgeprägten Polymorphismus, wie z. B. viele Blattlausarten. Bei den Schild-
läusen begegnen wir einem Sexualdimorphismus, der so stark ausgeprägt ist, daß es lange Zeit sogar den Zoologen schwer
fiel, Männchen und Weibchen als zu derselben Art gehörig zu betrachten. Wie dieser Poly- bzw. Dimorphismus sich in
bezug auf das Nervensystem auswirkt und wie derselbe während der Embryonalentwicklung und der Larvenzeit zustande
kommt, darüber ist bis jetzt fast nichts bekannt. Da die parthenogenetischen Generationen der Blattläuse bei einem auffallenden
Polymorphismus dasselbe Erbgut haben, muß es als eine reizvolle Aufgabe erscheinen, zu untersuchen, wie die
Realisation derselben Gene bei den verschiedenen Generationen in so verschiedener Weise erfolgt.
Wesentlich besser als über das Nervensystem sind wir über die S i n n e s o r g a n e der Rhynchoten unterrichtet. B e d a u
(1911) untersuchte die Fazettenaugen der Wasserwanzen und K u h n (1926) diejenigen der Landwanzen und der Zikaden.
Die Doppelaugen der Aleürodiden wurden durch eine Arbeit von W e b e r (1934) bekannt. Die Stirnaugen der Wanzen wurden
bearbeitet durch H e s s e (1901). Umfangreichere Untersuchungen an den Ocellen der Heteropteren stellte aber erst
L in k (1909) an. Auch verschiedene Vertreter der Hompteren wurden dabei berücksichtigt (Cicada concinna, Centrotus cor-
nutus, Aphrophora spumaria, Pemphigus fraxini, Aphis rosae, A.ulmariae). Vollkommen unbekannt ist bis jetzt der Bau
der Fazettenaugen der Psyllidae und der Aphidae sowie der Bau der sog. Ocellen der Cocciden. Durch die Untersuchung
der Innervation und der Entwicklung dieser „Ocellen“ bestand die Möglichkeit, deren morphologische Bedeutung einwandfrei
klarzulegen.
Von den übrigen Sinnesorganen sollen in dieser Arbeit nur noch die Antennen berücksichtigt werden, da außer den
Augen nur sie wohlumgrenzte Zentren besitzen, während die ändern Sinnesorgane lange nicht in dem Maß gestaltenden
Einfluß auf das Zentralnervensystem haben. Bei allen untersuchten Arten werden Sinneshaare auf den Antennen erwähnt,
bei den Landwanzen scheinen dies die einzigen Antennensinnesorgane zu sein. Dagegen fand E g g e r s (1924) bei Naucoris in
der Antenne ein kleines Chordotonalorgan. Echte Riechsensillen wurden mehrfach bei den Aphiden, Aleürodiden und Psylliden
beschrieben, sie werden als Rhinarien bezeichnet. Auf den Antennen der Zikaden fand B e r l e s e (1909) kurze Riechkegel.
Kompliziertere Antennensinnesorgane wurden durch B u g n io n bei Fulgora entdeckt.
Die Frage nach der Be z i e h u n g zwischen den Sinnesorganen und dem zentralen Nervensystem war schon wiederholt
Gegenstand experimenteller Untersuchungen. Zwei Arbeiten sind hier zu erwähnen: A lv e r d e s (1925) fand bei Blendung
von Notonecta, daß sämtliche optische Ganglien degenerieren und daß deren Verfall sogar auf die Zentralteile des
Gehirns übergreift, bis das Tier kurze Zeit nach der Operation zugrunde geht. Demgegenüber stellte T it s c h a c k (1928) bei
Cimex fest, daß nach Fühleramputation lediglich die sensible Nervenwurzel degeneriert. Es erhebt sich nun die Frage, ob
sich die optischen und olfaktorischen Zentren so sehr verschieden verhalten, oder ob die verschiedene Operationstechnik
an dem widersprechenden Ergebnis schuld ist. Eine experimentelle Überprüfung dieser Frage erschien mir notwendig.
Schließlich sei ein letzter Gesichtspunkt angedeutet, der mich bewog, das Nervensystem der Rhynchoten zu untersuchen.
Wie aus der Literaturübersicht mehrfach hervorgeht, ist die starke Konzentration des Nervensystems einer der hervorstechendsten
Züge dieser Insektenordnung. Wie diese Konzentration während der Ontogenese zustandekommt, durch Verlagerung
der Ganglien oder durch sonst einen Vorgang, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wohl ist eine solche Konzentration
des Nervensystems, wenn auch nicht in dieser allgemeinen Verbreitung, bei anderen Insektenordnungen festzustellen; der
außerordentliche Dotterreichtum der meisten Insekteneier stellt aber eine große Erschwerung exakter Messungen dar. Die
dotterfreien Eier bzw. Embryonen der lebendgebärenden Blattlausgenerationen bilden in dieser Hinsicht ein geradezu ideales
Untersuchungsobjekt zur Beantwortung der oben skizzierten Frage.