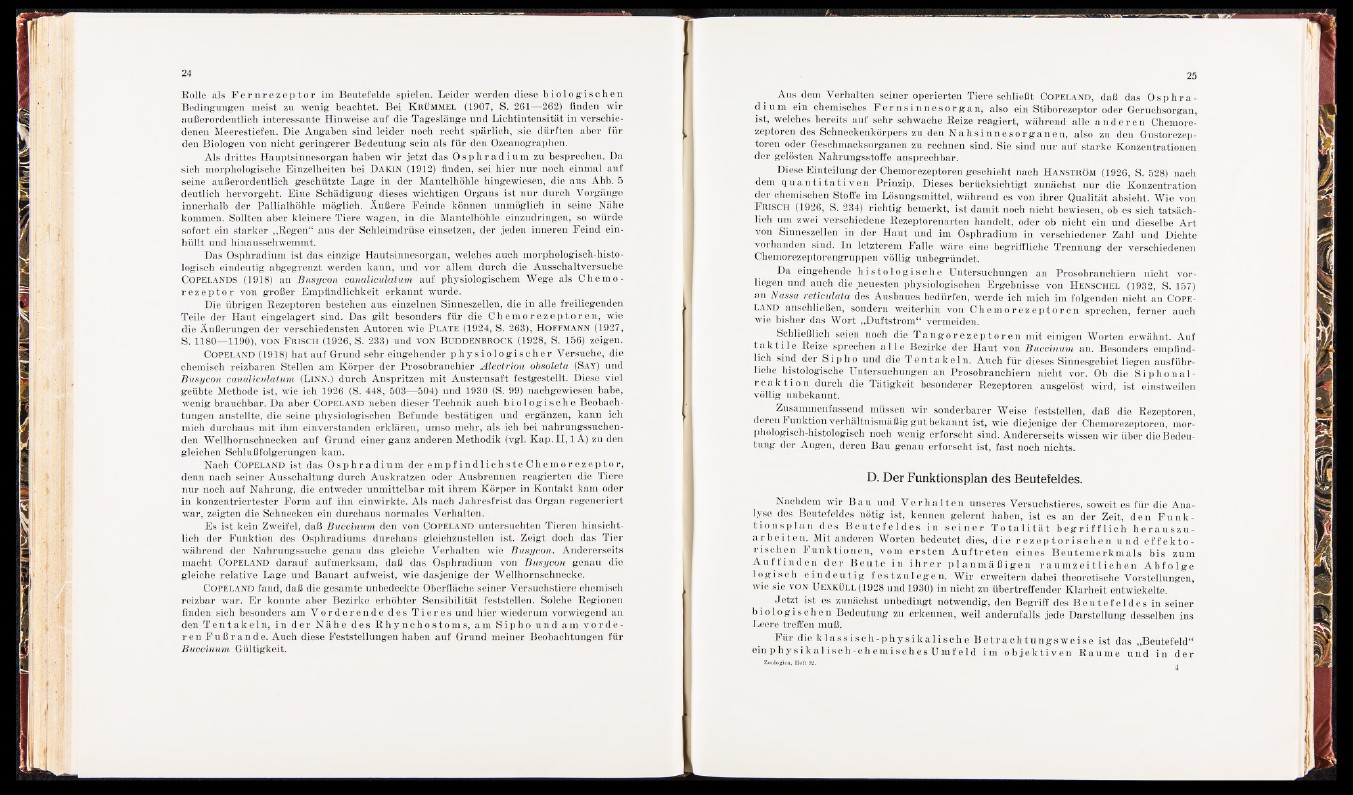
Rolle als F e r n r e z e p t o r im Beutefelde spielen. Leider werden diese b i o l o g i s c h e n
Bedingungen meist zu wenig beachtet. Bei K rümmel (1907, S. 261—262) finden wir
außerordentlich interessante Hinweise auf die Tageslänge und Lichtintensität in verschiedenen
Meerestiefen. Die Angaben sind leider noch recht spärlich, sie dürften aber für
den Biologen von nicht geringerer Bedeutung sein als für den Ozeanographen.
Als drittes Hauptsinnesorgan haben wir jetzt das O s p h r a d i um zu besprechen. Da
sich morphologische Einzelheiten bei Dakin (1912) finden, sei hier nur noch einmal auf
seine außerordentlich geschützte Lage in der Mantelhöhle hingewiesen, die aus Abb. 5
deutlich hervorgeht. Eine Schädigung dieses wichtigen Organs ist nur durch Vorgänge
innerhalb der Pallialhöhle möglich. Äußere Feinde können unmöglich in seine Nähe
kommen. Sollten aber kleinere Tiere wagen, in die Mantelhöhle einzudringen, so würde
sofort ein starker „Regen“ aus der Schleimdrüse einsetzen, der jeden inneren Feind einhüllt
und hinausschwemmt.
Das Osphradium ist das einzige Hautsinnesorgan, welches auch morphologisch-histologisch
eindeutig abgegrenzt werden kann, und vor allem durch die Ausschaltversuche
Copelands (1918) an Busycon canaliculatum auf physiologischem Wege als C h emo r
e z e p t o r von großer Empfindlichkeit erkannt wurde.
Die übrigen Rezeptoren bestehen aus einzelnen Sinneszellen, die in alle freiliegenden
Teile der Haut eingelagert sind. Das gilt besonders für die C h e m o r e z e p t o r e n , wie
die Äußerungen der verschiedensten Autoren wie P late (1924, S. 263), Hoffmann (1927,
S. 1180—1190), von F risch (1926, S. 233) und von Buddenbrook (1928, S. 156) zeigen.
Copeland (1918) hat auf Grund sehr eingehender p h y s i o l o g i s c h e r Versuche, die
chemisch reizbaren Stellen am Körper der Prosobranchier Alectrion obsoleta (Say) und
Busycon canaliculatum (Lin n .) durch Anspritzen mit Austernsaft festgestellt. Diese viel
geübte Methode ist, wie ich 1926 (S. 448, 503—504) und 1930 (S. 99) nachgewiesen habe,
wenig brauchbar. Da aber Copeland neben dieser Technik auch b i o l o g i s c h e Beobachtungen
anstellte, die seine physiologischen Befunde bestätigen und ergänzen, kann ich
mich durchaus mit ihm einverstanden erklären, umso mehr, als ich bei nahrungssuchenden
Wellhornschnecken auf Grund einer ganz anderen Methodik (vgl. Kap. II, 1A) zu den
gleichen Schlußfolgerungen kam.
Nach Copeland ist das Os p h r a d i um der emp f i n d l i c h s t eC h emo r e z e p t o r ,
denn nach seiner Ausschaltung durch Auskratzen oder Ausbrennen reagierten die Tiere
nur noch auf Nahrung, die entweder unmittelbar mit ihrem Körper in Kontakt kam oder
in konzentriertester Form auf ihn ein wirkte. Als nach Jahresfrist das Organ regeneriert
war, zeigten die Schnecken ein durchaus normales Verhalten.
Es ist kein Zweifel, daß Buccinum den von Copeland untersuchten Tieren hinsichtlich
der Funktion des Osphradiums durchaus gleichzustellen ist. Zeigt doch das Tier
während der Nahrungssuche genau das gleiche Verhalten wie Busycon. Andererseits
macht Copeland darauf aufmerksam, daß das Osphradium von Busycon genau die
gleiche relative Lage und Bauart auf weist, wie dasjenige der Wellhornschnecke.
Copeland fand, daß die gesamte unbedeckte Oberfläche seiner Versuchstiere chemisch
reizbar war. E r konnte aber Bezirke erhöhter Sensibilität feststellen. Solche Regionen
finden sich besonders am Vo r d e r e n d e des T i e r e s und hier wiederum vorwiegend an
den T e n t a k e l n , in d e r N ä h e des R h y n c h o s t om s , am S i p h o u n d am v o r d e r
e n F u ß r a n d e . Auch diese Feststellungen haben auf Grund meiner Beobachtungen für
Buccinum Gültigkeit.
Aus dem Verhalten seiner operierten Tiere schließt Copeland, daß das O s p h r a d
i um ein chemisches F e r n s i n n e s o r g a n , also ein Stiborezeptor oder Geruchsorgan,
ist, welches bereits auf sehr schwache Reize reagiert, während alle a n d e r e n Chemorezeptoren
des Schneckenkörpers zu den Na h s i n n e s o r g a n e n , also zu den Gustorezeptoren
oder Geschmacksorganen zu rechnen sind. Sie sind nur auf starke Konzentrationen
der gelösten Nahrungsstoffe ansprechbar.
Diese E inteilung der Chemorezeptoren geschieht nach H anström (1926, S. 528) nach
dem q u a n t i t a t i v e n Prinzip. Dieses berücksichtigt zunächst nur die Konzentration
der chemischen Stoffe im Lösungsmittel, während es von ihrer Qualität absieht. Wie von
F risci-i (1926, S. 234) richtig bemerkt, ist damit noch nicht bewiesen, ob es sich tatsächlich
um zwei verschiedene Rezeptorenarten handelt, oder ob nicht ein und dieselbe Art
von Sinneszellen in der Haut und im Osphradium in verschiedener Zahl und Dichte
vorhanden sind. In letzterem Falle wäre eine begriffliche Trennung der verschiedenen
Chemorezeptorengruppen völlig unbegründet.
Da eingehende h i s t o l o g i s c h e Untersuchungen an Prosobranchiern nicht vorliegen
und auch die neuesten physiologischen Ergebnisse von Henschel (1932, S. 157)
an Nassa reticulata des Ausbaues bedürfen, werde ich mich im folgenden nicht an Copeland
anschließen, sondern weiterhin von C h emo r e z e p t o r e n sprechen, ferner auch
wie bisher das Wort „Duftstrom“ vermeiden.
Schließlich seien noch die T a n g o r e z e p t o r e n mit einigen Worten erwähnt. Auf
t a k t i l e Reize sprechen a l l e Bezirke der Haut von Buccinum an. Besonders empfindlich
sind der Si p h o und die T e n t a k e l n . Auch für dieses Sinnesgebiet liegen ausführliche
histologische Untersuchungen an Prosobranchiern nicht vor. Ob die S i p h o n a l -
r e a k t i o n durch die Tätigkeit besonderer Rezeptoren ausgelöst wird, ist einstweilen
völlig unbekannt.
Zusammenfassend müssen wir sonderbarer Weise feststellen, daß die Rezeptoren,
deren Funktion verhältnismäßig gut bekannt ist, wie diejenige der Chemorezeptoren, morphologisch
histologisch noch wenig erforscht sind. Andererseits wissen wir über die Bedeutung
der Augen, deren Bau genau erforscht ist, fast noch nichts.
D. Der Funktionsplan des Beutefeldes.
Nachdem wir B a u und V e r h a l t e n unseres Versuchstieres, soweit es für die Analyse
des Beutefeldes nötig ist, kennen gelernt haben, ist es an der Zeit, d e n F u n k t
i o n s p l a n des B e u t e f e l d e s in s e i n e r T o t a l i t ä t b e g r i f f l i c h h e r a u s z u a
r b e i t e n . Mit anderen Worten bedeutet dies, d ie r e z e p t o r i s c h e n u n d e f f e k t o -
r i schen Funkt ionen, vom er s t en Auf t r e t e n eines Be ut eme r kma l s bis zum
A u f f i n d e n d e r B e u t e i n i h r e r p l a n m ä ß i g e n r a umz e i t l i c h e n Ab f o l g e
l o gi s c h e i n d e u t i g f e s t z u l e g e n . Wir erweitern dabei theoretische Vorstellungen,
wie sie von UexkÜll (1928 und 1930) in nicht zu übertreffender Klarheit entwickelte.
Jetzt ist es zunächst unbedingt notwendig, den Begriff des B e u t e f e l d e s in seiner
b i o l o g i s c h e n Bedeutung zu erkennen, weil andernfalls jede Darstellung desselben ins
Leere treffen muß.
F ür die k l a s s i s c h - p h y s i k a l i s c h e B e t r a c h t u n g sw e i s e ist das „Beutefeld“
e i n p h y s i k a l i s c h - c h emi s c h e sUmf e l d im o b j e k t i v e n R a ume u n d in de r
Zoologien, Heft 92.