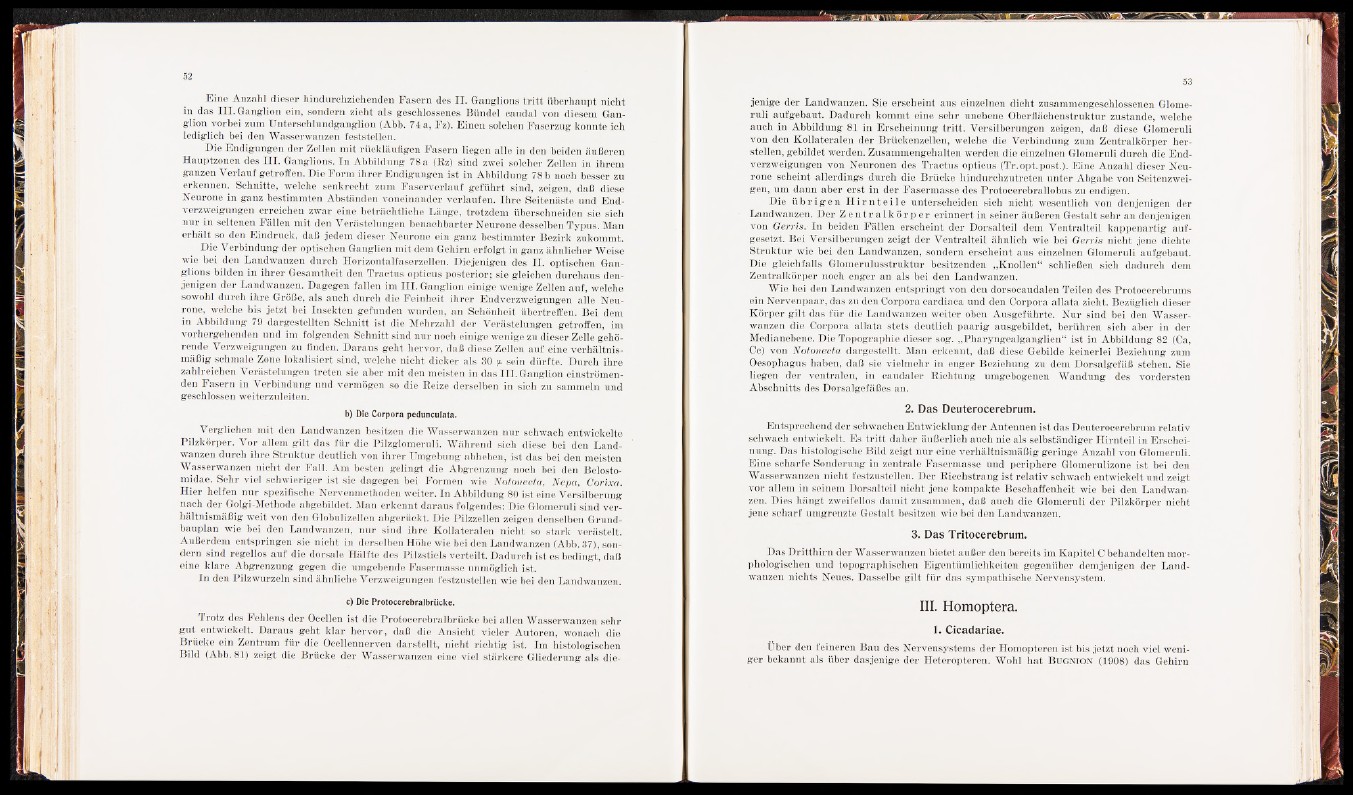
Eine Anzahl dieser hindurchziehenden Fasern des II. Ganglions tritt überhaupt nicht
in das III. Ganglion ein, sondern zieht als geschlossenes Bündel caudal von diesem Ganglion
vorbei zum Unterschlundganglion (Abb. 74 a, Fz). Einen solchen Faserzug konnte ich
lediglich bei den Wasserwanzen feststellen.
Die Endigungen der Zellen mit rückläufigen Fasern liegen alle in den beiden äußeren
Hauptzonen des III. Ganglions. In Abbildung 78 a (Hz) sind zwei solcher Zellen in ihrem
ganzen Verlauf getroffen. Die Form ihrer Endigungen ist in Abbildung 78 b noch besser zu
erkennen. Schnitte, welche senkrecht zum Faserverlauf geführt sind, zeigen, daß diese
Neurone in ganz bestimmten Abständen voneinander verlaufen. Ihre Seitenäste und Endverzweigungen
erreichen zwar eine beträchtliche Länge, trotzdem überschneiden sie sich
nur in seltenen Fällen mit den Verästelungen benachbarter Neurone desselben Typus. Man
erhält so den Eindruck, daß jedem dieser Neurone ein ganz bestimmter Bezirk zukommt.
Die Verbindung der optischen Ganglien mit dem Gehirn erfolgt in ganz ähnlicher Weise
wie bei den Landwanzen durch Horizontalfaserzellen. Diejenigen des II. optischen Ganglions
bilden in ihrer Gesamtheit den Tractus opticus posterior; sie gleichen durchaus denjenigen
der Landwanzen. Dagegen fallen im III. Ganglion einige wenige Zellen auf, welche
sowohl durch ihre Größe, als auch durch die Feinheit ihrer Endverzweigungen alle Neurone,
welche bis jetzt bei Insekten gefunden wurden, an Schönheit übertreffen. Bei dem
in Abbildung 79 dargestellten Schnitt ist die Mehrzahl der Verästelungen getroffen, im
vorhergehenden und im folgenden Schnitt sind nur noch einige wenige zu dieser Zelle gehörende
Verzweigungen zu finden. Daraus geht hervor, daß diese Zellen auf eine verhältnismäßig
schmale Zone lokalisiert sind, welche nicht dicker als 30 ¡r sein dürfte. Durch ihre
zahlreichen Verästelungen treten sie aber mit den meisten in das III. Ganglion einströmenden
Fasern in Verbindung und vermögen so die Beize derselben in sieh zu sammeln und
geschlossen weiterzuleiten.
b) Die Corpora pedunculata.
Verglichen mit den Landwanzen besitzen die Wasserwanzen nu r schwach entwickelte
Pilzkörper. Vor allem gilt das für die Pilzglomeruli. Während sich diese bei den Landwanzen
durch ihre S truktur deutlich von ihrer Umgebung abheben, ist das bei den meisten
Wasserwanzen nicht der Fall. Am besten gelingt die Abgrenzung noch bei den Belosto-
midäe. Sehr viel schwieriger ist sie dagegen bei Formen wie Notonecta, Nepa, Corixa.
Hier helfen nur spezifische Nervenmethoden weiter. In Abbildung 80 ist eine Versilberung
nach der Golgi-Methode abgebildet. Man erkennt daraus folgendes: Die Glomeruli sind verhältnismäßig
weit von den Globulizellen abgeriickt. Die Pilzzellen zeigen denselben Grundbauplan
wie bei den Landwanzen, nur sind ihre Kollateralen nicht so stark verästelt.
Außerdem entspringen sie nicht in derselben Höhe wie bei den Landwanzen (Abb. 37), sondern
sind regellos auf die dorsale Hälfte des Pilzstiels verteilt. Dadurch ist es bedingt, daß
eine klare Abgrenzung gegen die umgebende Fasermasse unmöglich ist.
In den Pilzwurzeln sind ähnliche Verzweigungen festzustellen wie bei den Landwanzen.
c) Die Protocerebralbriicke.
Trotz des Fehlens der Ocellen ist die Protocerebralbrücke bei allen Wasserwanzen sehr
gut entwickelt. Daraus geht klar hervor, daß die Ansicht vieler Autoren, wonach die
Brücke ein Zentrum für die Ocellennerven darstellt, nicht richtig ist. Im histologischen
Bild (Abb. 81) zeigt die Brücke der Wasserwanzen eine viel stärkere Gliederung als diejenige
der Landwanzen. Sie erscheint aus einzelnen dicht zusammengeschlossenen Glomeruli
aufgebaut. Dadurch kommt eine sehr unebene Oberflächenstruktur zustande, welche
auch in Abbildung 81 in Erscheinung tritt. Versilberungen zeigen, daß diese Glomeruli
von den Kollateralen der Brückenzellen, welche die Verbindung zum Zentralkörper hersteilen,
gebildet werden. Zusammengehalten werden die einzelnen Glomeruli durch die Endverzweigungen
von Neuronen des Tractus opticus (Tr.opt.post.). Eine Anzahl dieser Neurone
scheint allerdings durch die Brücke hindurchzutreten unter Abgabe von Seitenzweigen,
um dann aber erst in der Fasermasse des Protoeerebrallobus zu endigen.
Die ü b r i g e n H i r n t e i l e unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen der
Landwanzen. Der Z e n t r a l k ö r p e r erinnert in seiner äußeren Gestalt sehr an denjenigen
von Gerris. In beiden Fällen erscheint der Dorsalteil dem Ventralteil kappenartig aufgesetzt.
Bei Versilberungen zeigt der Ventralteil ähnlich wie bei Gerris nicht jene dichte
Struktur wie bei den Landwanzen, sondern erscheint aus einzelnen Glomeruli aufgebaut.
Die gleichfalls Glomerulusstruktur besitzenden „Knollen“ schließen sich dadurch dem
Zentralkörper noch enger an als bei den Landwanzen.
Wie bei den Landwanzen entspringt von den dorsocaudalen Teilen des Protocerebrums
ein Nervenpaar, das zu den Corpora cardiaca und den Corpora allata zieht. Bezüglich dieser
Körper gilt das für die Landwanzen weiter oben Ausgeführte. Nur sind hei den Wasserwanzen
die Corpora allata stets deutlich paarig ausgebildet, berühren Sich aber in der
Medianebene. Die Topographie dieser sog. „Pharyngealganglien“ ist in Abbildung 82 (Ca,
C a| von Notonecta dargestellt. Man erkennt, daß diese Gebilde keinerlei Beziehung zum
Oesophagus haben, daß sie vielmehr in enger Beziehung zu dem Dorsalgefäß stehen. Sie
liegen der ventralen, in caudaler Bichtung umgebogenen Wandung des vordersten
Abschnitts des Dorsalgefäßes an.
2. Das Deuterocerebrum.
Entsprechend der schwachen Entwicklung der Antennen ist das Deuterocerebrum relativ
schwach entwickelt. Es tritt daher äußerlich auch nie als selbständiger Hirnteil in Erscheinung.
Das histologische Bild zeigt nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Glomeruli.
Eine scharfe Sonderung in zentrale Fasermasse und periphere Glomerulizone ist bei den
Wasserwanzen nicht festzustellen. Der Biechstrang ist relativ schwach entwickelt und zeigt
vor allem in seinem Dorsalteil nicht jene kompakte Beschaffenheit wie bei den Landwanzen.
Dies hängt zweifellos damit zusammen, daß auch die Glomeruli der Pilzkörper nicht
jene scharf umgrenzte Gestalt besitzen wie bei den Landwanzen.
3. Das Tritocerebrum.
Das Dritthirn der Wasserwanzen bietet außer den bereits im Kapitel C behandelten morphologischen
und topographischen Eigentümlichkeiten gegenüber demjenigen der Landwanzen
nichts Neues. Dasselbe gilt für das sympathische Nervensystem,
III. Homoptera.
1. Cicadariae.
Uber den feineren Bau des Nervensystems der Homopteren ist bis jetzt noch viel weniger
bekannt als über dasjenige der Heteropteren. Wohl hat Bugnion (1908) das Gehirn