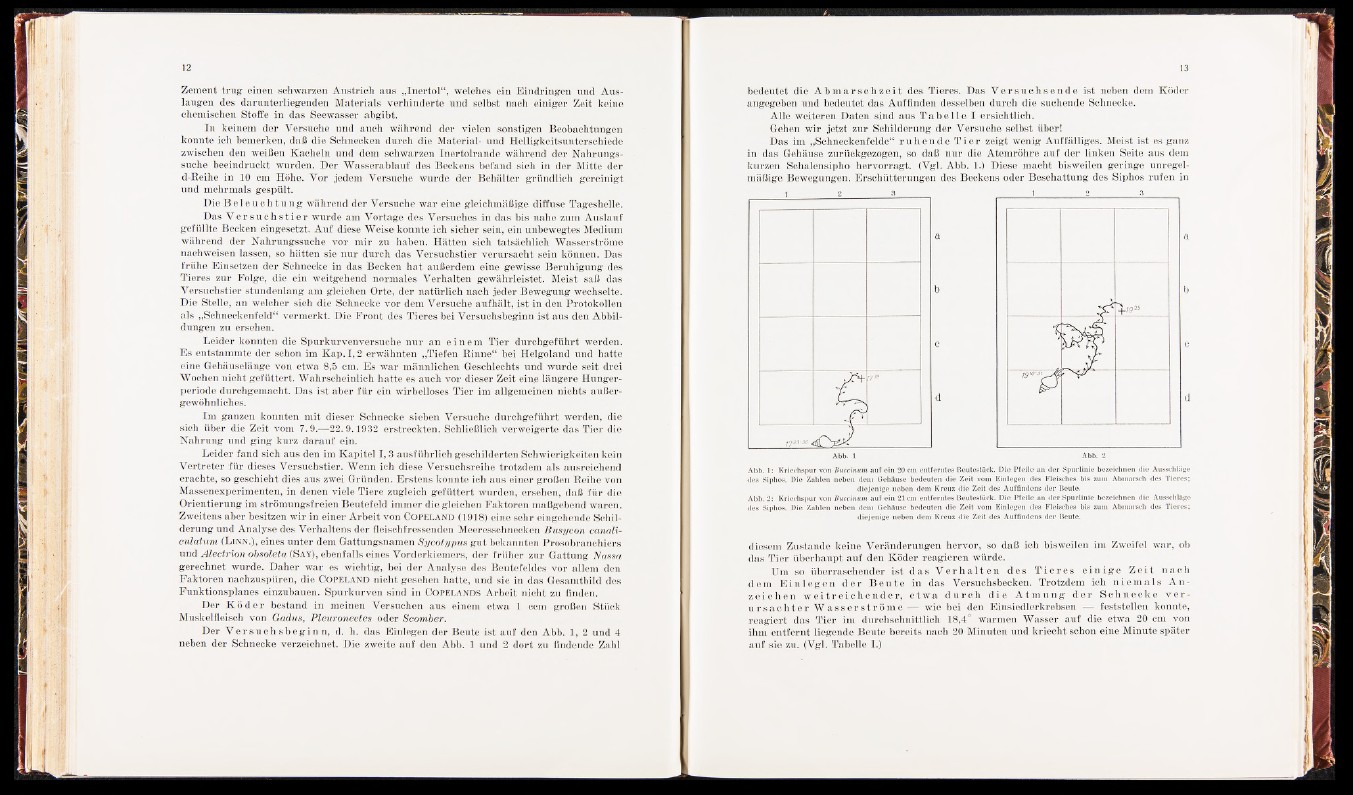
Zement trug einen schwarzen Anstrich aus „Inertol“, welches ein Eindringen und Auslaugen
des darunterliegenden Materials verhinderte und selbst nach einiger Zeit keine
chemischen Stoffe in das Seewasser abgibt.
In keinem der Versuche und auch während der vielen sonstigen Beobachtungen
konnte ich bemerken, daß die Schnecken durch die Material- und Helligkeitsunterschiede
zwischen den weißen Kacheln und dem schwarzen Inertolrande während der Nahrungssuche
beeindruckt wurden. Der Wasserablauf des Beckens befand sich in der Mitte der
d-Reihe in 10 cm Höhe. Vor jedem Versuche wurde der Behälter gründlich gereinigt
und mehrmals gespült.
Die B e l e u c h t u n g während der Versuche war eine gleichmäßige diffuse Tageshelle.
Das V e r s u c h s t i e r wurde am Vortage des Versuches in das bis nahe zum Auslauf
gefüllte Becken eingesetzt. Auf diese Weise konnte ich sicher sein, ein unbewegtes Medium
während der Nahrungssuche vor mir zu haben. Hätten sich tatsächlich Wasserströme
nachweisen lassen, so hätten sie nur durch das Versuchstier verursacht sein können. Das
frühe Einsetzen der Schnecke in das Becken ha t außerdem eine gewisse Beruhigung des
Tieres zur Folge, die ein weitgehend normales Verhalten gewährleistet. Meist saß das
Versuchstier stundenlang am gleichen Orte, der natürlich nach jeder Bewegung wechselte.
Die Stelle, an welcher sich die Schnecke vor dem Versuche aufhält, ist in den Protokollen
als „Schneckenfeld“ vermerkt. Die Front des Tieres bei Versuchsbeginn ist aus den Abbildungen
zu ersehen.
Leider konnten die Spurkurvenversuche nur an e i n e m Tier durchgeführt werden.
Es entstammte der schon im Kap. 1 ,2 erwähnten „Tiefen Rinne“ bei Helgoland und hatte
eine Gehäuselänge von etwa 8,5 cm. Es war männlichen Geschlechts und wurde seit drei
Wochen nicht gefüttert. Wahrscheinlich hatte es auch vor dieser Zeit eii\e längere Hungerperiode
durchgemacht. Das ist aber für ein wirbelloses Tier im allgemeinen nichts außergewöhnliches.
Im ganzen konnten mit dieser Schnecke sieben Versuche durchgeführt werden, die
sich über die Zeit vom 7.9.—22.9.1932 erstreckten. Schließlich verweigerte das Tier die
Nahrung und ging kurz darauf ein.
Leider fand sich aus den im Kapitel 1,3 ausführlich geschilderten Schwierigkeiten kein
Vertreter für dieses Versuchstier. Wenn ich diese Versuchsreihe trotzdem als ausreichend
erachte, so geschieht dies aus zwei Gründen. Erstens konnte ich aus einer großen Reihe von
Massenexperimenten, in denen viele Tiere zugleich gefüttert wurden, ersehen, daß für die
Orientierung im strömungsfreien Beutefeld immer die gleichen Faktoren maßgebend waren.
Zweitens aber besitzen wir in einer A rbeit von Copeland (1918) eine sehr eingehende Schilderung
und Analyse des Verhaltens der fleischfressenden Meeresschnecken Busycon canali-
cülatum (Linn.), eines unter dem Gattungsnamen Sycotypus gut bekannten Prosobranchiers
und Alectrion obsoleta (Say), ebenfalls eines Vorderkiemers, der früher zur Gattung Nassa
gerechnet wurde. Daher war es wichtig, bei der Analyse des Beutefeldes vor allem den
Faktoren nachzuspüren, die Copeland nicht gesehen hatte, und sie in das Gesamtbild des
Funktionsplanes einzubauen. Spurkurven sind in Copelands Arbeit nicht zu finden.
Der K ö d e r bestand in meinen Versuchen aus einem etwa 1 ccm großen Stück
Muskelfleisch von Gadus, Pleuronectes oder Scomber.
Der V e r s u c h s b e g i n n , d. h. das Einlegen der Beute ist auf den Abb. 1, 2 und 4
neben der Schnecke verzeichnet. Die zweite auf den Abb. 1 und 2 dort zu findende Zahl
bedeutet die A bm a r s c h z e i t des Tieres. Das V e r s u c h s e n d e ist neben dem Köder
angegeben und bedeutet das Auffinden desselben durch die suchende Schnecke.
Alle weiteren Daten sind aus T a b e l l e I ersichtlich.
Gehen wir jetzt zur Schilderung der Versuche selbst über!
Das im „Schneckenfelde“ r u h e n d e T i e r zeigt wenig Auffälliges. Meist ist es ganz
in das Gehäuse zurückgezogen, so daß nur die Atemröhre auf der linken Seite aus dem
kurzen Schalensipho hervorragt. (Vgl. Abb. 1.) Diese macht bisweilen geringe unregelmäßige
Bewegungen. Erschütterungen des Beckens oder Beschattung des Siphos rufen in
Abb. 1: Kriechspur von Buccinum auf ein 20 cm entferntes Beutestück. Die Pfeile an der Spurlinie bezeichnen die Ausschläge
des Siphos. Die Zahlen neben dem Gehäuse bedeuten die Zeit vom Einlegen des Fleisches bis zum Abmarsch des Tieres;
diejenige neben dem Kreuz die Zeit des Auffindens der Beute.
Abb. 2: Kriechspur von Buccinum auf ein 21 cm entferntes Beutestück. Die Pfeile an der Spurlinie bezeichnen die Ausschläge
des Siphos. Die Zahlen neben dem Gehäuse bedeuten die Zeit vom Einlegen des Fleisches bis zum Abmarsch des Tieres;
diejenige neben dem Kreuz die Zeit des Auffindens der Beute.
diesem Zustande keine Veränderungen hervor, so daß ich bisweilen im Zweifel war, ob
das Tier überhaupt auf den Köder reagieren würde.
Um so überraschender ist d a s V e r h a l t e n des T i e r e s e i n i g e Ze i t n a ch
dem E i n l e g e n d e r B e u t e in das Versuchsbecken. Trotzdem ich n i e m a l s A n z
e i c h e n we i t r e i c h e n d e r , e t w a d u r c h d i e A tm u n g d e r S c h n e c k e v e r u
r s a c h t e r W a s s e r s t r öme — wie bei den Einsiedlerkrebsen S - feststellen konnte,
reagiert das Tier im durchschnittlich 18,4° warmen Wasser auf die etwa 20 cm von
ihm entfernt liegende Beute bereits nach 20 Minuten und kriecht schon eine Minute später
auf sie zu. (Vgl. Tabelle I.)