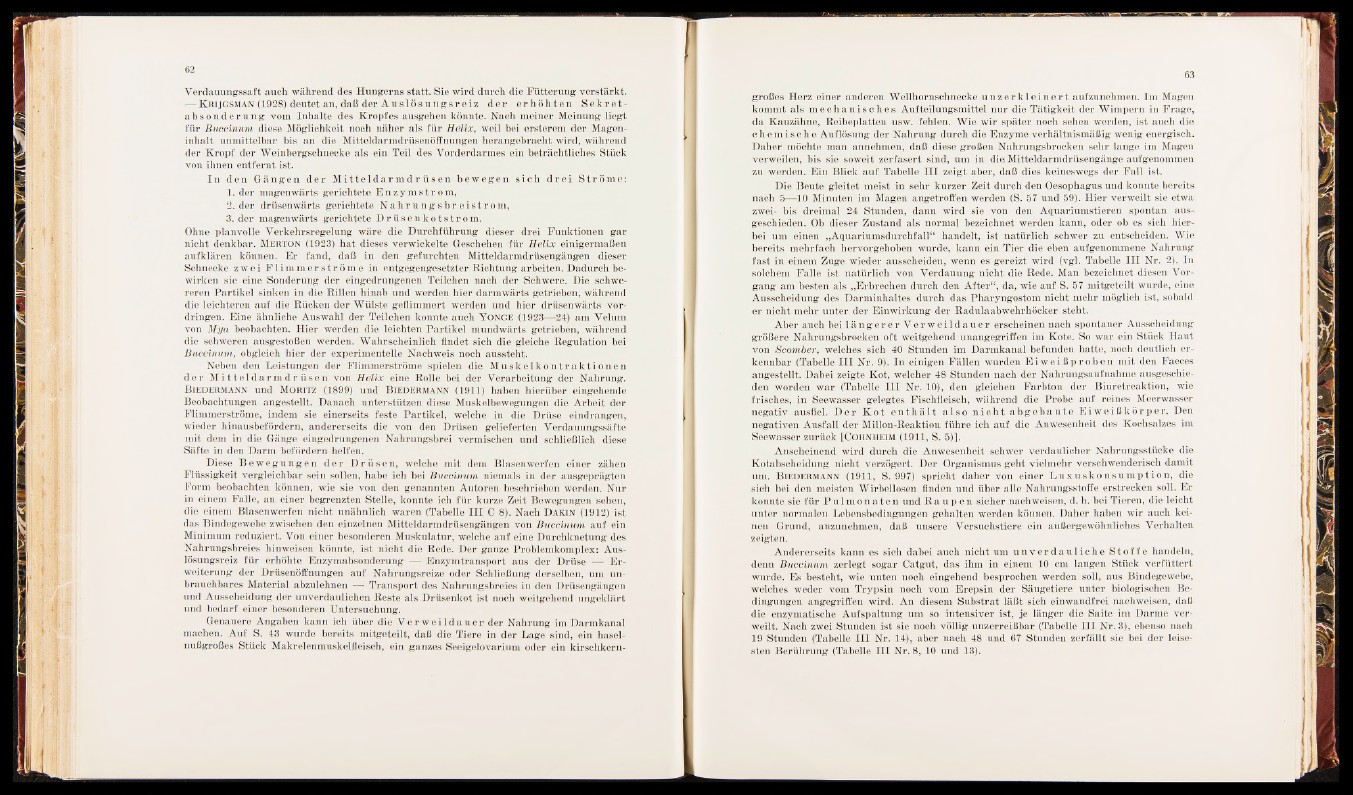
Verdauungssaft auch während des Hunger ns statt. Sie wird durch die Fütterung verstärkt.
— Krijgsman (1928) deutet an, daß der A u s l ö s u n g s r e i z d e r e r h ö h t e n S e k r e t a
b s o n d e r u n g vom Inhalte des Kropfes ausgehen könnte. Nach meiner Meinung liegt
für Buccinum diese Möglichkeit noch näher als für Helix, weil bei ersterem der Mageninhalt
unmittelbar bis an die Mitteldarmdrüsenöffnungen herangebracht wird, während
der Kropf der Weinbergschnecke als ein Teil des Vorderdarmes ein beträchtliches Stück
von ihnen entfernt ist.
I n d e n G ä n g e n d e r M i t t e l d a rm d r ü s e n b e w e g e n s i ch d r e i S t r ö me :
1. der magenwärts gerichtete E n z yms t r om ,
2. der drüsenwärts gerichtete N a h r u n g s b r e i s t r om ,
3. der magenwärts gerichtete Dr ü s e n k o t s t r om.
Ohne planvolle Verkehrsregelung wäre die Durchführung dieser drei Funktionen gar
nicht denkbar. Merton (1923) hat dieses verwickelte Geschehen für Helix einigermaßen
aufklären können. E r fand, daß in den gefurchten Mitteldarmdrüsengängen dieser
Schnecke zwei F l im m e r s t r öm e in entgegengesetzter Richtung arbeiten. Dadurch bewirken
sie eine Sonderung der eingedrungenen Teilchen nach der Schwere. Die schwereren
Partikel sinken in die Rillen hinab und werden hier darmwärts getrieben, während
die leichteren auf die Rücken der Wülste geflimmert werden und hier drüsenwärts Vordringen.
Eine ähnliche Auswahl der Teilchen konnte auch Yonge (1923—24) am Velum
von Mya beobachten. Hier werden die leichten Partikel mundwärts getrieben, während
die schweren ausgestoßen werden. Wahrscheinlich findet sich die gleiche Regulation bei
Buccinum, obgleich hier der experimentelle Nachweis noch aussteht.
Neben den Leistungen der Flimmerströme spielen die Mu s k e l k o n t r a k t i o n e n
d e r M i t t e l d a rm d r ü s e n von Helix eine Rolle bei der Verarbeitung der Nahrung.
Biedermann und Moritz (1899) und Biedermann (1911) haben hierüber eingehende
Beobachtungen angestellt. Danach unterstützen diese Muskelbewegungen die Arbeit der
Flimmerströme, indem sie einerseits feste Partikel, welche in die Drüse eindrangen,
wieder hinausbefördern, andererseits die von den Drüsen gelieferten Verdauungssäfte
mit dem in die Gänge eingedrungenen Nahrungsbrei vermischen und schließlich diese
Säfte in den Darm befördern helfen.
Diese B ewe g u n g e n d e r Dr ü s e n , welche mit dem Blasenwerfen einer zähen
Flüssigkeit vergleichbar sein sollen, habe ich bei Buccinum niemals in der ausgeprägten
Form beobachten können, wie sie von den genannten Autoren beschrieben werden. Nur
in einem Falle, an einer begrenzten Stelle, konnte ich für kurze Zeit Bewegungen sehen,
die einem Blasenwerfen nicht unähnlich waren (Tabelle I I I C 8). Nach Darin (1912) ist
das Bindegewebe zwischen den einzelnen Mitteldarmdrüsengängen von Buccinum auf ein
Minimum reduziert. Von einer besonderen Muskulatur, welche auf eine Durchknetung des
Nahrungsbreies hin weisen könnte, ist nicht die Rede. Der ganze Problemkomplex: Auslösungsreiz
für erhöhte Enzymabsonderung *4*- Enzymtransport aus der Drüse — E rweiterung
der Drüsenöffnungen auf Nahrungsreize oder Schließung derselben, um unbrauchbares
Material abzulehnen — Transport des Nahrungsbreies in den Drüsengängen
und Ausscheidung der unverdaulichen Reste als Drüsenkot ist noch weitgehend ungeklärt
und bedarf einer besonderen Untersuchung.
Genauere Angaben kann ich über die V e rw e i l d a u e r der Nahrung im Darmkanal
machen. Auf S. 43 wurde bereits mitgeteilt, daß die Tiere in der Lage sind, ein haselnußgroßes
Stück Makrelenmuskelfleisch, ein ganzes Seeigelovarium oder ein kirschkerngroßes
Herz einer anderen Wellhornschnecke u n z e r k l e i n e r t aufzunehmen. Im Magen
kommt als me c h a n i s c h e s Aufteilungsmittel nur die Tätigkeit der Wimpern in Frage,
da Kauzähne, Reibeplatten usw. fehlen. Wie wir später noch sehen werden, ist auch die
c h e m i s c h e Auflösung der Nahrung durch die Enzyme verhältnismäßig wenig energisch.
Daher möchte man annehmen, daß diese großen Nahrungsbrocken sehr lange im Magen
verweilen, bis sie soweit zerfasert sind, um in die Mitteldarmdrüsengänge aufgenommen
zu werden. Ein Blick auf Tabelle I I I zeigt aber, daß dies keineswegs der Fall ist.
Die Beute gleitet meist in sehr kurzer Zeit durch den Oesophagus und konnte bereits
nach 5—-10 Minuten im Magen angetroffen werden (S. 57 und 59). Hier verweilt sie etwa
zwei- bis dreimal 24 Stunden, dann wird sie von den Aquariumstieren spontan ausgeschieden.
Ob dieser Zustand als normal bezeichnet werden kann, oder ob es sich hierbei
um einen „Aquariumsdurchfall“ handelt, ist natürlich schwer zu entscheiden. Wie
bereits mehrfach hervorgehoben wurde, kann ein Tier die eben auf genommene Nahrung
fast in einem Zuge wieder ausscheiden, wenn es gereizt wird (vgl. Tabelle I I I Nr. 2). In
solchem Falle ist natürlich von Verdauung nicht die Rede. Man bezeichnet diesen Vorgang
am besten als „Erbrechen durch den After“, da, wie auf S. 57 mitgeteilt wurde, eine
Ausscheidung des Darminhaltes durch das Pharyngostom nicht mehr möglich ist, sobald
er nicht mehr unter der Einwirkung der Radulaabwehrhöcker steht.
Aber auch bei l ä n g e r e r V e rw e i l d a u e r erscheinen nach spontaner Ausscheidung
größere Nahrungsbrocken oft weitgehend unangegriffen im Kote. So war ein Stück Haut
von Scomber, welches sich 40 Stunden im Darmkanal befunden hatte, noch deutlich erkennbar
(Tabelle I I I Nr. 9). In einigen Fällen wurden E iw e i ß p r o b e n mit den Faeces
angestellt. Dabei zeigte Kot, welcher 48 Stunden nach der Nahrungsaufnahme ausgeschieden
worden war (Tabelle I I I Nr. 10), den gleichen Farbton der Biuretreaktion, wie
frisches, in Seewasser gelegtes Fischfleisch, während die Probe auf reines Meerwasser
negativ ausfiel. D e r K o t e n t h ä l t a l s o n i c h t a b g e b a u t e E i w e i ß k ö r p e r . Den
negativen Ausfall der Millon-Reaktion führe ich auf die Anwesenheit des Kochsalzes im
Seewasser zurück [Cohnheim (1911, S. 5)].
Anscheinend wird durch die Anwesenheit schwer verdaulicher Nahrungsstücke die
Kotabscheidung nicht verzögert. Der Organismus geht vielmehr verschwenderisch damit
um. Biedermann (1911, S. 997) spricht daher von einer L u x u s k o n s ump t i o n , die
sich bei den meisten Wirbellosen finden und über alle Nahrungsstoffe erstrecken soll. Er
konnte sie für P u lm o n a t e n und R a u p e n sicher nachweisen, d. h. bei Tieren, die leicht
unter normalen Lebensbedingungen gehalten werden können. Daher haben wir auch keinen
Grund, anzunehmen, daß unsere Versuchstiere ein außergewöhnliches Verhalten
zeigten.
Andererseits kann es sich dabei auch nicht um u n v e r d a u l i c h e S t o f f e handeln,
denn Buccinum zerlegt sogar Catgut, das ihm in einem 10 cm langen Stück verfüttert
wurde. Es besteht, wie unten noch eingehend besprochen werden soll, aus Bindegewebe,
welches weder vom Trypsin noch vom Erepsin der Säugetiere unter biologischen Bedingungen
angegriffen wird. An diesem Substrat läßt sich einwandfrei nachweisen, daß
die enzymatische Aufspaltung um so intensiver ist, je länger die Saite im Darme verweilt.
Nach zwei Stunden ist sie noch völlig unzerreißbar (Tabelle I I I Nr. 3), ebenso nach
19 Stunden (Tabelle I I I Nr. 14), aber nach 48 und 67 Stunden zerfällt sie bei der leisesten
Berührung (Tabelle I I I Nr. 8, 10 und 13).