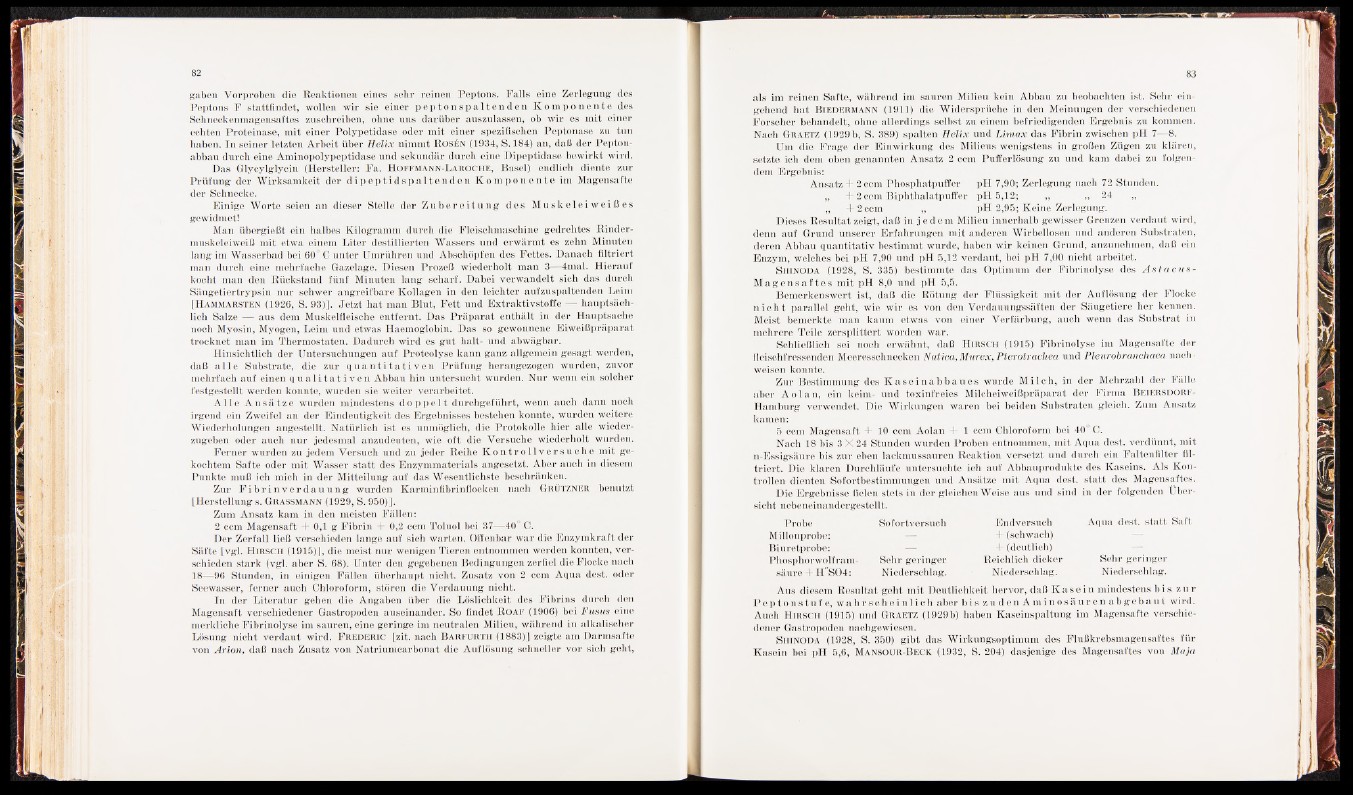
gaben Vorproben die Reaktionen eines sehr reinen Peptons. Falls eine Zerlegung des
Peptons F stattfindet, wollen wir sie einer p e p t o n s p a l t e n d e n K om p o n e n t e des
Schneckenmagensaftes zuschreiben, ohne uns darüber auszulassen, ob wir es mit einer
echten Proteinase, mit einer Polypetidase oder mit einer spezifischen Peptonase zu tun
haben. In seiner letzten Arbeit über Helix nimmt Ros£n (1934, S. 184) an, daß der Peptonabbau
durch eine Aminopolypeptidase und sekundär durch eine Dipeptidase bewirkt wird.
Das Glycylglycin (Hersteller: Fa. Hoffmann-Laroche, Basel) endlich diente zur
Prüfung der Wirksamkeit der d i p e p t i d s p a l t e n d e n K om p o n e n t e im Magensafte
der Schnecke.
Einige Worte seien an dieser Stelle der Z u b e r e i t u n g des Mu s k e l e i w e i ß e s
gewidmet!
Man übergießt ein halbes Kilogramm durch die Fleischmaschine gedrehtes Rindermuskeleiweiß
mit etwa einem Liter destillierten Wassers und erwärmt es zehn Minuten
lang im Wasserbad bei 60° C unter Umrühren und Abschöpfen des Fettes. Danach filtriert
man durch eine mehrfache Gazelage. Diesen Prozeß wiederholt man 3—4mal. Hierauf
kocht man den Rückstand fünf Minuten lang scharf. Dabei verwandelt sich das durch
Säugetiertrypsin nur schwer angreifbare Kollagen in den leichter aufzuspaltenden Leim
[Hammarsten (1926, S. 93)]. Jetzt hat man Blut, Fett und Extraktivstoffe — hauptsächlich
Salze — aus dem Muskelfleische entfernt. Das P räp a ra t enthält in der Hauptsache
noch Myosin, Myogen, Leim und etwas Haemoglobin. Das so gewonnene Eiweißpräparat
trocknet man im Thermostaten. Dadurch wird es gut halt- und abwägbar.
Hinsichtlich der Untersuchungen auf Proteolyse kann ganz allgemein gesagt werden,
daß a l l e Substrate, die zur q u a n t i t a t i v e n Prüfung herangezogen wurden, zuvor
mehrfach auf einen q u a l i t a t i v e n Abbau hin untersucht wurden. Nur wenn ein solcher
festgestellt werden konnte, wurden sie weiter verarbeitet.
Al l e A n s ä t z e wurden mindestens d o p p e l t durchgeführt, wenn auch dann noch
irgend ein Zweifel an der Eindeutigkeit des Ergebnisses bestehen konnte, wurden weitere
Wiederholungen angestellt. Natürlich ist es unmöglich, die Protokolle hier alle wiederzugeben
oder auch nur jedesmal anzudeuten, wie oft die Versuche wiederholt wurden.
Ferner wurden zu jedem Versuch und zu jeder Reihe K o n t r o l l v e r s u c h e mit gekochtem
Safte oder mit Wasser statt des Enzymmaterials angesetzt. Aber auch in diesem
Punkte muß ich mich in der Mitteilung auf das Wesentlichste beschränken.
Zur F i b r i n v e r d a u u n g wurden Karminfibrinflocken nach GRÜTZNER benutzt
[Herstellung s. Grassmann (1929, S. 950)].
Zum Ansatz kam in den meisten Fällen:
2 ccm Magensaft + 0,1 g Fibrin + 0,2 ccm Toluol bei 37—40° C.
Der Zerfall ließ verschieden lange auf sich warten. Offenbar war die Enzymkraft der
Säfte [vgl. H irsch (1915)], die meist nur wenigen Tieren entnommen werden konnten, verschieden
stark (vgl. aber S. 68). Unter den gegebenen Bedingungen zerfiel die Flocke nach
18—96 Stunden, in einigen Fällen überhaupt nicht. Zusatz von 2 ccm Aqua dest. oder
Seewasser, ferner auch Chloroform, stören die Verdauung nicht.
In der Literatur gehen die Angaben über die Löslichkeit des Fibrins durch den
Magensaft verschiedener Gastropoden auseinander. So findet Roaf (1906) bei Fusus eine
merkliche Fibrinolyse im sauren, eine geringe im neutralen Milieu, während in alkalischer
Lösung nicht verdaut wird. F rederic [zit. nach Barfurtii (1883)] zeigte am Darmsafte
von Arion, daß nach Zusatz von Natriumcarbonat die Auflösung schneller vor sich geht,
als im reinen Safte, während im sauren Milieu kein Abbau zu beobachten ist. Sehr eingehend
hat B i e d e r m a n n (1911) die Widersprüche in den Meinungen der verschiedenen
Forscher behandelt, ohne allerdings selbst zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen.
Nach G r a e t z (1929 b, S. 389) spalten Helix und Limax das Fibrin zwischen pH 7—8.
Um die Frage der Einwirkung des Milieus wenigstens in großen Zügen zu klären,
setzte ich dem oben genannten Ansatz 2 ccm Pufferlösung zu und kam dabei zu folgendem
Ergebnis:
Ansatz + 2 ccm Phosphatpuffer pH 7,90; Zerlegung nach 72 Stunden.
„ + 2 ccm Biphthalatpuffer pH 5,12; „ 24 „
„ + 2 ccm „ pH 2,95; Keine Zerlegung.
Dieses Resultat zeigt, daß in j e d em Milieu innerhalb gewisser Grenzen verdaut wird,
denn auf Grund unserer Erfahrungen mit anderen Wirbellosen und anderen Substraten,
deren Abbau quantitativ bestimmt wurde, haben wir keinen Grund, anzunehmen, daß ein
Enzym, welches bei pH 7,90 und pH 5,12 verdaut, bei pH 7,00 nicht arbeitet.
S h i n o d a (1928, S. 335) bestimmte das Optimum der Fibrinolyse des A s t a c u s -
Ma g e n s a f t e s mit pH 8,0 und pH 5,5.
Bemerkenswert ist, daß die Rötung der Flüssigkeit mit der Auflösung der Flocke
n i c h t parallel geht, wie wir es von den Verdauungssäften der Säugetiere her kennen.
Meist bemerkte man kaum etwas von einer Verfärbung, auch wenn das Substrat in
mehrere Teile zersplittert worden war.
Schließlich sei noch erwähnt, daß H i r s c h (1915) Fibrinolyse im Magensafte der
fleischfressenden Meeresschnecken Natica, Mur ex, Pterotrachea und Pleurobranchaea nach-
weisen konnte.
Zur Bestimmung des K a s e i n a b b a u e s wurde Mi l ch, in der Mehrzahl der Fälle
aber A o 1 a n, ein keim- und toxinfreies Milcheiweißpräparat der Firma BEIERSDORF-
Hamburg verwendet. Die Wirkungen waren bei beiden Substraten gleich. Zum Ansatz
kamen:
5 ccm Magensaft + 1 0 ccm Aolan + 1 ccm Chloroform bei 40° C.
Nach 18 bis 3 X 24 Stunden wurden Proben entnommen, mit Aqua dest. verdünnt, mit
n-Essigsäure bis zur eben lackmussauren Reaktion versetzt und durch ein Faltenfilter filtriert.
Die klaren Durchläufe untersuchte ich auf Abbauprodukte des Kaseins. Als Kontrollen
dienten Sofortbestimmungen und Ansätze mit Aqua dest. sta tt des Magensaftes.
Die Ergebnisse fielen stets in der gleichen Weise aus und sind in der folgenden Übersicht
nebeneinandergestellt.
Probe Sofortversuch Endversuch Aqua dest. sta tt Saft
Milionprobe: — + (schwach)
Biuretprobe: — + (deutlich)
Phosphorwolfram- Sehr geringer Reichlich dicker Sehr geringer
s ä u re+ H S 0 4 : Niederschlag. Niederschlag. Niederschlag.
Aus diesem Resultat geht mit Deutlichkeit hervor, daß K a s e i n mindestens b i s z u r
P e p t o n s t u f e , w a h r s c h e i n l i c h aber b i s z u d e n Ami n o s ä u r e n a b g e b a u t wird.
Auch H i r s c h (1915) und G r a e t z (1929 b) haben Kaseinspaltung im Magensafte verschiedener
Gastropoden nachgewiesen.
S h i n o d a (1928, S. 350) gibt das Wirkungsoptimum des Flußkrebsmagensaftes für
Kasein bei pH 5,6, M a n s o u r - B e c k (1932, S. 204) dasjenige des Magensaftes von Maja