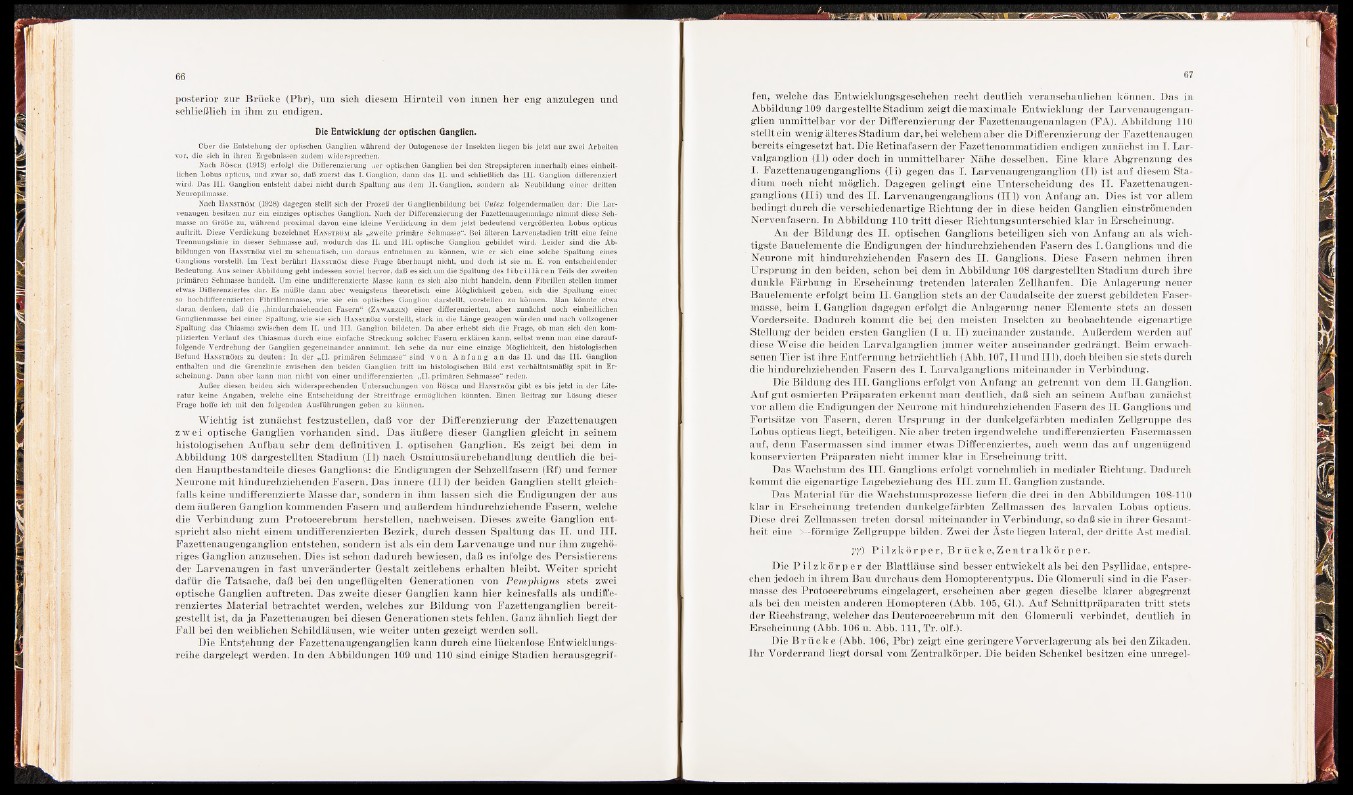
posterior zur Brücke (Pbr), um sich diesem Hirnteil von innen her eng anzulegen und
schließlich in ihm zu endigen.
Die Entwicklung der optischen Ganglien.
Über die Entstehung der optischen Ganglien während der Ontogenese der Insekten liegen bis jetzt nur zwei Arbeiten
vor, die sich in ihren Ergebnissen zudem widersprechen.
Nach R ö s c h (1913) erfolgt die Differenzierung uer optischen Ganglien bei den Strepsipteren innerhalb eines einheitlichen
Lobus opticus, und zwar so, daß zuerst das I. Ganglion, dann das II. und schließlich das III. Ganglion differenziert
wird. Das III. Ganglion entsteht dabei nicht durch Spaltung aus dem II. Ganglion, sondern als Neubildung einer dritten
N europilmasse.
Nach H a n s t r ö m (1928) dagegen stellt sich der Prozeß der Ganglienbildung bei Culex folgendermaßen dar: Die Larvenaugen
besitzen nur ein einziges optisches Ganglion. Nach der Differenzierung der Fazettenaugenanlage nimmt diese Sehmasse
an Größe zu, während proximal davon eine kleine Verdickung in dem jetzt bedeutend vei’größerten Lobus opticus
auftritt. Diese Verdickung bezeichnet H a n s t r ö m als „zweite primäre Sehmasse“. Bei älteren Larvenstadien tritt eine feine
Trennungslinie in dieser Sehmasse auf, wodurch das II. und III. optische Ganglion gebildet wird. Leider sind die Abbildungen
von H a n s t r ö m viel zu schematisch, um daraus entnehmen zu können, wie er sich eine solche Spaltung eines
Ganglions vorstellt. Im Text berührt H a n s t r ö m diese Frage überhaupt nicht, und doch ist sie m. E. von entscheidender
Bedeutung. Aus seiner Abbildung geht indessen soviel hervor, daß es sich um die Spaltung des f i b r i l l ä r e n Teils der zweiten
primären Sehmasse handelt. Um eine undifferenzierte Masse kann es sich also nicht handeln, denn Fibrillen stellen immer
etwas Differenziertes dar. Es müßte dann aber wenigstens theoretisch eine Möglichkeit geben, sich die Spaltung einer
so hochdifferenzierten Fibrillenmasse, wie sie ein optisches Ganglion darstellt, vorstellen zu können. Man könnte etwa
daran denken, daß die „hindurchziehenden Fasern“ ( Z a w a r z in ) einer differenzierten, aber zunächst noch einheitlichen
Ganglienmasse bei einer Spaltung, wie sie sich H a n s t r ö m vorstellt, stark in die Länge gezogen würden und nach vollzogener
Spaltung das Chiasma zwischen dem II. und III. Ganglion bildeten. Da aber erhebt sich die Frage, ob man sich den komplizierten
Verlauf des Chiasmas durch eine einfache Streckung solcher Fasern erklären kann, selbst wenn man eine darauffolgende
Verdrehung der Ganglien gegeneinander annimmt. Ich sehe da nur eine einzige Möglichkeit, den histologischen
Befund H a n s t r ö m s zu deuten: In der „II. primären Sehmasse“ sind v o n A n f a n g a n das II. und das III. Ganglion
enthalten und die Grenzlinie zwischen den beiden Ganglien tritt im histologischen Bild erst verhältnismäßig spät in Erscheinung.
Dann aber kann man nicht von einer undifferenzierten „II. primären Sehmasse“ reden.
Außer diesen beiden sich widersprechenden Untersuchungen von R ö s c h und H a n s t r ö m gibt es bis jetzt in der Literatur
keine Angaben, welche eine Entscheidung der Streitfrage ermöglichen könnten. Einen Beitrag zur Lösung dieser
Frage hoffe ich mit den folgenden Ausführungen geben zu können.
Wichtig ist zunächst festzustellen, daß vor der Differenzierung der Fazettenaugen
zwe i optische Ganglien vorhanden sind. Das äußere dieser Ganglien gleicht in seinem
histologischen Aufbau sehr dem definitiven I. optischen Ganglion. Es zeigt hei dem in
Abbildung 108 dargestellten Stadium (II) nach Osmiumsäurebehandlung deutlich die beiden
Hauptbestandteile dieses Ganglions: die Endigungen der Sehzellfasern (Rf) und ferner
Neurone m it hindurchziehenden Fasern. Das innere (III) der beiden Ganglien stellt gleichfalls
keine undifferenzierte Masse dar, sondern in ihm lassen sich die Endigungen der aus
dem äußeren Ganglion kommenden Fasern und außerdem hindurchziehende Fasern, welche
die Verbindung zum Protocerebrum herstellen, nach weisen. Dieses zweite Ganglion entspricht
also nicht einem undifferenzierten Bezirk, durch dessen Spaltung das II. und III.
Fazettenaugenganglion entstehen, sondern ist als ein dem Larvenauge und nur ihm zugehöriges
Ganglion anzusehen. Dies ist schon dadurch bewiesen, daß es infolge des Persistierens
der Larvenaugen in fast unveränderter Gestalt zeitlebens erhalten bleibt. Weiter spricht
dafür die Tatsache, daß bei den ungeflügelten Generationen von Pemphigus stets zwei
optische Ganglien auftreten. Das zweite dieser Ganglien kann hier keinesfalls als undifferenziertes
Material betrachtet werden, welches zur Bildung von Fazettenganglien bereitgestellt
ist, da ja Fazettenaugen bei diesen Generationen stets fehlen. Ganz ähnlich liegt der
Fall bei den weiblichen Schildläusen, wie weiter unten gezeigt werden soll.
Die Entstehung der Fazettenaugenganglien kann durch eine lückenlose Entwicklungsreihe
dargelegt werden. In den Abbildungen 109 und 110 sind einige Stadien herausgegriffen,
welche das Entwicklungsgeschehen recht deutlich veranschaulichen können. Das in
Abbildung 109 dargestellte Stadium zeigt die maximale Entwicklung der Larvenaugenganglien
unmittelbar vor der Differenzierung der Fazettenaugenanlagen (FA). Abbildung 110
stellt ein wenig älteres Stadium dar, bei welchem aber die Differenzierung der Fazettenaugen
bereits eingesetzt hat. Die Retinafasern der Fazettenommatidien endigen zunächst im I. Larvalganglion
(II) oder doch in unmittelbarer Nähe desselben. Eine klare Abgrenzung des
I. Fazettenaugenganglions (Ii) gegen das I. Larvenaugenganglion (II) ist auf diesem Stadium
noch nicht möglich. Dagegen gelingt eine Unterscheidung des II. Fazettenaugenganglions
(II i) und des II. Larvenaugenganglions (III) von Anfang an. Dies ist vor allem
bedingt durch die verschiedenartige Richtung der in diese beiden Ganglien einströmenden
Nervenfasern. In Abbildung 110 tritt dieser Richtungsunterschied klar in Erscheinung.
An der Bildung des II. optischen Ganglions beteiligen sich von Anfang an als wichtigste
Bauelemente die Endigungen der hindurchziehenden Fasern des I. Ganglions und die
Neurone mit hindurchziehenden Fasern des II. Ganglions. Diese Fasern nehmen ihren
Ursprung in den beiden, schon bei dem in Abbildung 108 dargestellten Stadium durch ihre
dunkle Färbung in Erscheinung tretenden lateralen Zellhaufen. Die Anlagerung neuer
Bauelemente erfolgt heim II. Ganglion stets an der Caudalseite der zuerst gebildeten Fasermasse,
beim I. Ganglion dagegen erfolgt die Anlagerung neuer Elemente stets an dessen
Vorderseite. Dadurch kommt die bei den meisten Insekten zu beobachtende eigenartige
Stellung der beiden ersten Ganglien (I u. II) zueinander zustande. Außerdem werden auf
diese Weise die beiden Larvalganglien immer weiter auseinander gedrängt. Beim erwachsenen
Tier ist ihre Entfernung beträchtlich (Abb. 107, II und III), doch bleiben sie stets durch
die hindurchziehenden Fasern des I. Larvalganglions miteinander in Verbindung.
Die Bildung des III. Ganglions erfolgt von Anfang an getrennt von dem II. Ganglion.
Auf gut osmierten Präparaten erkennt m an deutlich, daß sich an seinem Aufbau zunächst
vor allem die Endigungen der Neurone mit hindurchziehenden Fasern des II. Ganglions und
Fortsätze von Fasern, deren Ursprung in der dunkelgefärbten medialen Zellgruppe des
Lobus opticus liegt, beteiligen. Nie aber treten irgendwelche undifferenzierten Fasermassen
auf, denn Fasermassen sind immer etwas Differenziertes, auch wenn das auf ungenügend
konservierten Präparaten nicht immer klar in Erscheinung tritt.
Das Wachstum des III. Ganglions erfolgt vornehmlich in medialer Richtung. Dadurch
kommt die eigenartige Lagebeziehung des III. zum II. Ganglion zustande.
Das Material für die Wachstumsprozesse liefern, die drei in den Abbildungen 108-110
klar in Erscheinung tretenden dunkelgefärbten Zellmassen des larvalen Lobus opticus.
Diese drei Zellmassen treten dorsal miteinander in Verbindung, so daß sie in ihrer Gesamtheit
eine >~förmige Zellgruppe bilden. Zwei der Äste liegen lateral, der dritte Ast medial.
yy) P i l z k ö r p e r , B r ü c k e , Z e n t r a l k ö r p e r .
Die P i l z k ö r p e r der Blattläuse sind besser entwickelt als bei den Psyllidae, entsprechen
jedoch in ihrem Bau durchaus dem Iiomopterentypus. Die Glomeruli sind in die Fasermasse
des Protocerebrums eingelagert, erscheinen aber gegen dieselbe klarer abgegrenzt
als bei den meisten anderen Homopteren (Abh. 105, Gl.). Auf Schnittpräparaten tritt stets
der Riechstrang, welcher das Deuterocerebrum mit den Glomeruli verbindet, deutlich in
Erscheinung (Abb. 106 u. Abh. 111, Tr. olf.).
Die B r ü c k e (Abb. 106, Pbr) zeigt eine geringereVorverlagerung als hei den Zikaden.
Ih r Vorderrand liegt dorsal vom Zentralkörper. Die beiden Schenkel besitzen eine unregel