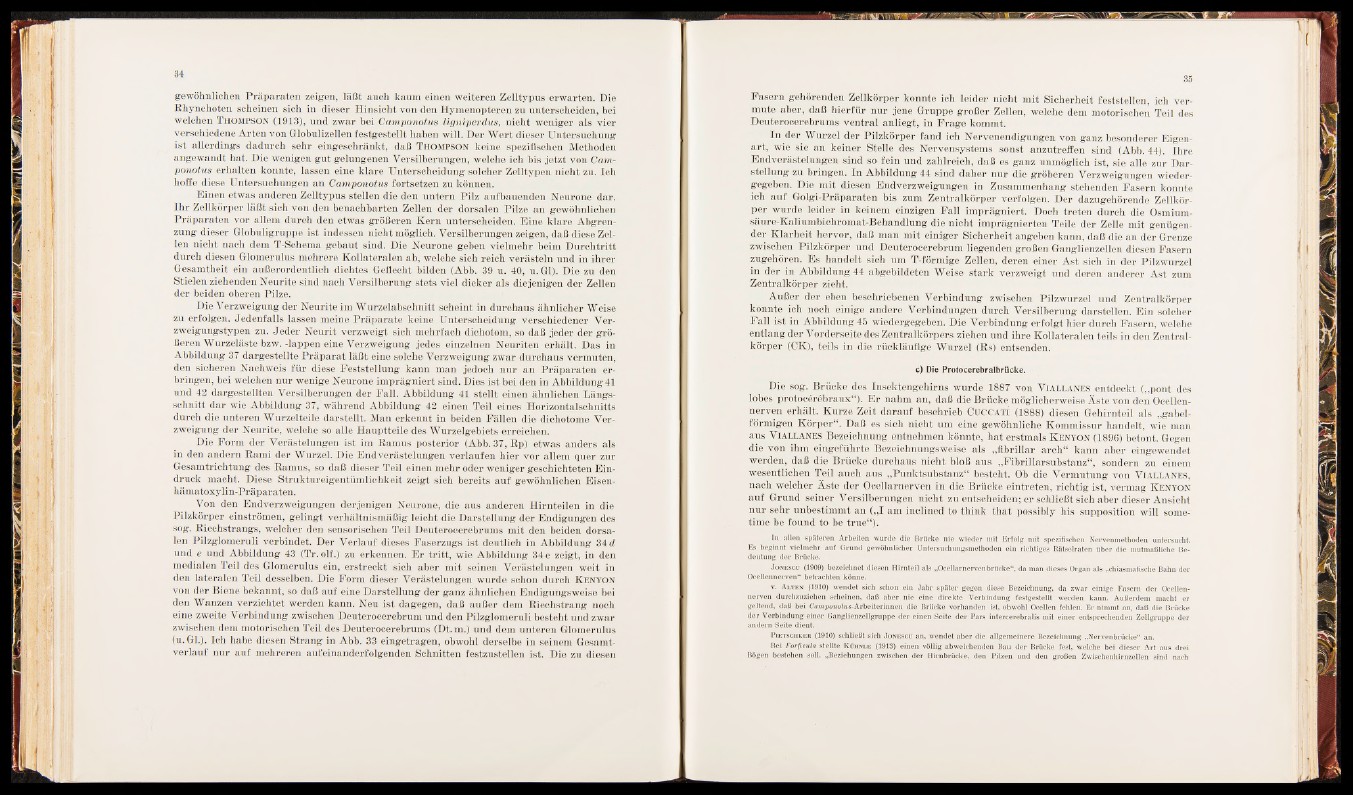
gewöhnlichen Präparaten zeigen, läßt auch kaum einen weiteren Zelltypus erwarten. Die
Rhynchoten scheinen sich in dieser Hinsicht von den Hymenopteren zu unterscheiden, bei
welchen T h o m p s o n (1913), und zwar bei Camponotus ligniperdus, nicht weniger als vier
verschiedene Arten von Globulizellen festgestellt haben will. Der Wert dieser Untersuchung
ist allerdings dadurch sehr eingeschränkt, daß T h o m p s o n keine spezifischen Methoden
angewandt hat. Die wenigen gut gelungenen Versilberungen, welche ich bis jetzt von Camponotus
erhalten konnte, lassen eine klare Unterscheidung solcher Zelltypen nicht zu. Ich
hoffe diese Untersuchungen an Camponotus fortsetzen zu können.
Einen etwas anderen Zelltypus stellen die den untern Pilz aufbauenden Neurone dar.
Ih r Zellkörper läßt sich von den benachbarten Zellen der dorsalen Pilze an gewöhnlichen
Präparaten vor allem durch den etwas größeren Kern unterscheiden. Eine klare Abgrenzung
dieser Globuligruppe ist indessen nicht möglich. Versilberungen zeigen, daß diese Zellen
nicht nach dem T-Schema gebaut sind. Die Neurone geben vielmehr beim Durchtritt
durch diesen Glomerulus mehrere Kollateralen ab, welche sich reich verästeln und in ihrer
Gesamtheit ein außerordentlich dichtes Geflecht bilden (Abb. 39 u. 40, u. Gl). Die zu den
Stielen ziehenden Neurite sind nach Versilberung stets viel dicker als diejenigen der Zellen
der beiden oberen Pilze.
Die Verzweigung der Neurite im Wurzelabschnitt scheint in durchaus ähnlicher Weise
zu erfolgen. Jedenfalls lassen meine Präparate keine Unterscheidung verschiedener Verzweigungstypen
zu. Jeder Neurit verzweigt sich mehrfach dichotom, so daß jeder der größeren
Wurzeläste bzw. -lappen eine Verzweigung jedes einzelnen Neuriten erhält. Das in
Abbildung 37 dargestellte Präp a ra t läßt eine solche Verzweigung zwar durchaus vermuten,
den sicheren Nachweis für diese Feststellung kann man jedoch nur an Präparaten erbringen,
bei welchen nur wenige Neurone imprägniert sind. Dies ist bei den in Abbildung 41
und 42 dargestellten Versilberungen der Fall. Abbildung 41 stellt einen ähnlichen Längsschnitt
dar wie Abbildung 37, während Abbildung 42 einen Teil eines Horizontalschnitts
durch die unteren Wurzel teile dar stellt. Man erkennt in beiden Fällen die dichotome Verzweigung
der Neurite, welche so alle Hauptteile des Wurzelgebiets erreichen.
Die Form der Verästelungen ist im Ramus posterior (Abb. 37, Rp) etwas anders als
in den ändern Rami der Wurzel. Die End Verästelungen verlaufen hier vor allem quer zur
Gesamtrichtung des Ramus, so daß dieser Teil einen m ehr oder weniger geschichteten E indruck
macht. Diese Struktureigentümlichkeit zeigt sich bereits auf gewöhnlichen Eisen-
hämatoxy lin-Pr äparaten.
Von den End Verzweigungen derjenigen Neurone, die aus anderen Hirnteilen in die
Pilzkörper einströmen, gelingt verhältnismäßig leicht die Darstellung der Endigungen des
sog. Riechstrangs, welcher den sensorischen Teil Deuterocerebrums mit den beiden dorsalen
Pilzglomeruli verbindet. Der Verlauf dieses Faserzugs ist deutlich in Abbildung 34 d
und e und Abbildung 43 (Tr. olf.) zu erkennen. E r tritt, wie Abbildung 34 e zeigt, in den
medialen Teil des Glomerulus ein, erstreckt sich aber mit seinen Verästelungen weit in
den lateralen Teil desselben. Die Form dieser Verästelungen wurde schon durch K e n y o n
von der Biene bekannt, so daß auf eine Darstellung der ganz ähnlichen Endigungsweise bei
den Wanzen verzichtet werden kann. Neu ist dagegen, daß außer dem Riechstrang noch
eine zweite Verbindung zwischen Deuterocerebrum und den Pilzglomeruli besteht und zwar
zwischen dem motorischen Teil des Deuterocerebrums (Dt. m.) und dem unteren Glomerulus
(u.Gl.). Ich habe diesen Strang in Abb. 33 eingetragen, obwohl derselbe in seinem Gesamtverlauf
nur auf mehreren aufeinanderfolgenden Schnitten festzustellen ist. Die zu diesen
Fasern gehörenden Zellkörper konnte ich leider nicht mit Sicherheit feststellen, ich vermute
aber, daß hierfür nur jene Gruppe großer Zellen, welche dem motorischen Teil des
Deuterocerebrums ventral anliegt, in Frage kommt.
In der Wurzel der Pilzkörper fand ich Nervenendigungen von ganz besonderer Eigenart,
wie sie an keiner Stelle des Nervensystems sonst anzutreffen sind (Abb. 44). Ihre
Endverästelungen sind so fein und zahlreich, daß es ganz unmöglich ist, sie alle zur Darstellung
zu bringen. In Abbildung 44 sind daher nur die gröberen Verzweigungen wiedergegeben.
Die mit diesen Endverzweigungen in Zusammenhang stehenden Fasern konnte
ich auf Golgi-Präparaten bis zum Zentralkörper verfolgen. Der dazugehörende Zellkörper
wurde leider in keinem einzigen Fall imprägniert. Doch treten durch die Osmium-
säure-Kaliumbichromat-Behandlung die nicht imprägnierten Teile der Zelle mit genügender
Klarheit hervor, daß man mit einiger Sicherheit angeben kann, daß die an der Grenze
zwischen Pilzkörper und Deuterocerebrum liegenden großen Ganglienzellen diesen Fasern
zugehören. Es handelt sich um T-förmige Zellen, deren einer Ast sich in der Pilzwurzel
in der in Abbildung 44 abgebildeten Weise stark verzweigt und deren anderer Ast zum
Zentralkörper zieht.
Außer der eben beschriebenen Verbindung zwischen Pilzwurzel und Zentralkörper
konnte ich noch einige andere Verbindungen durch Versilberung darstellen. Ein solcher
Fall ist in Abbildung 45 wiedergegeben. Die Verbindung erfolgt hier durch Fasern, welche
entlang der Vorderseite des Zentralkörpers ziehen und ihre K ollateralen teils in den Zentralkörper
(CK), teils in die rückläufige Wurzel (Rs) entsenden.
c) Die Protocerebralbrücke.
Die sog. Brücke des Insektengehirns wurde 1887 von V ia l l a n e s entdeckt („pont des
lobes protocérébraux“). E r nahm an, daß die Brücke möglicherweise Äste von den Ocellen-
nerven erhält. Kurze Zeit darauf beschrieb C u c c a t i (1888) diesen Gehirnteil als „gabelförmigen
Körper“. Daß es sich nicht um eine gewöhnliche Kommissur handelt, wie man
aus V ia l l a n e s Bezeichnung entnehmen könnte, hat erstmals K e n y o n (1896) betont. Gegen
die von ihm eingeführte Bezeichnungsweise als „fibrillär arch“ kann aber eingewendet
werden, daß die Brücke durchaus nicht bloß aus „Fibrillarsubstanz“, sondern zu einem
wesentlichen Teil auch aus „Punktsubstanz“ besteht. Ob die Vermutung von V ia l l a n e s ,
nach welcher Äste der Ocellarnerven in die Brücke eintreten, richtig ist, vermag K e n y o n
auf Grund seiner Versilberungen nicht zu entscheiden; er schließt sich aber dieser Ansicht
nur sehr unbestimmt an („I am inclined to think that possibly his supposition will some-
time be found to be true“).
In allen späteren Arbeiten wurde die Brücke nie wieder mit Erfolg mit spezifischen Nervenmethoden untersucht.
Es beginnt vielmehr auf Grund gewöhnlicher Untersuchungsmethoden ein richtiges Rätselraten über die mutmaßliche Bedeutung
der Brücke.
J o n e s c u (1909) bezeichnet diesen Hirnteil als „Ocellarnervenbrücke“, da man dieses Organ als „chiasmatische Bahn der
Ocellennerven“ betrachten könne.
v . A l t e n (1910) wendet sich schon ein Jahr später gegen diese Bezeichnung, da zwar einige Fasern der Ocellennerven
durchzuziehen scheinen, daß aber nie eine direkte Verbindung festgestellt werden kann. Außerdem macht er
geltend, daß bei Camponotus-Arbeiterinnen die Brücke vorhanden ist, obwohl Ocellen fehlen. Er nimmt an, daß die Brücke
der Verbindung einer Ganglienzellgruppe der einen Seite der Pars intercerebralis mit einer entsprechenden Zellgruppe der
ändern Seite dient.
P ie t s c h k e r (1910) schließt sich J o n e s c u an, wendet aber die allgemeinere Bezeichnung „Nervenbrücke“ an.
Bei Forfícula stellte K ü h n l e (1 9 1 3 ) einen völlig abweichenden Bau der Brücke fest, welche bei dieser Art aus drei
Bögen bestehen soll. „Beziehungen zwischen der Hirnbrücke, den Pilzen und den großen Zwischenhirnzellen sind nach