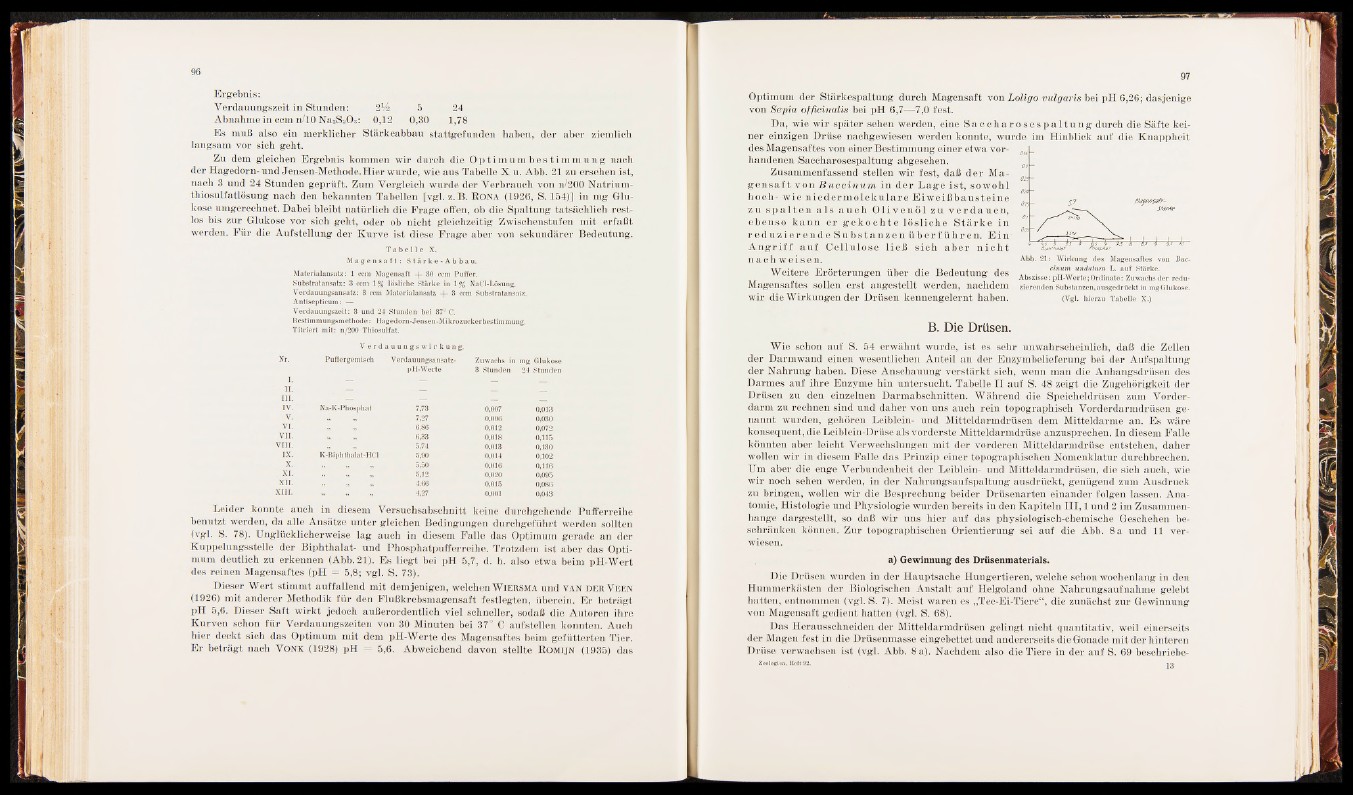
Ergebnis:
Verdauungszeit in Stunden: 2Vz 5 24
Abnahme in ccm n/10 Na2S203: 0,12 0,30 1,78
Es muß also ein merklicher Stärkeabbau stattgefunden haben, der aber ziemlich
langsam vor sich geht.
Zu dem gleichen Ergebnis kommen wir durch die O p t im um b e s t im m u n g nach
der Hagedorn-und Jensen-Methode. Hier wurde, wie aus Tabelle X u. Abb. 21 zu ersehen ist,
nach 3 und 24 Stunden geprüft. Zum Vergleich wurde der Verbrauch von n/200 Natriumthiosulfatlösung
nach den bekannten Tabellen [vgl. z.B. Bona (1926, S. 154)] in mg Glukose
umgerechnet. Dabei bleibt natürlich die Frage offen, ob die Spaltung tatsächlich restlos
bis zur Glukose vor sich geht, oder ob nicht gleichzeitig Zwischenstufen mit erfaßt
werden. F ü r die Aufstellung der Kurve ist diese Frage aber von sekundärer Bedeutung.
T a b e l l e X.
M a g e n s a f t : S t ä r k e - A b b a u .
Materialansatz: 1 ccm Magensaft 30 ccm Puffer.
Substratansatz: 3 ccm 1% lösliche Stärke in 1% NaCl-Lösung.
Verdauungsansatz: 3 ccm Materialansatz -\- 3 ccm Substratansatz.
Antisepticum tfEtaaggy:
Verdauungszeit: 3 und 24 Stunden bei 37° C.
Bestimmungsmethode: Hagedorn-Jensen-Mikrozuckerbestimmung.
Titriert mit: n/200 Thiosulfat.
Nr.
V e r d t
Puffergemisch
i u u n g s w i r k u n g .
V erdauungsansatz- Zuwachs in mg Glulcos
■ I. ''
II.
-
pH-Werte 3 Stunden 24 Stunde
III. —
IV. Na-K-Phosphat 7,73 0,007 0,013
V. 7,27 0,006 0,030
VI. „ „ 6,86 0,012 0,072
VII. 6,33 0,018 0,115
VIII. 5,74 0,013 0,130
IX. K-Biphthalat-HCl 5,90 0,014 0,102
X. 5,50 0,016 0,116
XI. 5,12 0,020 0,095
XII. 4,66 0,015 0,086
XIII. 4,27 0,001 0,043
Leider konnte auch in diesem Versuchsabschnitt keine durchgehende Pufferreihe
benutzt werden, da alle Ansätze unter gleichen Bedingungen durchgeführt werden sollten
(vgl. S. 78). Unglücklicherweise lag auch in diesem Falle das Optimum gerade an der
Kuppelungsstelle der Biphthalat- und Phosphatpufferreihe. Trotzdem ist aber das Optimum
deutlich zu erkennen (Abb. 21). Es liegt bei pH 5,7, d. h. also etwa beim pH-Wert
des reinen Magensaftes ( p H g 5,8; vgl. S. 73).
Dieser Wert stimmt auffallend mit demjenigen, welchen Wiersma und van der Veen
(1926) mit anderer Methodik für den Flußkrebsmagensaft festlegten, überein. E r beträgt
pH 5,6. Dieser Saft wirkt jedoch außerordentlich viel schneller, sodaß die Autoren ihre
Kurven schon für Verdauungszeiten von 30 Minuten bei 37° C auf stellen konnten. Auch
hier deckt sich das Optimum mit dem pH-Werte des Magensaftes beim gefütterten Tier.
E r beträgt nach Vonk (1928) pH = 5,6. Abweichend davon stellte Romijn (1935) das
Optimum der Stärkespaltung durch Magensaft von Loligo vulgaris bei pH 6,26; dasjenige
von Sepia officinalis bei pH 6,7—7,0 fest.
Da, wie wir später sehen werden, eine S a c c h a r o s e s p a l t u n g durch die Säfte keiner
einzigen Drüse nachgewiesen werden konnte, wurde im Hinblick auf die Knappheit
des Magensaftes von einer Bestimmung einer etwa vorhandenen
Saccharosespaltung abgesehen.
Zusammenfassend stellen wir fest, daß d e r M a ge
ns a f t von B u c c in u m in der Lage is t, sowohl
hoch- wie ni ede rmol e kul a r e Eiwe i ßbaus t e i ne
zu s p a l t e n a l s a u c h O l i v e n ö l zu v e r d a u e n ,
ebenso k a nn er g e k o c h t e lö s lic h e St ä r k e in
r e d u z i e r e n d e S u b s t a n z e n ü b e r f ü h r e n . E i n
An g r i f f auf Cel lulose l ieß s ic h aber n i c h t
n a chwe i s e n .
Weitere Erörterungen über die Bedeutung des
Abb. 21: Wirkung des Magensaftes von Buccinum
undatum L. auf Stärke.
Abszisse: nH-Werte:Ordinate: Zuwachs der redu
Magensaftes sollen erst angestellt werden, nachdem zierenden Substanzen, ausgedrückt in mg Glukose,
wir die Wirkungen der Drüsen kennengelernt haben. (Vgl. hierzu Tabelle x.)
B. Die Drüsen.
Wie schon auf S. 54 erwähnt wurde, ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Zellen
der Darmwand einen wesentlichen Anteil an der Enzymbelieferung bei der Aufspaltung
der Nahrung haben. Diese Anschauung verstärkt sich, wenn man die Anhangsdrüsen des
Darmes auf ihre Enzyme hin untersucht. Tabelle I I auf S. 48 zeigt die Zugehörigkeit der
Drüsen zu den einzelnen Darmabschnitten. Während die Speicheldrüsen zum Vorderdarm
zu rechnen sind und daher von uns auch rein topographisch Vorderdarmdrüsen genannt
wurden, gehören Leiblein- und Mitteldarmdrüsen dem Mitteldarme an. Es wäre
konsequent, die Leiblein-Drüse als vorderste Mitteldarmdrüse anzusprechen. In diesem Falle
könnten aber leicht Verwechslungen mit der vorderen Mitteldarmdrüse entstehen, daher
wollen wir in diesem Falle das Prinzip einer topographischen Nomenklatur durchbrechen.
Um aber die enge Verbundenheit der Leiblein- und Mitteldarmdrüsen, die sich auch, wie
wir noch sehen werden, in der Nahrungsaufspaltung ausdrückt, genügend zum Ausdruck
zu bringen, wollen wir die Besprechung beider Drüsenarten einander folgen lassen. Anatomie,
Histologie und Physiologie wurden bereits in den K apiteln I II, 1 und 2 im Zusammenhänge
dargestellt, so daß wir uns hier auf das physiologisch-chemische Geschehen beschränken
können. Zur topographischen Orientierung sei auf die Abb. 8 a und 11 verwiesen.
a) Gewinnung des Drüsenmaterials.
Die Drüsen wurden in der Hauptsache Hungertieren, welche schon wochenlang in den
Hummerkästen der Biologischen Anstalt auf Helgoland ohne Nahrungsaufnahme gelebt
hatten, entnommen (vgl. S. 7). Meist waren es „Tee-Ei-Tiere“, die zunächst zur Gewinnung
von Magensaft gedient hatten (vgl. S. 68).
Das Herausschneiden der Mitteldarmdrüsen gelingt nicht quantitativ, weil einerseits
der Magen fest in die Drüsenmasse eingebettet und andererseits die Gonade mit der hinteren
Drüse verwachsen ist (vgl. Abb. 8 a). Nachdem also die Tiere in der auf S. 69 beschriebe-
Zoologica, Heit 92. ^ g