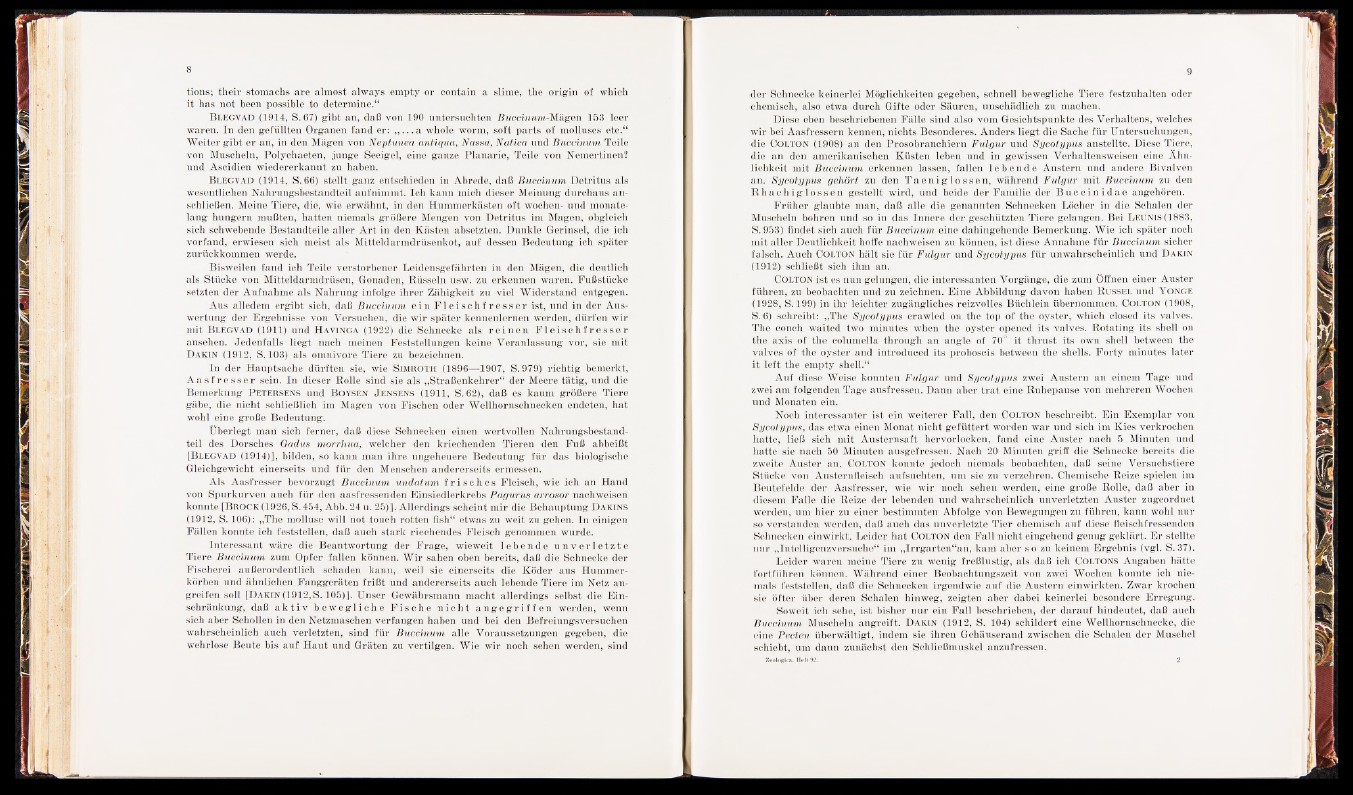
tions; their stomachs are almost always empty or contain a slime, the origin of which
it has not been possible to determine.“
Blegvad (1914, S. 67) gibt an, daß von 190 untersuchten Buccinum-M.ä.gen 153 leer
waren. In den gefüllten Organen fand er: „ . . . a whole worm, soft parts of molluscs etc.“
Weiter gibt er an, in den Mägen von Neptunea antiqua, Nassa, Natica und Buccinum Teile
von Muscheln, Polychaeten, junge Seeigel, eine ganze Planarie, Teile von Nemertinen'?
und Ascidien wiedererkannt zu haben.
Blegvad (1914, S. 66) stellt ganz entschieden in Abrede, daß Buccinum Detritus als
wesentlichen Nahrungsbestandteil auf nimmt. Ich kann mich dieser Meinung durchaus anschließen.
Meine Tiere, die, wie erwähnt, in den Hummerkästen oft wochen- und monatelang
hungern mußten, hatten niemals größere Mengen von Detritus im Magen, obgleich
sich schwebende Bestandteile aller Art in den Kästen absetzten. Dunkle Gerinsel, die ich
vorfand, erwiesen sich meist als Mitteldarmdrüsenkot, auf dessen Bedeutung ich später
zurückkommen werde.
Bisweilen fand ich Teile verstorbener Leidensgefährten in den Mägen, die deutlich
als Stücke von Mitteldarmdrüsen, Gonaden, Rüsseln usw. zu erkennen waren. Fußstücke
setzten der Aufnahme als Nahrung infolge ihrer Zähigkeit zu viel Widerstand entgegen.
Aus alledem ergibt sieh, daß Buccinum e in F l e i s c h f r e s s e r ist, und in der Auswertung
der Ergebnisse von Versuchen, die wir später kennenlernen werden, dürfen wir
mit Blegvad (1911) und Havinga (1922) die Schnecke als r e i n e n F l e i s c h f r e s s e r
ansehen. Jedenfalls liegt nach meinen Feststellungen keine Veranlassung vor, sie mit
Dakin (1912, S. 103) als omnivore Tiere zu bezeichnen.
In der Hauptsache dürften sie, wie Simroth (1896—1907, S. 979) richtig bemerkt,
A a s f r e s s e r sein. In dieser Rolle sind sie als „Straßenkehrer“ der Meere tätig, und die
Bemerkung P etersens und Boysen J ensens (1911, S. 62), daß es kaum größere Tiere
gäbe, die nicht schließlich im Magen von Fischen oder Wellhornschnecken endeten, hat
wohl eine große Bedeutung.
Überlegt man sich ferner, daß diese Schnecken einen wertvollen Nahrungsbestandteil
des Dorsches Gadus morrhua, welcher den kriechenden Tieren den Fuß abbeißt
[Blegvad (1914)], bilden, so kann man ihre ungeheuere Bedeutung für das biologische
Gleichgewicht einerseits und für den Menschen andererseits ermessen.
Als Aasfresser bevorzugt Buccinum undatum f r i s c h e s Fleisch, wie ich an Hand
von Spurkurven auch für den aasfressenden Einsiedlerkrebs Pagurus arrosor nachweisen
konnte [Brock (1926, S. 454, Abb. 24 u. 25)]. Allerdings scheint mir die Behauptung Dakins
(1912, S. 106): „The molluse will not touch rotten fish“ etwas zu weit zu gehen. In einigen
Fällen konnte ich feststellen, daß auch stark riechendes Fleisch genommen wurde.
Interessant wäre die Beantwortung der Frage, wieweit l e b e n d e u n v e r l e t z t e
Tiere Buccinum zum Opfer fallen können. Wir sahen oben bereits, daß die Schnecke der
Fischerei außerordentlich schaden kann, weil sie einerseits die Köder aus Hummerkörben
und ähnlichen Fanggeräten frißt und andererseits auch lebende Tiere im Netz angreifen
soll [Darin (1912, S. 105)]. Unser Gewährsmann macht allerdings selbst die Einschränkung,
daß a k t i v b ewe g l i c h e F i s c h e n i c h t a n g e g r i f f e n werden, wenn
sich aber Schollen in den Netzmaschen verfangen haben und bei den Befreiungsversuchen
wahrscheinlich auch verletzten, sind für Buccinum alle Voraussetzungen gegeben, die
wehrlose Beute bis auf Haut und Gräten zu vertilgen. Wie wir noch sehen werden, sind
der Schnecke keinerlei Möglichkeiten gegeben, schnell bewegliche Tiere festzuhalten oder
chemisch, also etwa durch Gifte oder Säuren, unschädlich zu machen.
Diese eben beschriebenen Fälle sind also vom Gesichtspunkte des Verhaltens, welches
wir bei Aasfressern kennen, nichts Besonderes. Anders liegt die Sache für Untersuchungen,
die Colton (1908) an den Prosobranchiern Fulgur und Sycotypus anstellte. Diese Tiere,
die an den amerikanischen Küsten leben und in gewissen Verhaltensweisen eine Ähnlichkeit
mit Buccinum erkennen lassen, fallen l e b e n d e Austern und andere Bivalven
an. Sycotypus gehört zu den T a e n i g l o s s e n , während Fulgur mit Buccinum zu den
R h a c h i g l o s s e n gestellt wird, und beide der Familie der B u c c i n i d a e angehören.
Früher glaubte man, daß alle die genannten Schnecken Löcher in die Schalen der
Muscheln bohren und so in das Innere der geschützten Tiere gelangen. Bei Leu n is (1883,
S. 953) findet sich auch für Buccinum eine dahingehende Bemerkung. Wie ich später noch
mit aller Deutlichkeit hoffe nachweisen zu können, ist diese Annahme für Buccinum sicher
falsch. Auch C o l t o n hält sie für Fulgur und Sycotypus für unwahrscheinlich und D a r in
(1912) schließt sich ihm an.
Colton ist es nun gelungen, die interessanten Vorgänge, die zum Öffnen einer Auster
führen, zu beobachten und zu zeichnen. Eine Abbildung davon haben Russel und Yonge
(1928, S. 199) in ihr leichter zugängliches reizvolles Büchlein übernommen. Colton (1908,
S. 6) schreibt: „The Sycotypus crawled on the top of the oyster, which closed its valves.
The conch waited two minutes when the oyster opened its valves. Rotating its shell on
the axis of the columella through an angle of 70° it thrust its own shell between the
valves of the oyster and introduced its proboscis between the shells. Forty minutes later
it left the empty shell.“
Auf diese Weise konnten Fulgur und Sycotypus zwei Austern an einem Tage und
zwei am folgenden Tage ausfressen. Dann aber tra t eine Ruhepause von mehreren Wochen
und Monaten ein.
Noch interessanter ist ein weiterer Fall, den Colton beschreibt. Ein Exemplar von
Sycotypus, das etwa einen Monat nicht gefüttert worden war und sich im Kies verkrochen
hatte, ließ sich mit Austernsaft hervorlocken, fand eine Auster nach 5 Minuten und
hatte sie nach 50 Minuten ausgefressen. Nach 20 Minuten griff die Schnecke bereits die
zweite Auster an. Colton konnte jedoch niemals beobachten, daß seine Versuchstiere
Stücke von Austernfleisch aufsuchten, um sie zu verzehren. Chemische Reize spielen im
Beutefelde der Aasfresser, wie wir noch sehen werden, eine große Rolle, daß aber in
diesem Falle die Reize der lebenden und wahrscheinlich unverletzten Auster zugeordnet
werden, um hier zu einer bestimmten Abfolge von Bewegungen zu führen, kann wohl nur
so verstanden werden, daß auch das unverletzte Tier chemisch auf diese fleischfressenden
Schnecken einwirkt. Leider hat COLTON den Fall nicht eingehend genug geklärt. Er stellte
nur „Intelligenzversuche“ im „Irrgarten“an, kam aber so zu keinem Ergebnis (vgl. S .37).
Leider waren meine Tiere zu wenig freßlustig, als daß ich Coltons Angaben hätte
fortführen können. Während einer Beobachtungszeit von zwei Wochen konnte ich niemals
feststellen, daß die Schnecken irgendwie auf die Austern einwirkten. Zwar krochen
sie öfter über deren Schalen hinweg, zeigten aber dabei keinerlei besondere Erregung.
Soweit ich sehe, ist bisher nur ein Fall beschrieben, der darauf hindeutet, daß auch
Buccinum Muscheln angreift. Darin (1912, S. 104) schildert eine Wellhornschneeke, die
eine Pecten überwältigt, indem sie ihren Gehäuserand zwischen die Schalen der Muschel
schiebt, um dann zunächst den Schließmuskel anzufressen.