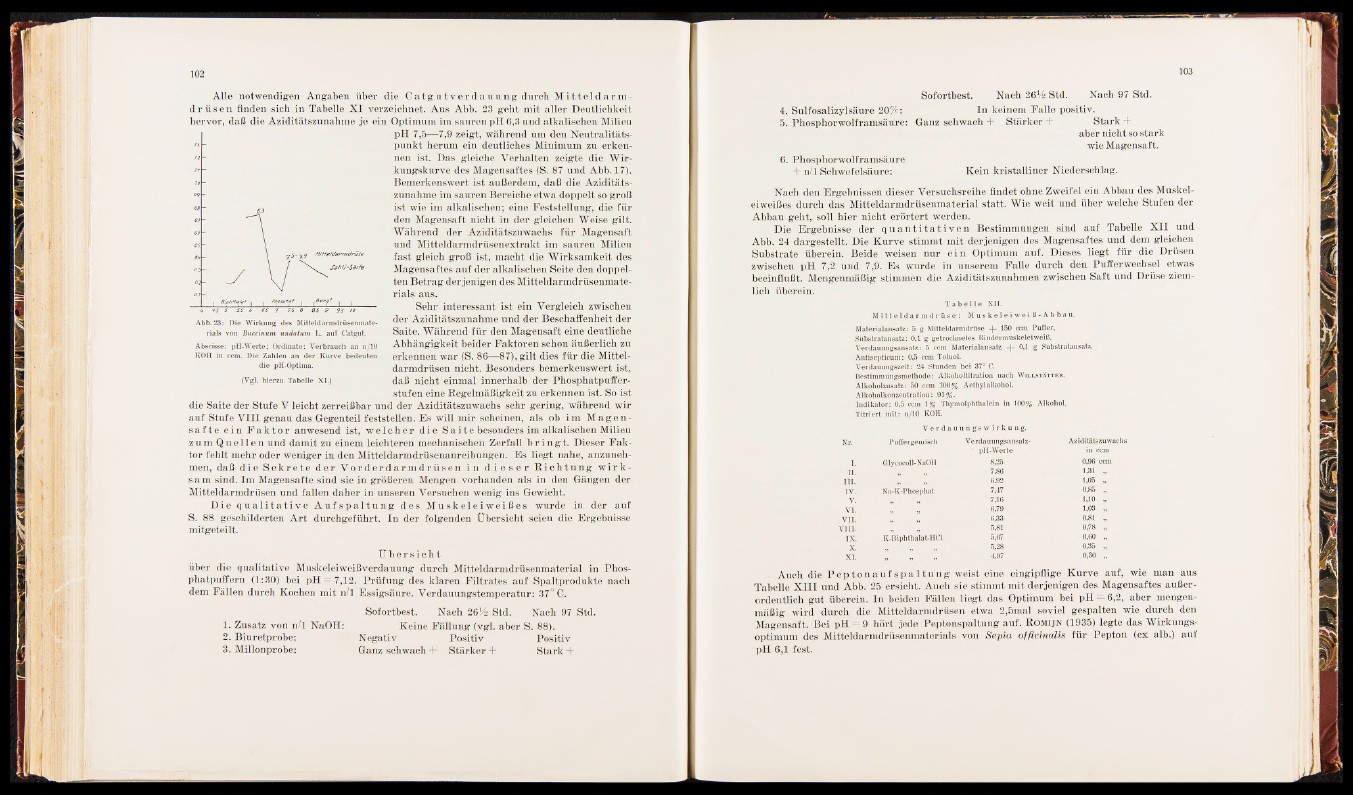
Alle notwendigen Angaben über die C a t g u t v e r d a u u n g durch Mi t t e l d a rm-
d r ü s e n finden sich in Tabelle X I verzeichnet. Aus Abb. 23 geht mit aller Deutlichkeit
hervor, daß die Aziditätszunahme je ein Optimum im sauren pH 6,3 und alkalischen Milieu
pH 7,5—7,9 zeigt, während um den Neutralitätspunkt
herum ein deutliches Minimum zu erkennen
ist. Das gleiche Verhalten zeigte die Wirkungskurve
des Magensaftes (S. 87 und Abb. 17).
Bemerkenswert ist außerdem, daß die Aziditätszunahme
im sauren Bereiche etwa doppelt so groß
ist wie im alkalischen; eine Feststellung, die für
den Magensaft nicht in der gleichen Weise gilt.
Während der Aziditätszuwachs fü r Magensaft
und Mitteldarmdrüsenextrakt im sauren Milieu
fast gleich groß ist, macht die Wirksamkeit des
Magensaftes auf der alkalischen Seite den doppelten
B etrag derjenigen des Mitteldarmdrüsenmaterials
aus.
Sehr interessant ist ein Vergleich zwischen
der Aziditätszunahme und der Beschaffenheit der
Saite. Während fü r den Magensaft eine deutliche
Abhängigkeit beider Faktoren schon äußerlich zu
erkennen war (S. 86—87), gilt dies für die Mitteldarmdrüsen
nicht. Besonders bemerkenswert ist,
daß nicht einmal innerhalb der Phosphatpufferstufen
eine Regelmäßigkeit zu erkennen ist. So ist
Abb. 23 : Die Wirkung des Mitteldarmdrüsenmaterials
von Buccinum undalum L. auf Catgut.
Abscisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an n/10
KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve bedeuten
die pH-Optima.
(Vgl. hierzu Tabelle XI.)
die Saite der Stufe V leicht zerreißbar und der Aziditätszuwachs sehr gering, während wir
auf Stufe V III genau das Gegenteil feststellen. Es will mir scheinen, als ob im Ma g e n s
a f t e e in F a k t o r anwesend ist, w e l c h e r di e S a i t e besonders im alkalischen Milieu
z um Qu e l l e n und damit zu einem leichteren mechanischen Zerfall b r i n g t . Dieser Faktor
fehlt mehr oder weniger in den Mitteldarmdrüsenanreibungen. Es liegt nahe, anzunehmen,
daß d ie S e k r e t e d e r V o r d e r d a rm d r ü s e n i n d i e s e r R i c h t u n g w i r k s
am sind. Im Magensafte sind sie in größeren Mengen vorhanden als in den Gängen der.
Mitteldarmdrüsen und fallen daher in unseren Versuchen wenig ins Gewicht.
D ie q u a l i t a t i v e A u f s p a l t u n g de s Mu s k e l e i w e i ß e s wurde in der auf
S. 88 geschilderten Art durchgeführt. In der folgenden Übersicht seien die Ergebnisse
mitgeteilt.
Ü b e r s i c h t
über die qualitative Muskeleiweißverdauung durch Mitteldarmdrüsenmaterial in Phosphatpuffern
(1:30) bei pH = 7,12. Prüfung des klaren Filtrates auf Spaltprodukte nach
dem Fällen durch Kochen mit n /l Essigsäure. Verdauungstemperatur: 37° C.
Sofortbest. Nach 26% Std. Nach 97 Std.
1. Zusatz von n/l NaOH: Keine Fällung (vgl. aber S. 88).
2. Biuretprobe: Negativ Positiv Positiv
3. Milionprobe: Ganz schwach + Stärker + Stark +
4. Sulfosalizylsäure 20%:
5. Phosphorwolframsäure:
6. Phosphor wolframsäure
+ n /l Schwefelsäure:
Sofortbest. Nach 26% Std. Nach 97 Std.
In keinem Falle positiv.
Ganz schwach + Stärker + Stark +
aber nicht so stark
wie Magensaft.
Kein kristalliner Niederschlag.
Nach den Ergebnissen dieser Versuchsreihe findet ohne Zweifel ein Abbau des Muskeleiweißes
durch das Mitteldarmdrüsenmaterial statt. Wie weit und über welche Stufen der
Abbau geht, soll hier nicht erörtert werden.
Die Ergebnisse der q u a n t i t a t i v e n Bestimmungen sind auf Tabelle X II und
Abb. 24 dargestellt. Die Kurve stimmt mit derjenigen des Magensaftes und dem gleichen
Substrate überein. Beide weisen nur e in Optimum auf. Dieses liegt für die Drüsen
zwischen pH 7,2 und 7,9. Es wurde in unserem Falle durch den Puff er Wechsel etwas
beeinflußt. Mengenmäßig stimmen die Aziditätszunahmen zwischen Saft und Drüse ziemlich
überein.
T a b e l l e XII.
M i t t e l d a r m d r ü s e : M u s k e l e i w e i ß - A b b a u .
Materialansatz: 5 g Mitteldarmdrüse -(- 150 ccm Puffer.
Substratansatz: 0,1 g getrocknetes Rindermuskeleiweiß.
Verdauungsansatz: 5 ccm Materialansatz -(- 0,1 g Substratansatz.
Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.
Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.
Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach W i l l s t ä t t e r .
Alkoholzusatz: 50 ccm 100% Aethylalkohol.
Alkoholkonzentration: 91%.
Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.
Titriert mit: n/10 KOH.
Wi r kun g.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
V e r d a i
Puffergemisch
Glycocoll-NaOH
Na-K-Phosphat
K-Biphthalat-HCl
u n g s v
V erdauungsansatz-
pH-Werte
8,25
7,86
6,92
7,47
7,16
6,79
6,33
5,81
5,67
5,28
4,97
Aziditälszuwachs
in ccm
0,96 ccm
1,31 „
1,05 „
0,85 „
1,10 „
1,03 „
0,81 „
0,78 „
0,60 „
0,35 „
0,30 „
Auch die P e p t o n a u f s p a l t u n g weist eine eingipflige Kurve auf, wie man aus
Tabelle XXII und Abb. 25 ersieht. Auch sie stimmt mit derjenigen des Magensaftes außerordentlich
gut überein. In beiden Fällen liegt das Optimum bei pH = 6,2, aber mengenmäßig
wird durch die Mitteldarmdrüsen etwa 2,5mal soviel gespalten wie durch den
Magensaft. Bei pH = 9 hört jede Peptonspaltung auf. R o m i j n (1935) legte das Wirkungsoptimum
des Mitteldarmdrüsenmaterials von Sepia offtcinalis für Pepton (ex alb.) auf
pH 6,1 fest.