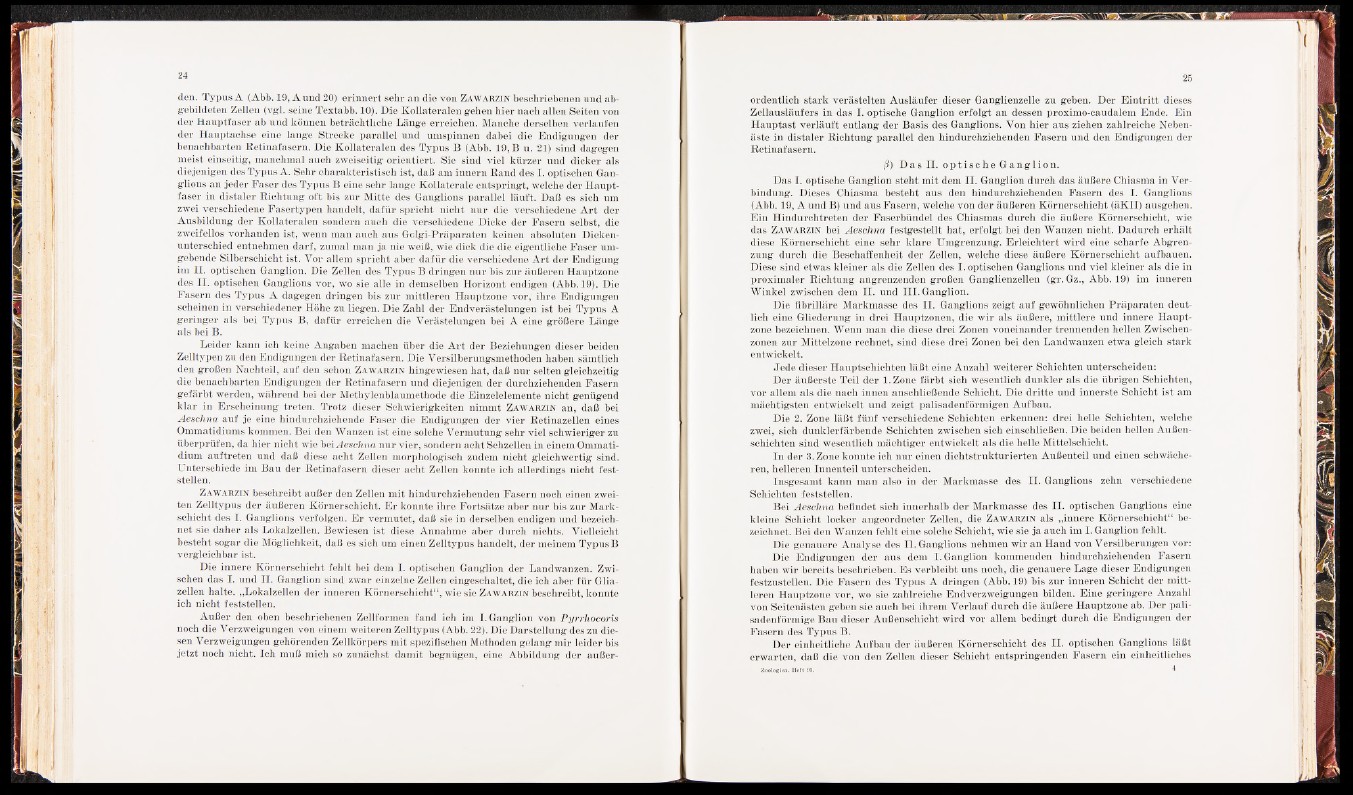
den. TypusA (Abb. 19, A und 20) erinnert sehr an die von Z a w a r z in beschriebenen und abgebildeten
Zellen (vgl. seine Textabb. 10). Die Kollateralen gehen hier nach allen Seiten von
der Hauptfaser ab und können beträchtliche Länge erreichen. Manche derselben verlaufen
der Hauptachse eine lange Strecke parallel und umspinnen dabei die Endigungen der
benachbarten Eetinafasern. Die Kollateralen des Typus B (Abb. 19, B u. 21) sind dagegen
meist einseitig, manchmal auch zweiseitig orientiert. Sie sind viel kürzer und dicker als
diejenigen des Typus A. Sehr charakteristisch ist, daß am innern Band des I. optischen Ganglions
an jeder Faser des Typus B eine sehr lange Kollaterale entspringt, welche der Hauptfaser
in distaler Richtung oft bis zur Mitte des Ganglions parallel läuft. Daß es sich um
zwei verschiedene Fasertypen handelt, dafür spricht nicht nur die verschiedene Art der
Ausbildung der Kollateralen sondern auch die verschiedene Dicke der Fasern selbst, die
zweifellos vorhanden ist, wenn man auch aus Golgi-Präparaten keinen absoluten Dickenunterschied
entnehmen darf, zumal man ja nie weiß, wie dick die die eigentliche Faser umgebende
Silberschicht ist. Vor allem spricht aber dafür die verschiedene Art der Endigung
im II. optischen Ganglion. Die Zellen des Typus B dringen nur bis zur äußeren Hauptzone
des II. optischen Ganglions vor, wo sie alle in demselben Horizont endigen (Abb. 19). Die
Fasern des Typus A dagegen dringen bis zur mittleren Hauptzone vor, ihre Endigungen
scheinen in verschiedener Höhe zu liegen. Die Zahl der Endverästelungen ist bei Typus A
geringer als bei Typus B, dafür erreichen die Verästelungen bei A eine größere Länge
als bei B.
Leider kann ich keine Angaben machen über die Art der Beziehungen dieser beiden
Zelltypen zu den Endigungen der Retinafasern. Die Versilberungsmethoden haben sämtlich
den großen Nachteil, auf den schon Z a w a r z in hingewiesen hat, daß nur selten gleichzeitig
die benachbarten Endigungen der Retinafasern und diejenigen der durchziehenden Fasern
gefärbt werden, während bei der Methylenblaumethode die Einzelelemente nicht genügend
klar in Erscheinung treten. Trotz dieser Schwierigkeiten nimmt Z a w a r z in an, daß bei
Aeschna auf je eine hindurchziehende Faser die Endigungen der vier Retinazellen eines
Ommatidiums kommen. Bei den Wanzen ist eine solche Vermutung sehr viel schwieriger zu
überprüfen, da hier nicht wie bei Aeschna nur vier, sondern acht Sehzellen in einem Ommati-
dium auf treten und daß diese acht Zellen morphologisch zudem nicht gleichwertig sind.
Unterschiede im Bau der Retinafasern dieser acht Zellen konnte ich allerdings nicht feststellen.
Z a w a r z in beschreibt außer den Zellen mit hindurchziehenden Fasern noch einen zweiten
Zelltypus der äußeren Körner Schicht. E r konnte ihre Fortsätze aber nur bis zur Markschicht
des I. Ganglions verfolgen. E r vermutet, daß sie in derselben endigen und bezeichnet
sie daher als Lokalzellen. Bewiesen ist diese Annahme aber durch nichts. Vielleicht
besteht sogar die Möglichkeit, daß es sich um einen Zelltypus handelt, der meinem Typus B
vergleichbar ist.
Die innere Körnerschicht fehlt bei dem I. optischen Ganglion der Landwanzen. Zwischen
das I. und II. Ganglion sind zwar einzelne Zellen eingeschaltet, die ich aber für Glia-
zellen halte. „Lokalzellen der inneren Körnerschicht“, wie sie Z a w a r z in beschreibt, konnte
ich nicht feststellen.
Außer den oben beschriebenen Zellformen fand ich im I. Ganglion von Pyrrhocoris
noch die Verzweigungen von einem weiteren Zelltypus (Abb. 22). Die Darstellung des zu diesen
Verzweigungen gehörenden Zellkörpers mit spezifischen Methoden gelang m ir leider bis
jetzt noch nicht. Ich muß mich so zunächst damit begnügen, eine Abbildung der außerordentlich
stark verästelten Ausläufer dieser Ganglienzelle zu geben. Der E in tritt dieses
Zellausläufers in das I. optische Ganglion erfolgt an dessen proximo-caudalem Ende. Ein
Hauptast verläuft entlang der Basis des Ganglions. Von hier aus ziehen zahlreiche Nebenäste
in distaler Richtung parallel den hindurchziehenden Fasern und den Endigungen der
Retinafasern.
ß) D a s II. o p t i s c h e Ga n g l io n .
Das I. optische Ganglion steht mit dem II. Ganglion durch das äußere Chiasma in Verbindung.
Dieses Chiasma besteht aus den hindurchziehenden Fasern des I. Ganglions
(Abb. 19, A und B) und aus Fasern, welche von der äußeren Körnerschicht (äKII) ausgehen.
Ein Hindurchtreten der Faserbündel des Chiasmas durch die äußere Körnerschicht, wie
das Z a w a r z in bei Aeschna festgestellt hat, erfolgt bei den Wanzen nicht. Dadurch erhält
diese Körnerschicht eine sehr klare Umgrenzung. Erleichtert wird eine scharfe Abgrenzung
durch die Beschaffenheit der Zellen, welche diese äußere Körnerschicht aufbauen.
Diese sind etwas kleiner als die Zellen des I. optischen Ganglions und viel kleiner als die in
proximaler Richtung angrenzenden großen Ganglienzellen (gr. Gz., Abb. 19) im inneren
Winkel zwischen dem II. und III. Ganglion.
Die fibrilläre Markmasse des II. Ganglions zeigt auf gewöhnlichen Präparaten deutlich
eine Gliederung in drei Hauptzonen, die wir als äußere, mittlere und innere Hauptzone
bezeichnen. Wenn man die diese drei Zonen voneinander trennenden hellen Zwischenzonen
zur Mittelzone rechnet, sind diese drei Zonen bei den Landwanzen etwa gleich stark
entwickelt.
Jede dieser Hauptschichten läßt eine Anzahl weiterer Schichten unterscheiden:
Der äußerste Teil der l.Zone färbt sich wesentlich dunkler als die übrigen Schichten,
vor allem als die nach innen anschließende Schicht. Die dritte und innerste Schicht ist am
mächtigsten entwickelt und zeigt palisadenförmigen Aufbau.
Die 2. Zone läßt fünf verschiedene Schichten erkennen: drei helle Schichten, welche
zwei, sich dunklerfärbende Schichten zwischen sich einschließen. Die beiden hellen Außenschichten
sind wesentlich mächtiger entwickelt als die helle Mittelschicht.
In der 3. Zone konnte ich nur einen dichtstrukturierten Außenteil und einen schwächeren,
helleren Innenteil unterscheiden.
Insgesamt kann man also in der Markmasse des II. Ganglions zehn verschiedene
Schichten feststellen.
Bei Aeschna befindet sich innerhalb der Markmasse des II. optischen Ganglions eine
kleine Schicht locker angeordneter Zellen, die Z a w a r z in als „innere Körnerschicht“ bezeichnet.
Bei den Wanzen fehlt eine solche Schicht, wie sie ja auch im I. Ganglion fehlt.
Die genauere Analyse des II. Ganglions nehmen wir an H and von Versilberungen vor:
Die Endigungen der aus dem I. Ganglion kommenden hindurchziehenden Fasern
haben wir bereits beschrieben. Es verbleibt uns noch, die genauere Lage dieser Endigungen
festzustellen. Die Fasern des Typus A dringen (Abb. 19) bis zur inneren Schicht der mittleren
Hauptzone vor, wo sie zahlreiche Endverzweigungen bilden. Eine geringere Anzahl
von Seitenästen geben sie auch bei ihrem Verlauf durch die äußere Hauptzone ab. Der palisadenförmige
Bau dieser Außenschicht wird vor allem bedingt durch die Endigungen der
Fasern des Typus B.
Der einheitliche Aufbau der äußeren Körnerschicht des II. optischen Ganglions läßt
erwarten, daß die von den Zellen dieser Schicht entspringenden Fasern ein einheitliches
Zoologien. Heft 93. 4