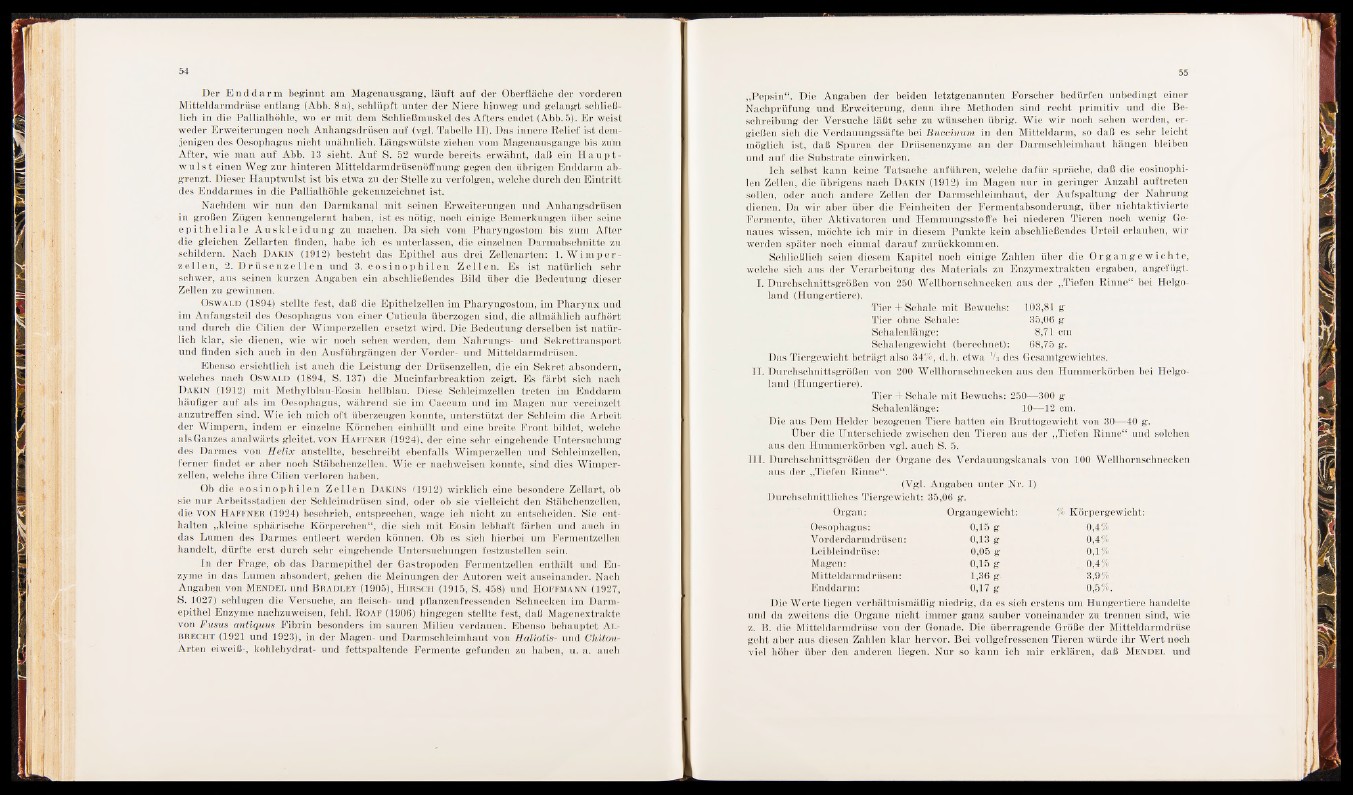
Der E n d da r i n beginnt am Magenausgang, läuft auf der Oberfläche der vorderen
Mitteldarmdrüse entlang (Abb. 8 a), schlüpft unter der Niere hinweg und gelangt schließlich
in die Pallialhöhle, wo er mit dem Schließmuskel des Afters endet (Abb. 5). E r weist
weder Erweiterungen noch Anhangsdrüsen auf (vgl. Tabelle II). Das innere Relief ist demjenigen
des Oesophagus nicht unähnlich. Längswülste ziehen vom Magenausgange bis zum
After, wie man auf Abb. 13 sieht. Auf S. 52 wurde bereits erwähnt, daß ein H a u p t wu
l s t einen Weg zur hinteren Mitteldarmdrüsenöffnung gegen den übrigen Enddarm abgrenzt.
Dieser Hauptwulst ist bis etwa zu der Stelle zu verfolgen, welche durch den E in tritt
des Enddarmes in die Pallialhöhle gekennzeichnet ist.
Nachdem wir nun den Darmkanal mit seinen Erweiterungen und Anhangsdrüsen
in großen Zügen kennengelernt haben, ist es nötig, noch einige Bemerkungen über seine
e p i t h e l i a l e Au s k l e i d u n g zu machen. Da sich vom Pharyngostom bis zum After
die gleichen Zellarten finden, habe ich es unterlassen, die einzelnen Darmabschnitte zu
schildern. Nach Darin (1912) besteht das Epithel aus drei Zellenarten: 1. W im p e r zel
l en, 2. D r ü s e n z e l l e n und 3. e o s i n o p h i l e n Zel l en. Es ist natürlich sehr
schwer, aus seinen kurzen Angaben ein abschließendes Bild über die Bedeutung dieser
Zellen zu gewinnen.
Oswald (1894) stellte fest, daß die Epithelzellen im Pharyngostom, im Pharynx und
im Anf angsteil des Oesophagus von einer Cuticula überzogen sind, die allmählich auf hört
und durch die Cilien der Wimperzellen ersetzt wird. Die Bedeutung derselben ist na tü rlich
klar, sie dienen, wie wir noch sehen werden, dem Nahrungs- und Sekrettransport
und finden sich auch in den Ausführgängen der Vorder- und Mitteldarmdrüsen.
Ebenso ersichtlich ist auch die Leistung der Drüsenzellen, die ein Sekret absondern,
welches nach Oswald (1894, S. 137) die Mucinfarbreaktion zeigt. Es färbt sich nach
Dakin (1912) mit Methylblau-Eosin hellblau. Diese Schleimzellen treten im Enddarm
häufiger auf als im Oesophagus, während sie im Caecum und im Magen nur vereinzelt
anzutreffen sind. Wie ich mich oft überzeugen konnte, unterstützt der Schleim die Arbeit
der Wimpern, indem er einzelne Körnchen einhüllt und eine breite Front bildet, welche
als Ganzes analwärts gleitet. VON H affner (1924), der eine sehr eingehende Untersuchung
des Darmes von Helix anstellte, beschreibt ebenfalls Wimperzellen und Schleimzellen,
ferner findet er aber noch Stäbchenzellen. Wie er nach weisen konnte, sind dies Wimperzellen,
welche ihre Cilien verloren haben.
Ob die e o s i n o p h i l e n Z e l l e n Dakins (1912) wirklich eine besondere Zellart, ob
sie nur Arbeitsstadien der Schleimdrüsen sind, oder ob sie vielleicht den Stäbchenzellen,
die von H affner (1924) beschrieb, entsprechen, wage ich nicht zu entscheiden. Sie enthalten
„kleine sphärische Körperchen“, die sich mit Eosin lebhaft färben und auch in
das Lumen des Darmes entleert werden können. Ob es sich hierbei um Fermentzellen
handelt, dürfte erst durch sehr eingehende Untersuchungen festzustellen sein.
In der Frage, ob das Darmepithel der Gastropoden Fermentzellen enthält und Enzyme
in das Lumen absondert, gehen die Meinungen der Autoren weit auseinander. Nach
Angaben von Mendel und Bradley (1905), Hirsch (1915, S. 458) und Hoffmann (1927,
S. 1027) schlugen die Versuche, an fleisch- und pflanzenfressenden Schnecken im Darmepithel
Enzyme nachzuweisen, fehl. Roaf (1906) hingegen stellte fest, daß Magenextrakte
von Fusus antiquus Fibrin besonders im sauren Milieu verdauen. Ebenso behauptet Al-
brecht (1921 und 1923), in der Magen- und Darmschleimhaut von Haliotis- und Chiton-
Arten eiweiß-, kohlehydrat- und fettspaltende Fermente gefunden zu haben, u. a. auch
„Pepsin“. Die Angaben der beiden letztgenannten Forscher bedürfen unbedingt einer
Nachprüfung und Erweiterung, denn ihre Methoden sind recht primitiv und die Beschreibung
der Versuche läßt sehr zu wünschen übrig. Wie wir noch sehen werden, ergießen
sich die Verdauungssäfte bei Buccinum in den Mitteldarm, so daß es sehr leicht
möglich ist, daß Spuren der Drüsenenzyme an der Darmschleimhaut hängen bleiben
und auf die Substrate ein wirken.
Ich selbst kann keine Tatsache anführen, welche dafür spräche, daß die eosinophilen
Zellen, die übrigens nach Dakin (1912) im Magen nur in geringer Anzahl auftreten
sollen, oder auch andere Zellen der Darmschleimhaut, der Aufspaltung der Nahrung
dienen. Da wir aber über die Feinheiten der Fermentabsonderung, über nichtaktivierte
Fermente, über Aktivatoren und Hemmungsstoffe bei niederen Tieren noch wenig Genaues
wissen, möchte ich mir in diesem Punkte kein abschließendes Urteil erlauben, wir
werden später noch einmal darauf zurückkommen.
Schließlich seien diesem Kapitel noch einige Zahlen über die Or g a n g e w i c h t e ,
welche sich aus der Verarbeitung des Materials zu Enzymextrakten ergaben, angefügt.
I. Durchschnittsgrößen von 250 Wellhornschnecken aus der „Tiefen Rinne“ bei Helgoland
(Hungertiere).
Tier + Schale mit Bewuchs: 103,81 g
Tier ohne Schale: 35,06 g
Schalenlänge: 8,71 cm
Schalengewicht (berechnet): 68,75 g.
Das Tiergewicht beträgt also 34%, d.h. etwa V3 des Gesamtgewichtes.
II. Durchschnittsgrößen von 200 Wellhornschnecken aus den Hummerkörben bei Helgoland
(Hungertiere).
Tier + Schale mit Bewuchs: 250-^300 g
Schalenlänge: 10—12 cm.
Die aus Dem Helder bezogenen Tiere hatten ein Bruttogewicht von 30—40 g.
Über die Unterschiede zwischen den Tieren aus der „Tiefen Rinne“ und solchen
aus den Hummerkörben vgl. auch S. 5.
III. Durchschnittsgrößen der Organe des Verdauungskanals von 100 Wellhornschnecken
aus der „Tiefen Rinne“.
(Vgl. Angaben unter Nr. I)
Durchschnittliches Tiergewicht: 35,06 g.
Organ: Organgewicht: % Körpergewicht:
Oesophagus: 0,15 g 0,4%
Vorderdarmdrüsen: 0,13 g 0,4%
Leibleindrüse: 0,05 g 0,1%
Magen: 0,15 g 0,4%
Mitteldarmdrüsen: 1,36 g 3,9%
Enddarm: 0,17 g 0,5%.
Die Werte liegen verhältnismäßig niedrig, da es sich erstens um Hungertiere handelte
und da zweitens die Organe nicht immer ganz sauber voneinander zu trennen sind, wie
z. B. die Mitteldarmdrüse von der Gonade. Die überragende Größe der Mitteldarmdrüse
geht aber aus diesen Zahlen klar hervor. Bei vollgefressenen Tieren würde ihr Wert noch
viel höher über den anderen liegen. Nur so kann ich mir erklären, daß Mendel und