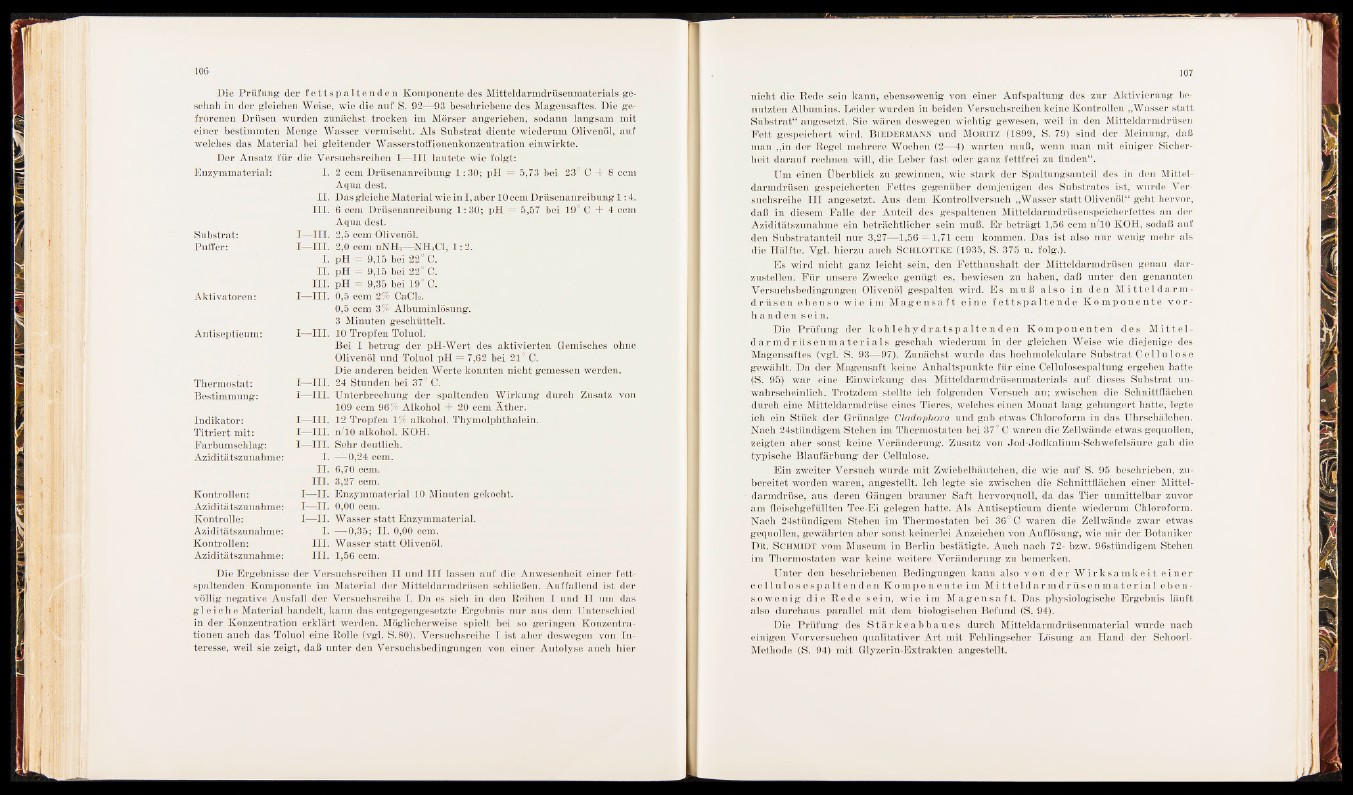
Die Prüfung der f e t t s p a l t e n d e n Komponente des Mitteldarmdrüsenmaterials geschah
in der gleichen Weise, wie die auf S. 92—93 beschriebene des Magensaftes. Die gefrorenen
Drüsen wurden zunächst trocken im Mörser angerieben, sodann langsam mit
einer bestimmten Menge Wasser vermischt. Als Substrat diente wiederum Olivenöl, auf
welches das Material bei gleitender Wasserstoffionenkonzentration einwirkte.
Der Ansatz für die Versuchsreihen I—I I I lautete wie folgt:
Enzymmaterial :
Substrat:
Puffer:
Aktivatoren:
Antisepticum:
Thermostat:
Bestimmung:
Indikator:
Titriert mit:
Farbumschlag:
Aziditätszunahme :
Kontrollen:
Aziditätszunahme :
Kontrolle:
Aziditätszunahme :
Kontrollen:
Aziditätszunahme :
I.
II.
III.
I—III.
É—III.
I.
II.
III.
I—III.
I—III.
I—III.
I—-III.
I - - I I I .
I—III.
I—III.
I.
II.
III.
I—II.
I—II.
I—II.
I.
III.
III.
2 ccm Drüsenanreibung 1:30; pH ¡g|5,73 bei 23° C + 8 ccm
Aqua dest.
Das gleiche Material wie in I, aber 10 ccm Drüsenanreibung 1:4.
6 ccm Drüsenanreibung 1:30; pH = 5,57 bei 19° C + 4 ccm
Aqua dest.
2,5 ccm Olivenöl.
2,0 ccm nNHs—NHiCl, 1: 2.
pH H9,15 bei 22° C.
pH ¡g9,15 bei 22° C.
pH = 9,35 bei 19° C.
0,5 ccm 2% CaCL.
0,5 ccm 3% Albuminlösung.
3 Minuten geschüttelt.
10 Tropfen Toluol.
Bei I betrug der pH-Wert des aktivierten Gemisches ohne
Olivenöl und Toluol pH = 7,62 bei 21° C.
Die anderen beiden Werte konnten nicht gemessen werden.
24 Stunden bei 37° C.
Unterbrechung der spaltenden Wirkung durch Zusatz von
109 ccm 96% Alkohol + 20 ccm Äther.
12 Tropfen 1% alkohol. Thymolphthalein.
n/10 alkohol. KOH.
Sehr deutlich.
¡§1-0,24 ccm.
6,70 ccm.
3,27 ccm.
Enzymmaterial 10 Minuten gekocht.
0,00 ccm.
Wasser statt Enzymmaterial.
— 0,35; II. 0,00 ccm.
Wasser sta tt Olivenöl.
1,56 ccm.
Die Ergebnisse der Versuchsreihen I I und I I I lassen auf die Anwesenheit einer fettspaltenden
Komponente im Material der Mitteldarmdrüsen schließen. Auffallend ist der
völlig negative Ausfall der Versuchsreihe I. Da es sich in den Reihen I und II um das
g l e i c h e Material handelt, kann das entgegengesetzte Ergebnis nur aus dem Unterschied
in der Konzentration erklärt werden. Möglicherweise spielt bei so geringen Konzentrationen
auch das Toluol eine Rolle (vgl. S. 80). Versuchsreihe I ist aber deswegen von In teresse,
weil sie zeigt, daß unter den Versuchsbedingungen von einer Autolyse auch hier
nicht die Rede sein kann, ebensowenig von einer Aufspaltung des zur Aktivierung benutzten
Albumins. Leider wurden in beiden Versuchsreihen keine Kontrollen „Wasser statt
Substrat“ angesetzt. Sie wären deswegen wichtig gewesen, weil in den Mitteldarmdrüsen
Fett gespeichert wird. B i e d e r m a n n und M o r i t z (1899, S. 79) sind der Meinung, daß
man „in der Regel mehrere Wochen (2—4) warten muß, wenn man mit einiger Sicherheit
darauf rechnen will, die Leber fast oder ganz fettfrei zu finden“ .
Um einen Überblick zu gewinnen, wie stark der Spaltungsanteil des in den Mitteldarmdrüsen
gespeicherten Fettes gegenüber demjenigen des Substrates ist, wurde Versuchsreihe
I I I angesetzt. Aus dem Kontrollversuch „Wasser sta tt Olivenöl“ geht hervor,
daß in diesem Falle der Anteil des gespaltenen Mitteldarmdrüsenspeicherfettes an der
Aziditätszunahme ein beträchtlicher sein muß. E r beträgt 1,56 ccm n/10 KOH, sodaß auf
den Substratanteil nur 3,27—1,56 = 1,71 ccm kommen. Das ist also nur wenig mehr als
die Hälfte. Vgl. hierzu auch Schlottke (1935, S. 375 u; folg.).
Es wird nicht ganz leicht sein, den Fetthaushalt der Mitteldarmdrüsen genau darzustellen.
F ü r unsere Zwecke genügt es, bewiesen zu haben, daß unter den genannten
Versuchsbedingungen Olivenöl gespalten wird. E s m u ß al so i n de n M i t t e l d a r m d
r ü s e n e be ns o wi e im Ma g e n s a f t e i ne f e t t s p a l t e n d e K omp o n e n t e v o r h
a n d e n sein.
Die Prüfung der k o h l e h y d r a t s p a l t e n d e n Komp o n e n t e n de s Mi t t e l d
a rm d r ü s e n m a t e r i a l s geschah wiederum in der gleichen Weise wie diejenige des
Magensaftes (vgl. S. 93-—97). Zunächst wurde das hochmolekulare Substrat Ce l l u l o s e
gewählt. Da der Magensaft keine Anhaltspunkte für eine Cellulosespaltung ergeben hatte
(S. 95) war eine Einwirkung des Mitteldarmdrüsenmaterials auf dieses Substrat unwahrscheinlich.
Trotzdem stellte ich folgenden Versuch an; zwischen die Schnittflächen
durch eine Mitteldarmdrüse eines Tieres, welches einen Monat lang gehungert hatte, legte
ich ein Stück der Grünalge Cladophora und gab etwas Chloroform in das Uhrschälchen.
Nach 24stündigem Stehen im Thermostaten bei 37° C waren die Zellwände etwas gequollen,
zeigten aber sonst keine Veränderung. Zusatz von Jod-Jodkalium-Schwefelsäure gab die
typische Blaufärbung der Cellulose.
Ein zweiter Versuch wurde mit Zwiebelhäutchen, die wie auf S. 95 beschrieben, zubereitet
worden waren, angestellt. Ich legte sie zwischen die Schnittflächen einer Mitteldarmdrüse,
aus deren Gängen brauner Saft hervorquoll, da das Tier unmittelbar zuvor
am fleischgefüllten Tee-Ei gelegen hatte. Als Antisepticum diente wiederum Chloroform.
Nach 24stlindigem Stehen im Thermostaten bei 36° C waren die Zellwände zwar etwas
gequollen, gewährten aber sonst keinerlei Anzeichen von Auflösung, wie mir der Botaniker
D r . S c h m i d t vom Museum in Berlin bestätigte. Auch nach 72- bzw. 96stündigem Stehen
im Thermostaten war keine weitere Veränderung zu bemerken.
Unter den beschriebenen Bedingungen kann also v o n d e r Wi r k s am k e i t e i n e r
c e l l u l o s e s p a l t e n d e n K omp o n e n t e im M i t t e l d a rm d r ü s e n m a t e r i a l e b e n s
o w en i g d i e R ed e sein, wi e im Ma g e n s a f t . Das physiologische Ergebnis läuft
also durchaus parallel mit dem biologischen Befund (S. 94).
Die Prüfung des S t ä r k e a b b a u e s durch Mitteldarmdrüsenmaterial wurde nach
einigen Vor versuchen qualitativer Art mit Fehlingscher Lösung an Hand der Schoorl-
Methode (S. 94) mit Glyzerin-Extrakten angestellt.