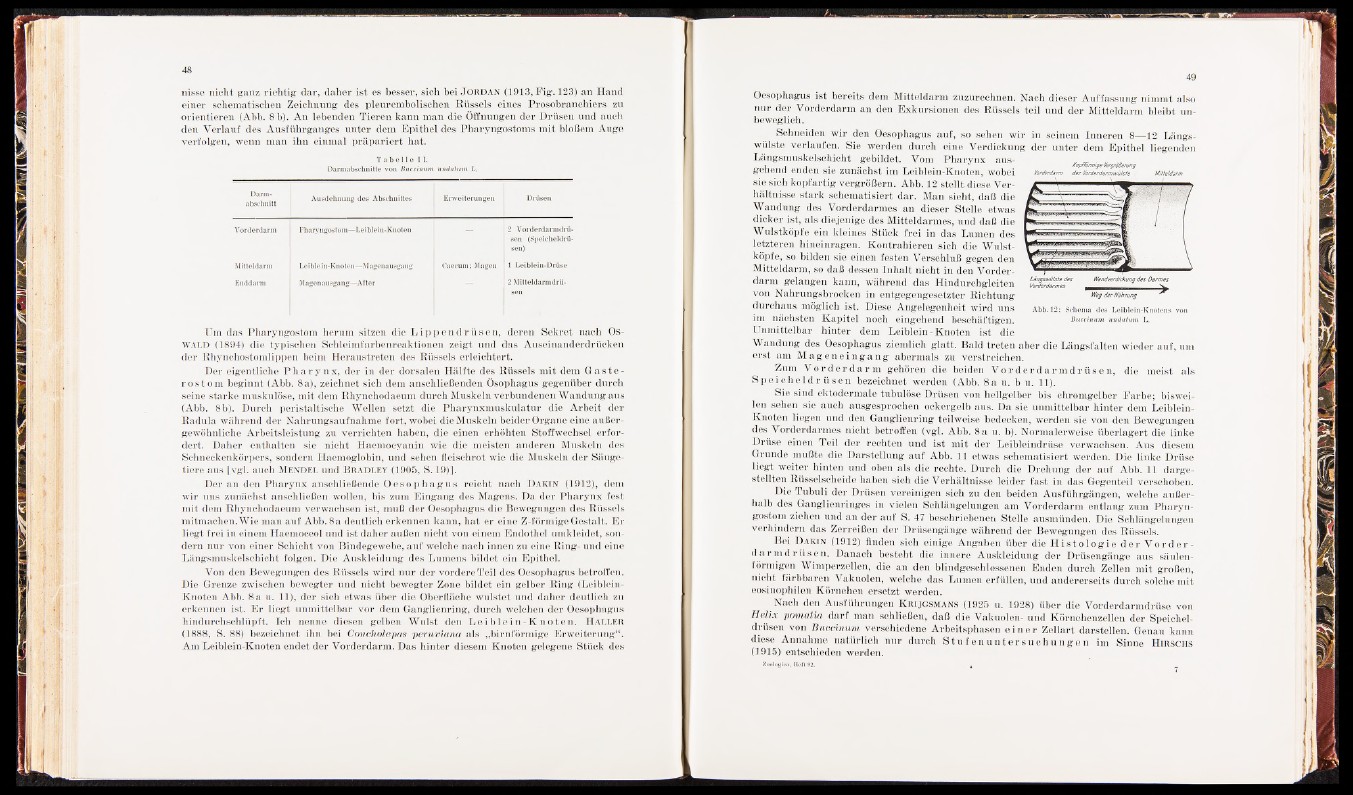
nisse nicht ganz richtig dar, daher ist es besser, sich bei J ordan (1913, Fig. 123) an Hand
einer schematischen Zeichnung des pleurembolischen Rüssels eines Prosobranchiers zu
orientieren (Abb. 8 b). An lebenden Tieren kann man die Öffnungen der Drüsen und auch
den Verlauf des Ausflihrganges unter dem Epithel des Pharyngostoms mit bloßem Auge
verfolgen, wenn man ihn einmal p räpariert hat.
T a b e l l e II.
Darmabschnitte von Buccinum undatum L.
Darxnabschnitt
Ausdehnung des Abschnittes Erweiterungen Drüsen
Vorderdarm Pharyngostom—Leiblein-Knoten 2 Vorderdarmdrüsen
(Speicheldrü-
Mitteldarm Leiblein-Knoten—Magenausgang Caecum; Magen 1 Leiblein-Drüse
Enddarm Magenausgang—After 2 Mitteldarmdrii-
sen
Um das Pharyngostom herum sitzen die L i p p e n d r ü s e n , deren Sekret nach Oswald
(1894) die typischen Schleimfarbenreaktionen zeigt und das Auseinanderdrücken
der Rhynchostomlippen beim Heraustreten des Rüssels erleichtert.
Der eigentliche P h a r y n x , der in der dorsalen Hälfte des Rüssels mit dem G a s t e r
o s t o m begi nnt (Abb. 8a), zeichnet sich dem anschließenden Ösophagus gegenüber durch
seine starke muskulöse, mit dem Rhynchodaeum durch Muskeln verbundenen Wandung aus
(Abb. 8b). Durch peristaltische Wellen setzt die Pharynxmuskulatur die Arbeit der
Radula während der Nahrungsaufnahme fort, wobei die Muskeln beider Organe eine außergewöhnliche
Arbeitsleistung zu verrichten haben, die einen erhöhten Stoffwechsel erfordert.
Daher enthalten sie nicht Haemocyanin wie die meisten anderen Muskeln des
Schneckenkörpers, sondern Haemoglobin, und sehen fleischrot wie die Muskeln der Säugetiere
aus [vgl. auch Mendel und Bradley (1905, S. 19)].
Der an den Pharynx anschließende Oe s o p h a g u s reicht nach Dakin (1912), dem
wir uns zunächst anschließen wollen, bis zum Eingang des Magens. Da der Pharynx fest
mit dem Rhynchodaeum verwachsen ist, muß der Oesophagus die Bewegungen des Rüssels
mitmachen. Wie man auf Abb. 8 a deutlich erkennen kann, hat er eine Z-förmige Gestalt. Er
liegt frei in einem Haemoceol und ist daher außen nicht von einem Endothel umkleidet, sondern
nur von einer Schicht von Bindegewebe, auf welche nach innen zu eine Ring- und eine
Längsmuskelschicht folgen. Die Auskleidung des Lumens bildet ein Epithel.
Von den Bewegungen des Rüssels wird nur der vordere Teil des Oesophagus betroffen.
Die Grenze zwischen bewegter und nicht bewegter Zone bildet ein gelber Ring (Leiblein-
Knoten Abb. 8 a u. 11), der sich etwas über die Oberfläche wulstet und daher deutlich zu
erkennen ist. E r liegt unmittelbar vor dem Ganglienring, durch welchen der Oesophagus
hindurchschlüpft. Ich nenne diesen gelben Wulst den L e i b l e i n - K n o t e n . H aller
(1888, S. 88) bezeichnet ihn bei Concholepas peruviana als „bimförmige Erweiterung“ .
Am Leiblein-Knoten endet der Vorderdarm. Das hinter diesem Knoten gelegene Stück des
Oesophagus ist bereits dem Mitteldarm zuzurechnen. Nach dieser Auffassung nimmt also
nur der Vorderdarm an den Exkursionen des Bussels teil und der Mitteldarm bleibt un-
beweglich.
Schneiden wir den Oesophagus auf, so sehen wir in seinem Inneren 8—12 Längswülste
verlaufen. Sie werden durch eine Verdickung der unter dem Epithel liegenden
Längsmuskelschicht gebildet. Vom Pharynx ausgehend
enden sie zunächst im Leiblein-Knoten, wobei
sie sich kopfartig vergrößern. Abb. 12 stellt diese Verhältnisse
stark schematisiert dar. Man sieht, daß die
Wandung des Vorderdarmes an dieser Stelle etwas
dicker ist, als diejenige des Mitteldarmes, und daß die
Wulstköpfe ein kleines Stück frei in das Lumen des
letzteren hineinragen. Kontrahieren sich die Wulstköpfe,
so bilden sie einen festen Verschluß gegen den
Mitteldarm, so daß dessen Inhalt nicht in den Vorderdarm
gelangen kann, während das Hindurchgleiten
Wandverdickung des Darmes
von Nahrungsbrocken in entgegengesetzter Richtung
durchaus möglich ist. Diese Angelegenheit wird uns
Leiblein-Knotens
im nächsten Kapitel noch eingehend beschäftigen.
undatum L.
Unmittelbar hinter dem Leiblein - Knoten ist die
Wandung des Oesophagus ziemlich glatt. Bald treten aber die Längsfalten wieder auf, um
erst am Ma g e n e i n g a n g abermals zu verstreichen.
Zum V o r d e r d a rm gehören die beiden V o r d e r d a rm d r ü s e n , die meist als
S p e i c h e l d r ü s e n bezeichnet werden (Abb. 8 a u. b u. 11).
Sie sind ektodermale tubulöse Drüsen von hellgelber bis chromgelber Farbe; bisweilen
sehen sie auch ausgesprochen ockergelb aus. Da sie unmittelbar hinter dem Leiblein-
Knoten liegen und den Ganglienring teilweise bedecken, werden sie von den Bewegungen
des Vorderdarmes nicht betroffen (vgl. Abb. 8 a u. b). Normalerweise überlagert die linke
Drüse einen Teil der rechten und ist mit der Leibleindrüse verwachsen. Aus diesem
Grunde mußte die Darstellung auf Abb. 11 etwas schematisiert werden. Die linke Drüse
liegt weiter hinten und oben als die rechte. Durch die Drehung der auf Abb. 11 dargestellten
Rüsselscheide haben sich die'Verhältnisse leider fast in das Gegenteil verschoben.
Die Tubuli der Drüsen vereinigen sich zu den beiden Ausführgängen, welche außerhalb
des Ganglienringes in vielen Schlängelungen am Vorderdarm entlang zum Pharyngostom
ziehen und an der auf S. 47 beschriebenen Stelle ausmünden. Die Schlängelungen
verhindern das Zerreißen der Drüsengänge während der Bewegungen des Rüssels.
Bei Dakin (1912) finden sich einige Angaben über die H i s t o l o g i e d e r Vo r d e r -
d a r m d r ii s e n. Danach besteht die innere Auskleidung der Drüsengänge aus säulenförmigen
Wimperzellen, die an den blindgeschlossenen Enden durch Zellen mit großen,
nicht färbbaren Vakuolen, welche das Lumen erfüllen, und andererseits durch solche mit
eosinophilen Körnchen ersetzt werden.
Nach den Ausführungen K rijgsmans (1925 u. 1928) über die Vorderdarmdrüse von
Helix pomatia darf man schließen, daß die Vakuolen- und Körnchenzellen der Speicheldrüsen
von Buccinum verschiedene Arbeitsphasen e i n e r Zellart darstellen. Genau kann
diese Annahme natürlich nur durch S t u f e n u n t e r s u c h u n g e n im Sinne H irschs
(1915) entschieden werden.