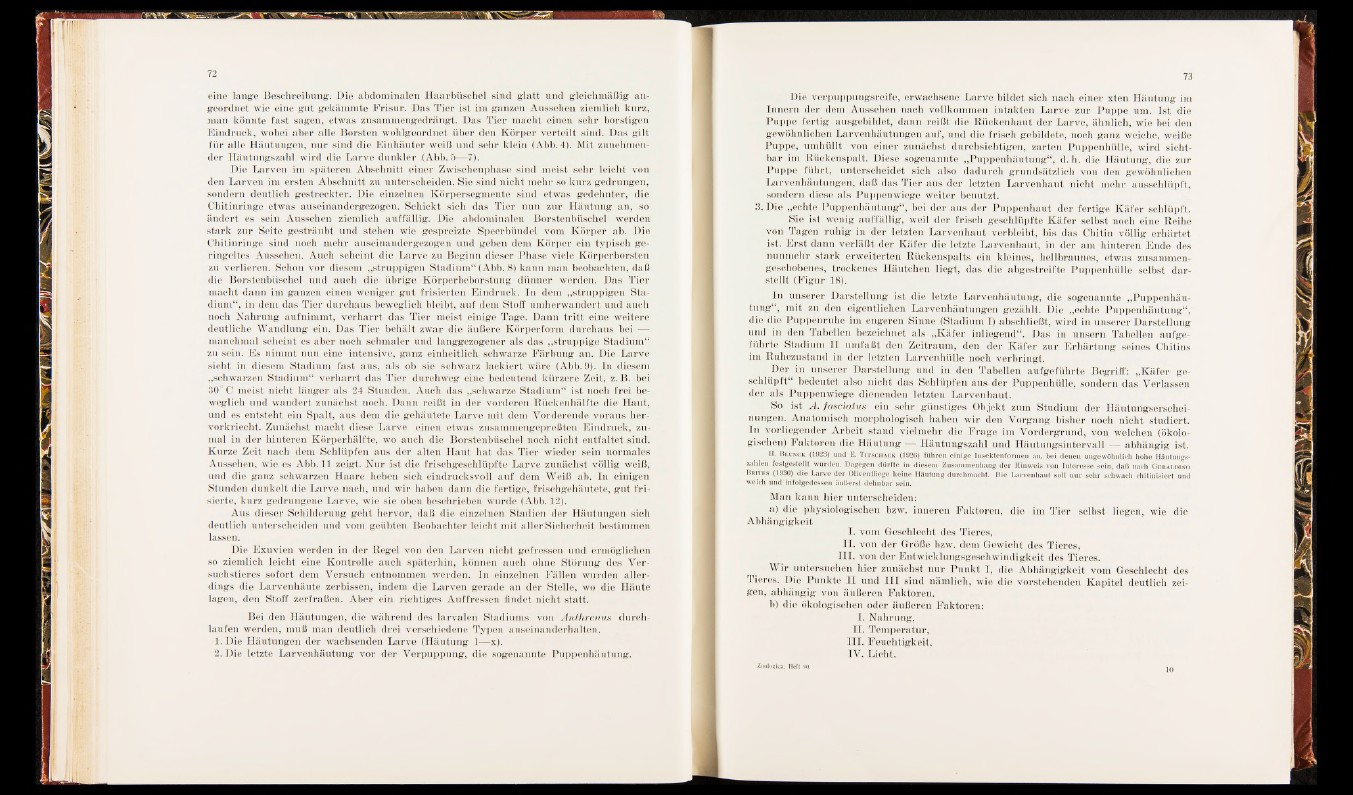
eine lange Beschreibung. Die abdominalen Haarbüschel sind glatt und gleichmäßig angeordnet
wie eine gut gekämmte Frisur. Das Tier ist im ganzen Aussehen ziemlich kurz,
man könnte fast sagen, etwas zusammengedrängt. Das Tier macht einen sehr borstigen
Eindruck, wobei aber alle Borsten wohlgeordnet über den Körper verteilt sind. Das gilt
für alle Häutungen, nur sind die Einhäuter weiß und sehr klein (Abb. 4). Mit zunehmender
Häutungszahl wird die Larve dunkler (Abb. 5—7).
Die Larven im späteren Abschnitt einer Zwischenphase sind meist sehr leicht von
den Larven im ersten Abschnitt zu unterscheiden. Sie sind nicht mehr so kurz gedrungen,
sondern deutlich gestreckter. Die einzelnen Körpersegmente sind etwas gedehnter, die
Chitinringe etwas auseinandergezogen. Schickt sich das Tier nun zur Häutung an, so
ändert es sein Aussehen ziemlich auffällig. Die abdominalen Borstenbüschel werden
stark zur Seite gesträubt und stehen wie gespreizte Speerbündel vom Körper ab. Die
Chitinringe sind noch mehr auseinandergezogen und geben dem Körper ein typisch geringeltes
Aussehen. Auch scheint die Larve zu Beginn dieser Phase viele Körperborsten
zu verlieren. Schon vor diesem „struppigen Stadium“ (Abb. 8) kann man beobachten, daß
die Borstenbüschel und auch die übrige Körperbeborstung dünner werden. Das Tier
macht dann im ganzen einen weniger gut frisierten Eindruck. In dem „struppigen Stadium“,
in dem das Tier durchaus beweglich bleibt, auf dem Stoff umher wandert und auch
noch Nahrung aufnimmt, v e rharrt das Tier meist einige Tage. Dann tr itt eine weitere
deutliche Wandlung ein. Das Tier behält zwar die äußere Körperform durchaus bei —
manchmal scheint es aber noch schmaler und langgezogener als das „struppige Stadium“
zu sein. Es nimmt nun eine intensive, ganz einheitlich schwarze Färbung an. Die Larve
sieht in diesem Stadium fast aus, als ob sie schwarz lackiert wäre (Abb. 9). In diesem
„schwarzen Stadium“ v e rharrt das Tier durchweg eine bedeutend kürzere Zeit, z.B. bei
30° C meist nicht länger als 24 Stunden. Auch das „schwarze Stadium“ ist noch frei beweglich
und wandert zunächst noch. Dann reißt in der vorderen Kückenhälfte die Haut,
und es entsteht ein Spalt, aus dem die gehäutete Larve mit dem Vor der ende voraus hervorkriecht.
Zunächst macht diese Larve einen etwas zusammengepreßten Eindruck, zumal
in der hinteren Körper hälfte, wo auch die Borstenbüschel noch nicht entfaltet sind.
Kurze Zeit nach dem Schlüpfen aus der alten Haut hat das Tier wieder sein normales
Aussehen, wie es Abb. 11 zeigt. Nur ist die frischgeschlüpfte Larve zunächst völlig weiß,
und die ganz schwarzen Haare heben sich eindrucksvoll auf dem Weiß ab. In einigen
Stunden dunkelt die Larve nach, und wir haben dann die fertige, frischgehäutete, gut frisierte,
kurz gedrungene Larve, wie sie oben beschrieben wurde (Abb. 12).
Aus dieser Schilderung geht hervor, daß die einzelnen Stadien der Häutungen sich
deutlich unterscheiden und vom geübten Beobachter leicht mit aller Sicherheit bestimmen
lassen.
Die Exuvien werden in der Regel von den Larven nicht gefressen und ermöglichen
so ziemlich leicht eine Kontrolle auch späterhin, können auch ohne Störung des Versuchstieres
sofort dem Versuch entnommen werden. In einzelnen Fällen wurden allerdings
die Larvenhäute zerbissen, indem die Larven gerade an der Stelle, wo die Häute
lagen, den Stoff zerfraßen. Aber ein richtiges Auffressen findet nicht statt.
Bei den Häutungen, die während des larvalen Stadiums von Anthrenus durchlaufen
werden, muß man deutlich drei verschiedene Typen auseinander halten.
1. Die Häutungen der wachsenden Larve (Häutung 1—x).
2. Die letzte Larvenhäutung vor der Verpuppung, die sogenannte Puppenhäutung.
Die verpuppungsreife, erwachsene Larve bildet sich nach einer xten Häutung im
Innern der dem Aussehen nach vollkommen intakten Larve zur Puppe um. Ist die
Puppe fertig ausgebildet, dann reißt die Rückenhaut der Larve, ähnlich, wie bei den
gewöhnlichen Larvenhäutungen auf, und die frisch gebildete, noch ganz weiche, weiße
Puppe, umhüllt von einer zunächst durchsichtigen, zarten Puppenhülle, wird sichtbar
im Rückenspalt. Diese sogenannte „Puppenhäutung“, d.h. die Häutung, die zur
Puppe führt, unterscheidet sich also dadurch grundsätzlich von den gewöhnlichen
Larvenhäutungen, daß das Tier aus der letzten Larvenhaut nicht mehr ausschlüpft,
sondern diese als Puppenwiege weiter benutzt.
3. Die „echte Puppenhäutung“, bei der aus der Puppenhaut der fertige Käfer schlüpft.
Sie ist wenig auffällig, weil der frisch geschlüpfte Käfer selbst noch eine Reihe
von Tagen ruhig in der letzten Larvenhaut verbleibt, bis das Chitin völlig erhärtet
ist. Erst dann verläßt der Käfer die letzte Larvenhaut, in der am hinteren Ende des
nunmehr stark erweiterten Rückenspalts ein kleines, hellbraunes, etwas zusammengeschobenes,
trockenes Häutchen liegt, das die abgestreifte Puppenhülle selbst darstellt
(Figur 18).
In unserer Darstellung ist die letzte Larvenhäutung, die sogenannte „Puppenhäutung“,
mit zu den eigentlichen Larvenhäutungen gezählt. Die „echte Puppenhäutung“,
die die Puppenruhe im engeren Sinne (Stadium I) abschließt, wird in unserer Darstellung
und in den Tabellen bezeichnet als „Käfer inliegend“. Das in unsern Tabellen aufgeführte
Stadium I I umfaßt den Zeitraum, den der Käfer zur Erhärtung seines Chitins
im Ruhezustand in der letzten Larvenhülle noch verbringt.
Der in unserer Darstellung und in den Tabellen aufgeführte Begriff: „Käfer geschlüpft“
bedeutet also nicht das Schlüpfen aus der Puppenhülle, sondern das Verlassen
der als Puppen wiege dienenden letzten Larven haut.
So ist A. fasciatus ein sehr günstiges Objekt zum Studium der Häutungserscheinungen.
Anatomisch morphologisch haben wir den Vorgang bisher noch nicht studiert,
ln vorliegender Arbeit stand vielmehr die Frage im Vordergrund, von welchen (ökologischen)
Faktoren die Häutung —- Häutungszahl und Häutungsintervall — abhängig ist.
H. Blunck (1923) und E. T itschack (1926) führen einige Insektenformen an, bei denen ungewöhnlich hohe Häutungszahlen
festgestellt wurden. Dagegen dürfte in diesem Zusammenhang der Hinweis von Interesse sein, daß nach Ge ra ld in o
Br it e s (1930) die Larve der Oüvenfliege keine Häutung durchmacht. Die Larvenhaut soll nur sehr schwach chitinisiert und
weich und infolgedessen äußerst dehnbar sein.
Man kann hier unterscheiden:
a) die physiologischen bzw. inneren Faktoren, die im Tier selbst liegen, wie die
Abhängigkeit
I. vom Geschlecht des Tieres,
II. von der Größe bzw. dem Gewicht des Tieres,
III. von der Entwicklungsgeschwindigkeit des Tieres.
Wir untersuchen hier zunächst nur Punkt I, die Abhängigkeit vom Geschlecht des
Tieres. Die Punkte I I und I I I sind nämlich, wie die vorstehenden Kapitel deutlich zeigen,
abhängig von äußeren Faktoren.
b) die ökologischen oder äußeren Faktoren:
I. Nahrung,
II. Temperatur,
III. Feuchtigkeit,
IV. Licht.
Zoologien, Heft 90. 10