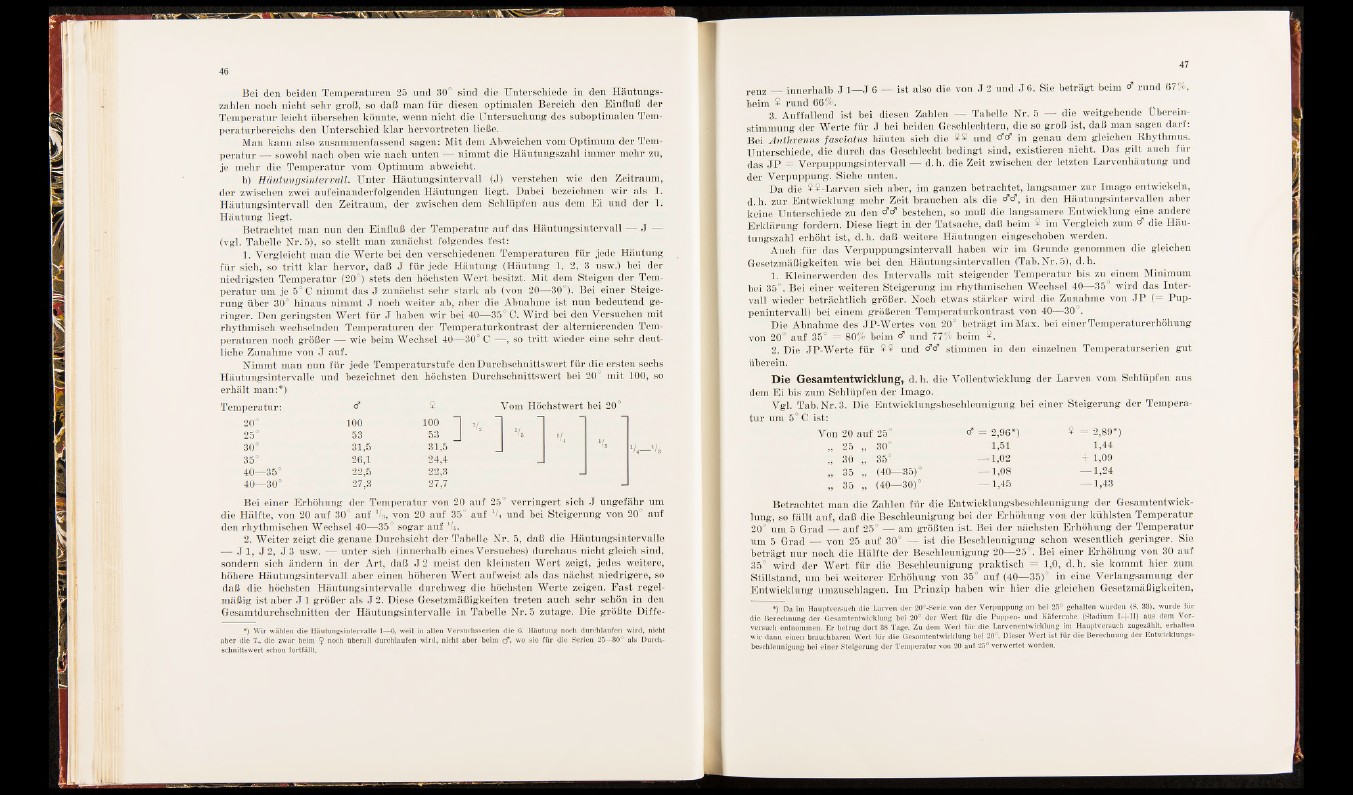
Bei den beiden Temperaturen 25 und 30° sind die Unterschiede in den Häutungszahlen
noch nicht sehr groß, so daß man für diesen optimalen Bereich den Einfluß der
Temperatur leicht übersehen könnte, wenn nicht die Untersuchung des suhoptimalen Temperaturbereichs
den Unterschied klar hervortreten ließe.
Man kann also zusammenfassend sagen: Mit dem Ab weichen vom Optimum der Temperatur
— sowohl nach oben wie nach unten -9 nimmt die Häutungszahl immer mehr zu,
je mehr die Temperatur vom Optimum abweicht.
b) Häutungsintervall. Unter Häutungsintervall (J) verstehen wie den Zeitraum,
der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Häutungen liegt. Dabei bezeichnen wir als 1.
Häutungsintervall den Zeitraum, der zwischen dem Schlüpfen aus dem Ei und der 1.
Häutung liegt.
Betrachtet man nun den Einfluß der Temperatur auf das Häutungsintervall — J ^ 9
(vgl. Tabelle Nr. 5), so stellt man zunächst folgendes fest:
1. Vergleicht man die Werte bei den verschiedenen Temperaturen für jede Häutung
fü r sich, so tr itt klar hervor, daß J für jede Häutung (Häutung 1, 2, 3 usw.) bei der
niedrigsten Temperatur (20°) stets den höchsten Wert besitzt. Mit dem Steigen der Temperatur
um je 5° C nimmt das J zunächst sehr stark ab (von 20—30°). Bei einer Steigerung
über 30° hinaus nimmt J noch weiter ab, aber die Abnahme ist nun bedeutend geringer.
Den geringsten Wert für J haben wir bei 40* 35' O. Wird bei den Versuchen mit
rhythmisch wechselnden Temperaturen der Temperaturkontrast der alternierenden Temperaturen
noch größer — wie beim Wechsel 40 *30G 9 so tritt wieder eine Sehr deüt j
liehe Zunahme von J auf.
Nimmt man nun fü r jede Temperaturstufe den Durchschnittswert für die ersten sechs
Häutungsintervalle und bezeichnet den höchsten Durchschnittswert bei 20" mit 100, so
erhält man:*)
Vom Höchstwert bei 20°
100
53
100 1
53 J
*/,
ru
31,5 31,5
26,1 24,4 _
35° 22,5 22 3 -
30° 27,3 27,7 -
I S S
Temperatur:
20°
25°
30°
35°
40-
10 B
Bei einer Erhöhung der Temperatur von 20 auf 25° verringert sich J ungefähr um
die Hälfte, von 20 auf 30° auf V3, von 20 auf 35° auf 1li und hei Steigerung von 20° auf
den rhythmischen Wechsel 40—35° sogar auf :/„.
2. Weiter zeigt die genaue Durchsicht der Tabelle Nr. 5, daß die Häutungsintervalle
B - J 1, J 2, J 3 usw. B unter sich (innerhalb eines Versuches) durchaus nicht gleich sind,
sondern sich ändern in der Art, daß J 2 meist den kleinsten Wert zeigt, jedes weitere,
höhere Häutungsintervall aber einen höheren Wert aufweist als das nächst niedrigere, so
daß die höchsten Häutungsintervalle durchweg die höchsten Werte zeigen. Fa st regelmäßig
ist aber J 1 größer als J 2. Diese Gesetzmäßigkeiten treten auch sehr schön in den
Gesamtdurchschnitten der Häutungsintervalle in Tabelle Nr. 5 zutage. Die größte Diffe-
*) Wir wählen die Häutungsintervalle 1—6, weil in allen Versuchsserien die 6. Häutung noch durchlaufen wird, nicht
aber die 7., die zwar beim $ noch überall durchlaufen wird, nicht aber beim cf, wo sie für die Serien 25—30° als Durchschnittswert
schon fortfällt.
renz -Ä n n e rh a lb J 1—J 6 — ist also die von J 2 und J 6. Sie beträgt beim rund 67%,
beim ® rund 60%.
3, Auffallend ist hei diesen Z ah lenM jTab elle Nr. die weitgehende Übereinstimmung
der Werte für J bei beiden Geschlechtern, die so groß ist, daß man sagen darf:
Bei Anthremts faseiatus häuten sich die * '* und cf cf in genau dem gleichen Rhythmus.
Unterschiede, die durch das Geschlecht bedingt sind, existieren nicht. Das gilt auch für
das J P : VerpuppungsintervallE- d. h. die Zeit zwischen der letzten Larvenhäutung und
der Verpuppung. Siehe unten.
Da die -Larven sich aber, im ganzen betrachtet, langsamer zur Imago entwickeln,
d.h. zur Entwicklung mehr Zeit brauchen als die <W, in den Häutungsintervallen aber
keine Unterschiede zu den <?<? bestehen, so muß die langsamere Entwicklung eine andere
Erklärung fordern. Dieb® liegt in der Tatsache, daß beim S m Vergleich zum cf die Häutungszahl
erhöht ist, d.h. daß weitere Häutungen eiügesehoben werden.
Auch fü r das Verpuppungsintervall haben wir im Grunde genommen die gleichen
Gesetzmäßigkeiten wie bei den Häutungsintervallen (Tab,Nr.5), d.h.
1. Kl einer werden das Intervalls mit steigender Temperatur bis zu einem Minimum
bei 35?a Bei einer weiteren Steigerung im rhythmischen Wechsel 40—35° wird das Intervall
wieder beträchtlich größer. Noch etwas stärker wird die Zunahme von J P (= Pup-
peninterväll) bei einem größeren Temperaturkontrast, von 40 .30 .
Die Abnahme des JP-Wertes von 20° beträgt im Max. bei einer Temperaturerböhung
von 20° auf 35° § 80% beim cf und 77% f a n ' L f t
2. Die JP-Werte für W und efef stimmen in den einzelnen Temperaturserien gut
überein.
Die Gesamtentwicklung, d. h. die Vollentwicklung der Larven vom Schlüpfen aus
dem Ei bis zum Schlüpfen der Imago.
Vgl. Tab. Nr. 3. Die Entwicklungsbeschleunigung bei einer Steigerung der Temperatu
r um 5 0 ist:
Von 20 auf 25° <? =Ä,96*) 2,89*)
„ 25 „ 30° 1,51 1,44
„ 30 „ 35° : | | ^ ^ ^ B - , 0 2 + 1,09
„ 35 „ (40—35)h^ —1,08 — 1,24
„ 35 „ (40— 30)° — 1,45 — 1,43
Betrachtet man die Zahlen für die Entwicklungsbeschleunigung der Gesamtentwicklung,
so fällt auf, daß die Beschleunigung bei der Erhöhung von der kühlsten Temperatur
20° um 5 Grad 3 auf 2 5H B am größten ist. Bei der nächsten Erhöhung der Temperatur
um 5 Grad — von 25 auf 30° — ist die Beschleunigung schon wesentlich geringer. Sie
beträgt nur noch die Hälfte der Beschleunigung 20—25°. Bei einer Erhöhung von 30 auf
35° wird der' Wert fü r die Beschleunigung praktisch aB L o , d.h. sie kommt hier zum
Stillstand, um bei weiterer Erhöhung von 35® auf (40— 35)° in eine Verlangsamung der
Entwicklung nmzuschlagen. Im Prinzip haben wir hier die gleichen Gesetzmäßigkeiten,
*) Da im Hauptversuch die Larven der 20°-Serie von der Verpuppung an bei 25° gehalten wurden (S. 33), wurde für
die Berechnung der Gesamtentwicklung bei 20° der Wert für die Puppen- und Käferruhe (Stadium I + I I ) aus dem Vorversuch
entnommen. Er betrug dort 38 Tage. Zu dem Wert für die Larvenentwicklung im Hauptversuch zugezählt, erhalten
wir dann einen brauchbaren Wert für die Gesamtentwicklung bei 20°. Dieser Wert ist für die Berechnung der Entwicklungsbeschleunigung
bei einer Steigerung der Temperatur von 20 auf 25° verwertet worden.