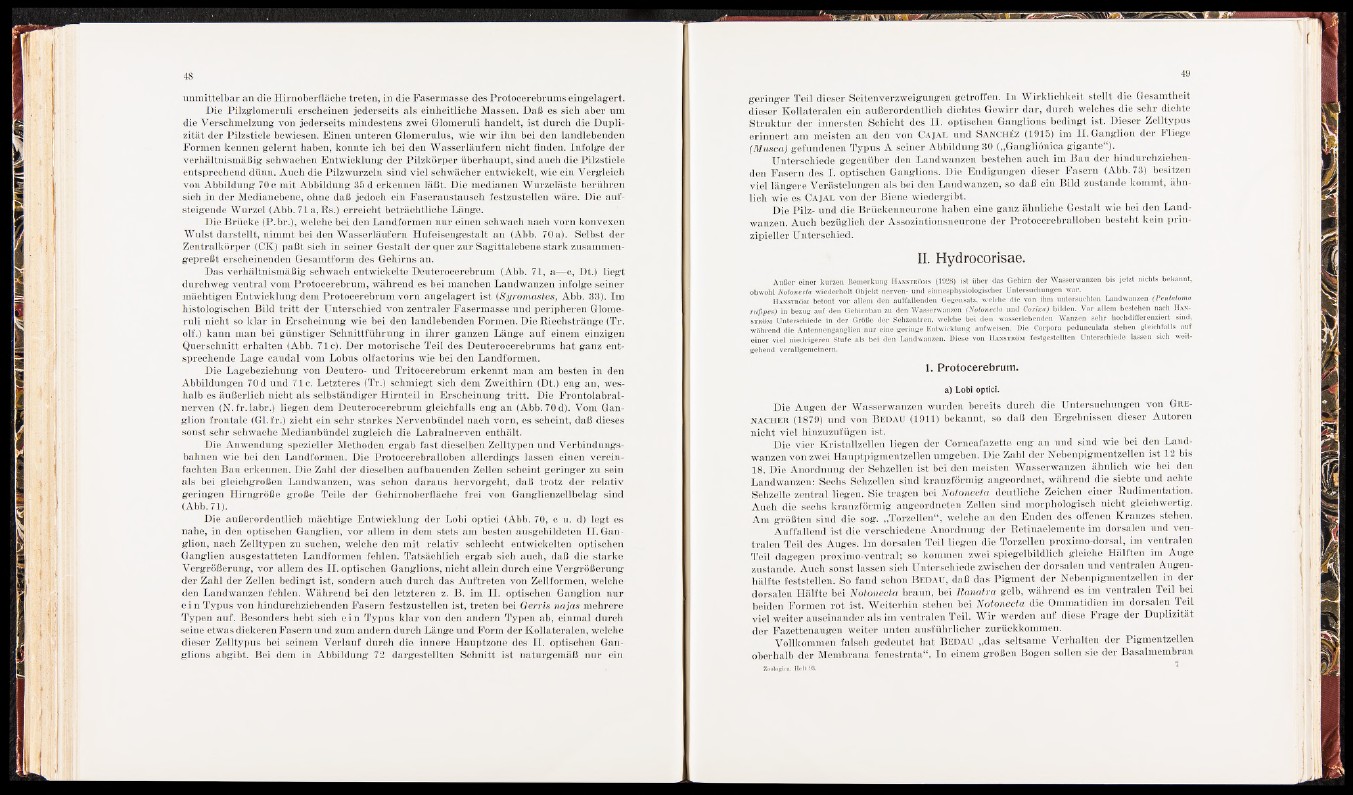
unmittelbar an die Hirnoberfläche treten, in die Fasermasse des Protocerebrums eingelagert.
Die Pilzglomeruli erscheinen jederseits als einheitliche Massen. Daß es sich aber um
die Verschmelzung von jederseits mindestens zwei Glomeruli handelt, ist durch die Duplizität
der Pilzstiele bewiesen. Einen unteren Glomerulus, wie wir ihn bei den landlebenden
Formen kennen gelernt haben, konnte ich bei den Wasserläufern nicht finden. Infolge der
verhältnismäßig schwachen Entwicklung der Pilzkörper überhaupt, sind auch die Pilzstiele
entsprechend dünn. Auch die Pilzwurzeln sind viel schwächer entwickelt, wie ein Vergleich
von Abbildung 70 c mit Abbildung 35 d erkennen läßt. Die medianen Wurzeläste berühren
sich in der Medianebene, ohne daß jedoch ein Faseraustausch festzustellen wäre. Die aufsteigende
Wurzel (Abb. 71 a, Rs.) erreicht beträchtliche Länge.
Die Brücke (P.br.), welche bei den Landformen nur einen schwach nach vorn konvexen
Wulst darstellt, nimmt bei den Wasser läufern Hufeisengestalt an (Abb. 70a). Selbst der
Zentralkörper (CK) paßt sich in seiner Gestalt der quer zur Sagittalebene stark zusammengepreßt
erscheinenden Gesamtform des Gehirns an.
Das verhältnismäßig schwach entwickelte Deuterocerebrum (Abb. 71, a—c, Dt.) liegt
durchweg ventral vom Protocerebrum, während es bei manchen Landwanzen infolge seiner
mächtigen Entwicklung dem Protocerebrum vorn angelagert ist (Syromastes, Abb. 33). Im
histologischen Bild tritt der Unterschied von zentraler Fasermasse und peripheren Glomeruli
nicht so klar in Erscheinung wie bei den landlebenden Formen. Die Biechstränge (Tr.
olf.) kann man bei günstiger Schnittführung in ihrer ganzen Länge auf einem einzigen
Querschnitt erhalten (Abb. 71c). Der motorische Teil des Deuterocerebrums hat ganz entsprechende
Lage caudal vom Lobus olfactorius wie bei den Landformen.
Die Lagebeziehung von Deutero- und Tritocerebrum erkennt man am besten in den
Abbildungen 70 d und 71c. Letzteres (Tr.) schmiegt sich dem Zweithirn (Dt.) eng an, weshalb
es äußerlich nicht als selbständiger Hirnteil in Erscheinung tritt. Die Frontolabral-
nerven (N. fr. labr.) liegen dem Deuterocerebrum gleichfalls eng an (Abb. 70 d). Vom Ganglion
frontale (Gl. fr.) zieht ein sehr starkes Nervenbündel nach vorn, es scheint, daß dieses
sonst sehr schwache Medianbündel zugleich die Labrainerven enthält.
Die Anwendung spezieller Methoden ergab fast dieselben Zelltypen und Verbindungsbahnen
wie bei den Landformen. Die Protocerebralloben allerdings lassen einen vereinfachten
Bau erkennen. Die Zahl der dieselben aufbauenden Zellen scheint geringer zu sein
als bei gleichgroßen Landwanzen, was schon daraus hervorgeht, daß trotz der relativ
geringen Hirngröße große Teile der Gehirnoberfläche frei von Ganglienzellbelag sind
(Abb. 71).
Die außerordentlich mächtige Entwicklung der Lobi optici (Abb. 70, c u. d) legt es
nahe, in den optischen Ganglien, vor allem in dem stets am besten ausgebildeten II. Ganglion,
nach Zelltypen zu suchen, welche den mit relativ schlecht entwickelten optischen
Ganglien ausgestatteten Landformen fehlen. Tatsächlich ergab sich auch, daß die starke
Vergrößerung, vor allem des II. optischen Ganglions, nicht allein durch eine Vergrößerung
der Zahl der Zellen bedingt ist, sondern auch durch das Auftreten von Zellformen, welche
den Landwanzen fehlen. Während bei den letzteren z. B. im II. optischen Ganglion nur
e in Typus von hindurchziehenden Fasern festzustellen ist, treten bei Gerris najas mehrere
Typen auf. Besonders hebt sich e in Typus klar von den ändern Typen ab, einmal durch
seine etwas dickeren Fasern und zum ändern durch Länge und Form der Kollateralen, welche
dieser Zelltypus bei seinem Verlauf durch die innere Hauptzone des II. optischen Ganglions
abgibt. Bei dem in Abbildung 72 dargestellten Schnitt ist naturgemäß nur ein
geringer Teil dieser Seitenverzweigungen getroffen. In Wirklichkeit stellt die Gesamtheit
dieser Kollateralen ein außerordentlich dichtes Gewirr dar, durch welches die sehr dichte
Struktur der innersten Schicht des II. optischen Ganglions bedingt ist. Dieser Zelltypus
erinnert am meisten an den von Ca ja l und S anchez (1915) im II. Ganglion der Fliege
(Musca) gefundenen Typus A seiner Abbildung 30 („Gangliönica gigante“).
Unterschiede gegenüber den Landwanzen bestehen auch im Bau der hindurchziehenden
Fasern des I. optischen Ganglions. Die Endigungen dieser Fasern (Abb. 73) besitzen
viel längere Verästelungen als bei den Landwanzen, so daß ein Bild zustande kommt, ähnlich
wie es Ca ja l von der Biene wiedergibt.
Die Pilz- und die Brückenneurone haben eine ganz ähnliche Gestalt wie bei den Landwanzen.
Auch bezüglich der Assoziationsneurone der Protocerebralloben besteht kein prinzipieller
Unterschied.
II. Hydrocorisae.
Außer einer kurzen Bemerkung H anströms (1928) ig t über das Gehirn der Wasserwanzen bis jetzt nichts bekannt,
obwohl Notonecta wiederholt Objekt nerven- und sinnesphisioldgäscher Untersuchungen war,
H a n s t r ö m betont vor allem den auffallenden Gegensatz, welche die von ihm untersuchten Landwanzen (Pentatoma
rufipec) in bezug auf den Gehirnbau zu den Wasserwanzen (Notonecla und Gorixa) bilden. Vor allem bestehen nach H a n s
t r ö m Unterschiede in der Größe der Sehzentren, welche bei ddn wasserlebenden. Wanzen sehr hochdiflerenziert sind,
während die Antennehgänglien n ur eine geringe Entwicklung aufweisen. Die Corpora pedunculata stehen gleichfalls auf
einer viel niedrigeren Stufe als bei den Landwanzen. Diese von H a n s t r ö m festgestellten Unterschiede lassen sich, weit-
gehend verallgemeinern.
1. Protocerebrum.
a) Lobi optici.
Die Augen der Wasserwanzen wurden bereits durch die Untersuchungen von Gr e -
NACHER (1879) und von B e d a u (1911) bekannt, so daß den Ergebnissen dieser Autoren
nicht viel hinzuzufügen ist.
Die vier Kristallzellen liegen der Corneafazette eng an und sind wie bei den Landwanzen
von zwei Hauptpigmentzellen umgeben. Die Zahl der Nebenpigmentzellen ist 12 bis
18. Die Anordnung der Sehzellen ist bei den meisten Wasserwanzen ähnlich wie hei den
Landwanzen: Sechs Sehzellen sind kranzförmig angeordnet, während die siebte und achte
Sehzelle zentral liegen. Sie tragen hei Notonecta deutliche Zeichen einer Kudimentation.
Auch die sechs kranzförmig angeordneten Zellen sind morphologisch nicht gleichwertig.
Am größten sind die sog. „Torzellen“, welche an den Enden des offenen Kranzes stehen.
Auffallend ist die verschiedene Anordnung der Retinaelemente im dorsalen und ventralen
Teil des Auges. Im dorsalen Teil liegen die Torzellen proximo-dorsal, im ventralen
Teil dagegen proximo-ventral; so kommen zwei spiegelbildlich gleiche Hälften im Auge
zustande. Auch sonst lassen sich Unterschiede zwischen der dorsalen und ventralen Augenhälfte
feststellen. So fand schon B e d a u , daß das Pigment der Nebenpigmentzellen in der
dorsalen Hälfte bei Notonecta braun, bei Ranatra gelb, während es im ventralen Teil bei
beiden Formen rot ist. Weiterhin stehen hei Notonecta die Ommatidien im dorsalen Teü
viel weiter auseinander als im ventralen Teil, Wir werden auf diese Frage der Duplizität
der Fazettenangen weiter unten ausführlicher zurückkommen.
Vollkommen falsch gedeutet hat B ed a u „das seltsame Verhalten der Pigmentzellen
oberhalb der Membrana fenestrata“. In einem großen Bogen sollen sie der Basalmembran
Zo o lo g ie - Holl 93. 7