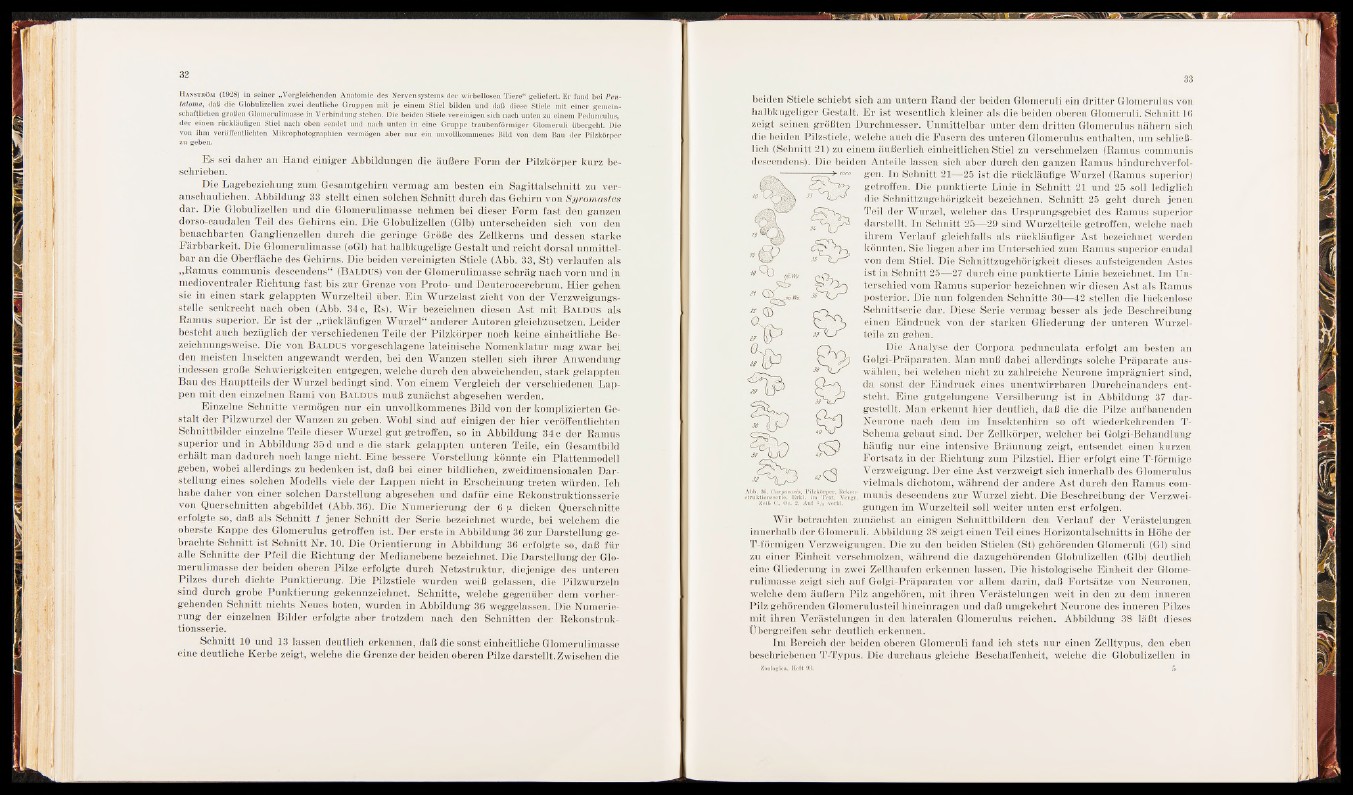
H a n s t r ö m (1 9 2 8 ) in seiner „Vergleichenden Anatomie des Nervensystems der wirbellosen Tiere“ geliefert. Er fand bei Pen-
tatoma, daß die Globulizellen zwei deutliche Gruppen mit je einem Stiel bilden und daß diese Stiele mit einer gemeinschaftlichen
großen Glomerulimasse in Verbindung stehen. Die beiden Stiele vereinigen sich nach unten zu einem Pedunculus,
der einen rückläufigen Stiel nach oben sendet und nach unten in eine Gruppe traubenförmiger Glomeruli übergeht. Die
von ihm veröffentlichten Mikrophotographien vermögen aber nur ein unvollkommenes Bild von dem Bau der Pilzkörper
zu geben.
Es sei daher an Hand einiger Abbildungen die äußere Eorm der Pilzkörper kurz beschrieben.
Die Lagebeziehung zum Gesamtgehirn vermag am besten ein Sagittalsehnitt zu veranschaulichen.
Abbildung 33 stellt einen solchen Schnitt durch das Gehirn von Syromastes
dar. Die Globulizellen und die Glomerulimasse nehmen bei dieser Eorm fast den ganzen
dorso-eaudalen Teil des Gehirns ein. Die Globulizellen (Gib) unterscheiden sich von den
benachbarten Ganglienzellen durch die geringe Größe des Zellkerns und dessen starke
Färbbarkeit. Die Glomerulimasse (oGl) hat halbkugelige Gestalt und reicht dorsal unmittelbar
an die Oberfläche des Gehirns. Die beiden vereinigten Stiele (Abb. 33, St) verlaufen als
„Ramus communis descendens“ (BaldüS) von der Glomerulimasse schräg nach vorn und in
medioventraler Richtung fast bis zur Grenze von Proto- und Deuterocerebrum. Hier gehen
sie in einen stark gelappten Wurzelteil über. Ein Wurzelast Zieht von der Verzweigungsstelle
senkrecht nach oben (Abb. 34 c, Rs). Wir bezeichnen diesen Ast mit Baldüs als
Ramns superior. E r ist der „rückläufigen Wurzel“ anderer Antoren gleiehzusetzen. Leider
besteht auch bezüglich der verschiedenen Teile der Pilzkörper noch keine einheitliche Bezeichnungsweise.
Die von Baldus vorgeschlagene lateinische Nomenklatur mag zwar bei
den meisten Insekten angewandt werden, bei den Wanzen stellen sich ihrer Anwendung
indessen große Schwierigkeiten entgegen, welche durch den abweichenden, stark gelappten
Bau des Haüptteils^der Wurzel bedingt sind. Von einem Vergleich der verschiedenen Lappen
mit den einzelnen Rami von Baldus muß zunächst abgesehen werden.
Einzelne Schnitte vermögen nur ein unvollkommenes Bild von der komplizierten Gestalt
der Pilzwurzel der Wanzen zu geben. Wohl sind auf einigen der hier veröffentlichten
Schnittbilder einzelne Teile dieser Wurzel gut getroffen, so in Abbildung 34 c der Ramus:
superior und in Abbildung 35 d und e die stark gelappten unteren Teile, ein Gesamtbild
erhält man dadurch noch lange nicht. Eine bessere Vorstellung könnte ein Plattenmodell
geben, wobei allerdings zu bedenken ist, daß bei einer bildlichen, zweidimensionalen Darstellung
eines solchen Modells viele der Lappen nicht in Erscheinung treten würden. Ich
habe daher von einer solchen Darstellung abgesehen und dafür eine Rekonstruktionsserie
von Querschnitten abgebildet (Abb. 36). Die Numerierung der 6 |* dicken Querschnitte
erfolgte so, daß als Schnitt 1 jener Schnitt der Serie bezeichnet wurde, bei welchem die
oberste Kappe des Glomerulus getroffen ist. Der erste in Abbildung 36 zur Darstellung gebrachte
Schnitt ist Schnitt Nr. 10. Die Orientierung in Abbildung 36 erfolgte so, daß für
alle Schnitte der Pfeil die Richtung der Medianebene bezeichnet. Die D arstellung der Glomerulimasse
der beiden oberen Pilze erfolgte durch Netzstruktur, diejenige des unteren
Pilzes durch dichte Punktierung. Die Pilzstiele wurden weiß gelassen, die Pilzwurzeln
sind durch grobe Punktierung gekennzeichnet. Schnitte, welche gegenüber dem vorhergehenden
Schnitt nichts Neues boten, wurden in Abbildung 36 weggelassen. Die Numerierung
der einzelnen Bilder erfolgte aber trotzdem nach den Schnitten der Rekonstruk-
tionsserie.
Schnitt 10 und 13 lassen deutlich erkennen, daß die sonst einheitliche Glomerulimasse
eine deutliche Kerbe zeigt, welche die Grenze der beiden oberen Pilze darstellt. Zwischen die
beiden Stiele schiebt sich am untern Rand der beiden Glomeruli ein dritter Glomerulus von
halbkugeliger Gestalt. E r ist wesentlich kleiner als die beiden oberen Glomeruli. Schnitt 16
zeigt seinen größten Durchmesser. Unmittelbar unter dem dritten Glomerulus nähern sich
die beiden Pilzstiele, welche auch die Fasern des unteren Glomerulus enthalten, um schließlich
(Schnitt 21) zu einem äußerlich einheitlichen Stiel zu verschmelzen (Ramus communis
descendens). Die beiden Anteile lassen sich aber durch den ganzen Ramus hindurchverfolgen.
In Schnitt 21—25 ist die rückläufige Wurzel (Ramus superior)
getroffen. Die punktierte Linie in Schnitt 21 und 25 «oll lediglich
die Schnittzugehörigkeit bezeichnen. Schnitt 25 geht durch jenen
Teil der Wurzel, welcher das Ursprungsgebiet des Ramus superior
darstellt. In Schnitt 25—29 sind Wurzelteile getroffen, welche nach
ihrem Verlauf gleichfalls als rückläufiger Ast bezeichnet werden
könnten. Sie liegen aber im Unterschied zum Ramus superior caudal
von dem Stiel. Die Schnittzugehörigkeit dieses aufsteigenden Astes
ist in Schnitt 25—27 durch eine punktierte Linie bezeichnet. Im Unterschied
vom Ramus superior bezeichnen wir diesen Ast als Ramus
posterior. Die nun folgenden Schnitte 30—42 stellen die lückenlose
Schnittserie dar. Diese Serie vermag besser als jede Beschreibung
einen Eindruck von der starken Gliederung der unteren Wurzelteile
zu gehen.
Die Analyse der Corpora pedunculata erfolgt am besten an
Golgi-Präparaten. Man muß dabei allerdings solche Präparate auswählen,
bei welchen nicht zu zahlreiche Neurone imprägniert sind,
da sonst der Eindruck eines unentwirrbaren Durcheinanders entsteht.
Eine gutgelungene Versilberung ist in Abbildung 37 dargestellt.
Man erkennt hier deutlich, daß die die Pilze aufbauenden
Neurone nach dem im Insektenhirn so oft wiederkehrenden T-
Schema gebaut sind. Der Zellkörper, welcher bei Golgi-Behandlung
häufig nur eine intensive Bräunung zeigt, entsendet einen kurzen
Fortsatz in der Richtung zum Pilzstiel. Hier erfolgt eine T-förmige
Verzweigung. Der eine Ast verzweigt sich innerhalb des Glomerulus
vielmals dichotom, während der andere Ast durch den Ramus com-
struktionsserie. Erki. im Text, vergr. munis descendens zur Wurzel zieht. Die Beschreibung der Verzwei-
C1 ' *' " iU 6 tr' - gungen im Wurzelteil soll weiter unten erst erfolgen.
Wir betrachten zunächst an einigen Schnittbildern den Verlauf der Verästelungen
innerhalb der Glomeruli. Abbildung 38 zeigt einen Teil eines Horizontalschnitts in Höhe der
T-förmigen Verzweigungen. Die zu den beiden Stielen (St) gehörenden Glomeruli (Gl) sind
zu einer Einheit verschmolzen, während die dazugehörenden Globulizellen (Gib) deutlich
eine Gliederung in zwei Zellhaufen erkennen lassen. Die histologische Einheit der Glomerulimasse
zeigt sich auf Golgi-Präparaten vor allem darin, daß Fortsätze von Neuronen,
welche dem äußern Pilz angehören, mit ihren Verästelungen weit in den zu dem inneren
Pilz gehörenden Glomerulusteil hineinragen und daß umgekehrt Neurone des inneren Pilzes
mit ihren Verästelungen in den lateralen Glomerulus reichen. Abbildung 38 läßt dieses
Übergreifen sehr deutlich erkennen.
Im Bereich der beiden oberen Glomeruli fand ich stets nur einen Zelltypus, den eben
beschriebenen T-Typus. Die durchaus gleiche Beschaffenheit, welche die Globulizellen in
Zoologien. Heft 93. 5