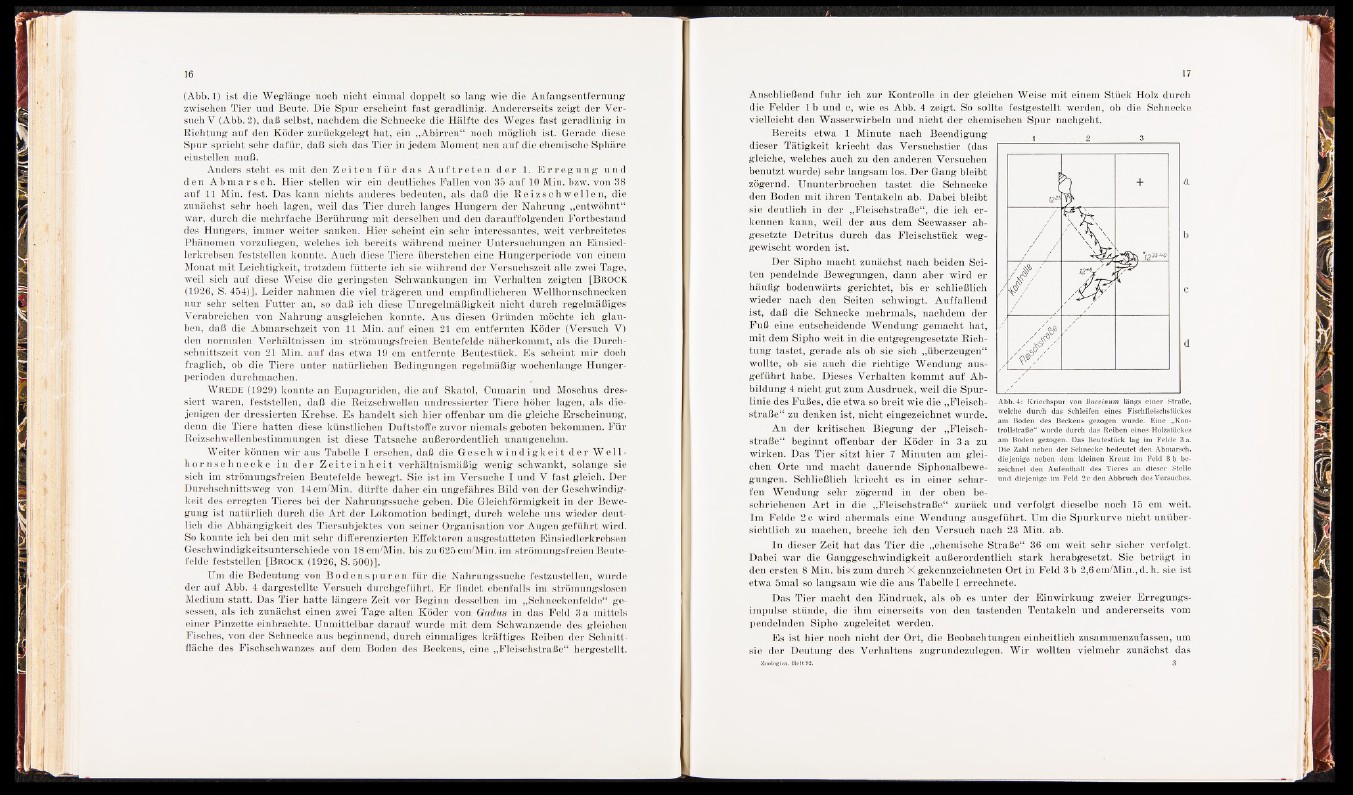
(Abb. 1) ist die Weglänge noch nicht einmal doppelt so lang wie die Anfangsentfernung
zwischen Tier und Beute. Die Spur erscheint fast geradlinig. Andererseits zeigt der Versuch
V (Abb. 2), daß selbst, nachdem die Schnecke die Hälfte des Weges fast geradlinig in
Richtung auf den Köder zurückgelegt hat, ein „Abirren“ noch möglich ist. Gerade diese
Spur spricht sehr dafür, daß sich das Tier in jedem Moment neu auf die chemische Sphäre
einstellen muß.
Anders steht es mit den Z e i t e n f ü r da s A u f t r e t e n d e r 1. E r r e g u n g u n d
de n Abma r s c h . Hier stellen wir ein deutliches Fallen von 35 auf 10 Min. bzw. von 38
auf 11 Min. fest. Das kann nichts anderes bedeuten, als daß die Re i z s chwe l l e n , die
zunächst sehr hoch lagen, weil das Tier durch langes Hungern der Nahrung „entwöhnt“
war, durch die mehrfache Berührung mit derselben und den darauffolgenden Fortbestand
des Hungers, immer weiter sanken. Hier scheint ein sehr interessantes, weit verbreitetes
Phänomen vorzuliegen, welches ich bereits während meiner Untersuchungen an Einsiedlerkrebsen
feststellen konnte. Auch diese Tiere überstehen eine Hungerperiode von einem
Monat mit Leichtigkeit, trotzdem fütterte ich sie während der Versuchszeit alle zwei Tage,
weil sich auf diese Weise die geringsten Schwankungen im Verhalten zeigten [Brock
(1926, S. 454)]. Leider nahmen die viel trägeren und empfindlicheren Wellhornschnecken
nur sehr selten Futter an, so daß ich diese Unregelmäßigkeit nicht durch regelmäßiges
Verabreichen von Nahrung ausgleichen konnte. Aus diesen Gründen möchte ich glauben,
daß die Abmarschzeit von 11 Min. auf einen 21 cm entfernten Köder (Versuch V)
den normalen Verhältnissen im strömungsfreien Beutefelde näherkommt, als die Durchschnittszeit
von 21 Min. auf das etwa 19 cm entfernte Beutestück. Es scheint mir doch
fraglich, ob die Tiere unter natürlichen Bedingungen regelmäßig wochenlange Hungerperioden
durchmachen.
Wrede (1929) konnte an Eupaguriden, die auf Skatol, Cumarin und Moschus dressiert
waren, feststellen, daß die Reizschwellen undressierter Tiere höher lagen, als diejenigen
der dressierten Krebse. Es handelt sich hier offenbar um die gleiche Erscheinung,
denn die Tiere hatten diese künstlichen Duftstoffe zuvor niemals geboten bekommen. Für
Reizschwellenbestimmungen ist diese Tatsache außerordentlich unangenehm.
Weiter können wir aus Tabelle I ersehen, daß die Ge s c hwi n d i g k e i t d e r We l l -
h o r n s c h n e c k e in d e r Z e i t e i n h e i t verhältnismäßig wenig schwankt, solange sie
sich im strömungsfreien Beutefelde bewegt. Sie ist im Versuche I und V fast gleich. Der
Durchschnittsweg von 14 cm/Min. dürfte daher ein ungefähres Bild von der Geschwindigkeit
des erregten Tieres bei der Nahrungssuche geben. Die Gleichförmigkeit in der Bewegung
ist natürlich durch die Art der Lokomotion bedingt, durch welche uns wieder deutlich
die Abhängigkeit des Tiersubjektes von seiner Organisation vor Augen geführt wird.
So konnte ich bei den mit sehr differenzierten Effektoren ausgestatteten Einsiedlerkrebsen
Geschwindigkeitsunterschiede von 18 cm/Min. bis zu 625 cm/Min. im strömungsfreien Beutefelde
feststellen [Brock (1926, S. 500)].
Um die Bedeutung von B o d e n s p u r e n für die Nahrungssuche festzustellen, wurde
der auf Abb. 4 dargestellte Versuch durchgeführt. E r findet ebenfalls im strömungslosen
Medium statt. Das Tier hatte längere Zeit vor Beginn desselben im „Schneckenfelde“ gesessen,
als ich zunächst einen zwei Tage alten Köder von Gadus in das Feld 3 a mittels
einer Pinzette einbrachte. Unmittelbar darauf wurde mit dem Schwanzende des gleichen
Fisches, von der Schnecke aus beginnend, durch einmaliges kräftiges Reiben der Schnittfläche
des Fischschwanzes auf dem Boden des Beckens, eine „Fleischstraße“ hergestellt.
Anschließend fuhr ich zur Kontrolle in der gleichen Weise mit einem Stück Holz durch
die Felder 1 b und c, wie es Abb. 4 zeigt. So sollte festgestellt werden, ob die Schnecke
vielleicht den Wasser wirbeln und nicht der chemischen Spur nachgeht.
i
ß2i
+
Ü \ \ iv \ \
\ K \
i m
m
y7
B B
H a
m m ■
W a k
/
b
Bereits etwa 1 Minute nach Beendigung 1 2 3
dieser Tätigkeit kriecht das Versuchstier (das
gleiche, welches auch zu den anderen Versuchen
benutzt wurde) sehr langsam los. Der Gang bleibt
zögernd. Ununterbrochen tastet die Schnecke
den Boden mit ihren Tentakeln ab. Dabei bleibt
sie deutlich in der „Fleischstraße“, die ich erkennen
kann, weil der aus dem Seewasser abgesetzte
Detritus durch das Fleischstück weggewischt
worden ist.
Der Sipho macht zunächst nach beiden Seiten
pendelnde Bewegungen, dann aber wird er
häufig bodenwärts gerichtet, bis er schließlich
wieder nach den Seiten schwingt. Auffallend
ist, daß die Schnecke mehrmals, nachdem der
Fuß eine entscheidende Wendung gemacht hat,
mit dem Sipho weit in die entgegengesetzte Richtung
tastet, gerade als ob sie sich „überzeugen“
wollte, ob sie auch die richtige Wendung ausgeführt
habe. Dieses Verhalten kommt auf Abbildung
4 nicht gut zum Ausdruck, weil die Spurlinie
des Fußes, die etwa so breit wie die „Fleischstraße“
zu denken ist, nicht eingezeichnet wurde.
An der kritischen Biegung der „Fleischstraße“
beginnt offenbar der Köder in 3 a zu
wirken. Das Tier sitzt hier 7 Minuten am gleichen
Orte und macht dauernde Siphonalbewe-
gungen. Schließlich kriecht es in einer scharfen
Wendung sehr zögernd in der oben beschriebenen
Abb. 4: Kriechspur von Buccinum längs einer Straße,
welche durch das Schleifen eines Fischfleischstückes
am Boden des Beckens gezogen wurde. Eine „Kon-
trollstraße“ wurde durch das Reiben eines Holzstückes
am Boden gezogen. Das Beutestück lag im Felde 3 a.
Die Zahl neben der Schnecke bedeutet den Abmarsch,
diejenige neben dem kleinen Kreuz im Feld 3 b bezeichnet
den Aufenthalt des Tieres an dieser Stelle
und diejenige im Feld 2c den Abbruch des Versuches.
Art in die „Fleischstraße“ zurück und verfolgt dieselbe noch 15 cm weit.
Im Felde 2 c wird abermals eine Wendung ausgeführt. Um die Spurkurve nicht unübersichtlich
zu machen, breche ich den Versuch nach 23 Min. ab.
In dieser Zeit hat das Tier die „chemische Straße“ 36 cm weit sehr sicher verfolgt.
Dabei war die Ganggeschwindigkeit außerordentlich stark herabgesetzt. Sie beträgt in
den ersten 8 Min. bis zum durch X gekennzeichneten Ort in Feld 3 b 2,6 cm/Min., d. h. sie ist
etwa 5mal so langsam wie die aus Tabelle I errechnete.
Das Tier macht den Eindruck, als ob es unter der Einwirkung zweier Erregungsimpulse
stünde, die ihm einerseits von den tastenden Tentakeln und andererseits vom
pendelnden Sipho zugeleitet werden.
Es ist hier noch nicht der Ort, die Beobachtungen einheitlich zusammenzufassen, um
sie der Deutung des Verhaltens zugrundezulegen. Wir wollten vielmehr zunächst das