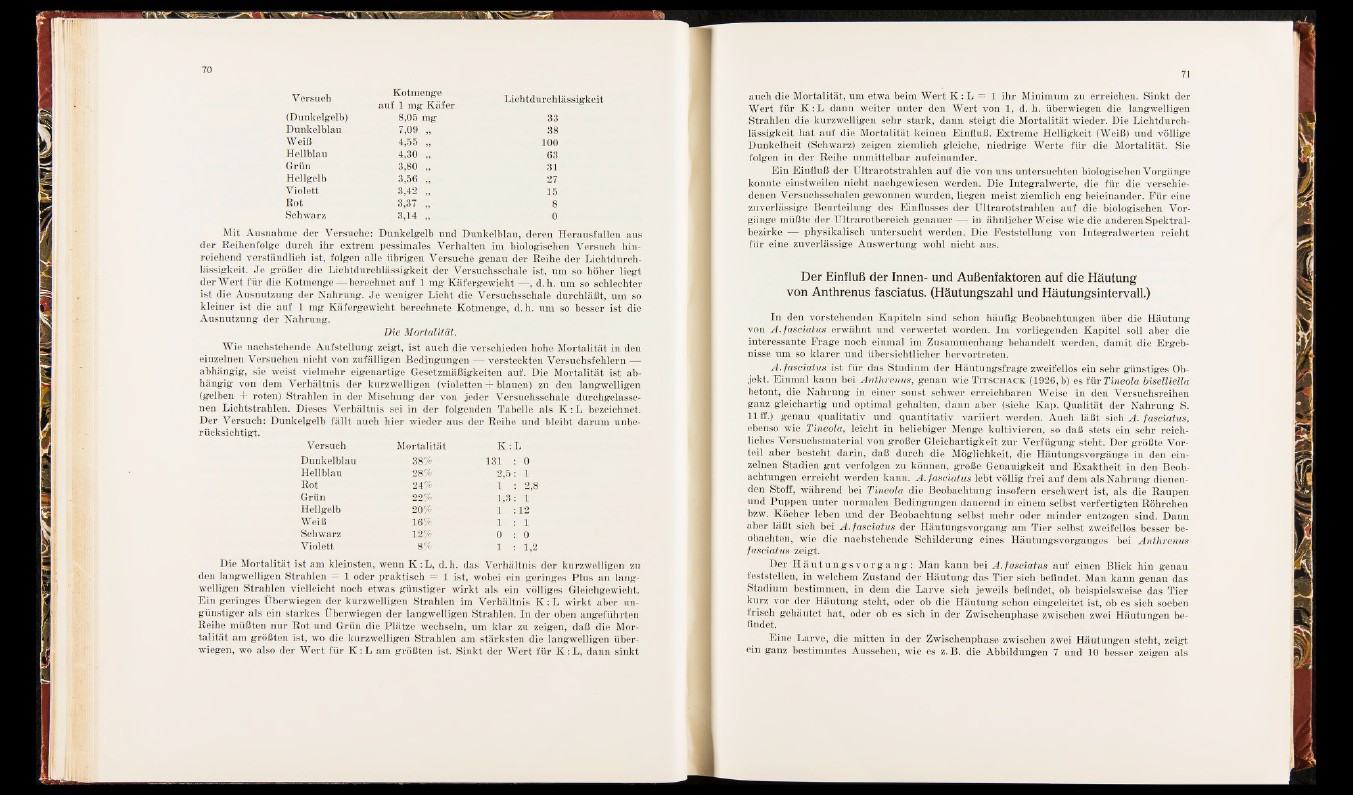
Versuch Kotmenge
auf 1 mg Käfer Lichtdurchl
(Dunkelgelb) 8,05 mg 33
Dunkelblau 7,09 „ 38
Weiß 4,55 „ 100
Hellblau 4,30 „ 63
Grün 3,80 „ 31
Hellgelb 3,56 „ 27
Violett 3,42 „ 15
Rot 3,37 „ 8
Schwarz 3,14 „ 0
Mit Ausnahme der Versuche: Dunkelgelb und Dunkelblau, deren Herausfallen aus
der Reihenfolge durch ihr extrem pessimales Verhalten im biologischen Versuch hinreichend
verständlich ist, folgen alle übrigen Versuche genau der Reihe der Lichtdurchlässigkeit.
J e größer die Lichtdurchlässigkeit der Versuchsschale ist, um so höher liegt
der Wert für die Kotmenge — berechnet auf 1 mg Käfergewicht —, d.h. um so schlechter
ist die Ausnutzung der Nahrung. Je weniger Licht die Versuchsschale durchläßt, um so
kleiner ist die auf 1 mg Käfergewicht berechnete Kotmenge, d.h. um so besser ist die
Ausnutzung der Nahrung.
Die Mortalität.
Wie nachstehende Aufstellung zeigt, ist auch die verschieden hohe Mortalität in den
einzelnen Versuchen nicht von zufälligen Bedingungen — versteckten Versuchsfehlern —
abhängig, sie weist vielmehr eigenartige Gesetzmäßigkeiten auf. Die Mortalität ist abhängig
von dem Verhältnis der kurzwelligen (violetten + blauen) zu den langwelligen
(gelben + roten) Strahlen in der Mischung der von jeder Versuchsschale durchgelassenen
Lichtstrahlen. Dieses Verhältnis sei in der folgenden Tabelle als K : L bezeichnet.
Der Versuch: Dunkelgelb fällt auch hier wieder aus der Reihe und bleibt darum unberücksichtigt.
.
Versuch Mortalität K: L
Dunkelblau 38% 131 : 0
Hellblau 28%' 2,5 : 1
Rot 24% 1 : 2,8
Grün 22%’ 1,3 : 1
Hellgelb 20% 1 : 12
Weiß 16% 1 : 1
Schwarz 12%' 0 : 0
Violett 8%' 1 :: 1,2
Die Mortalität ist am kleinsten, wenn K : L, d. h. das Verhältnis der kurzwelligen zu
den langwelligen Strahlen = 1 oder praktisch = 1 ist, wobei ein geringes Plus an langwelligen
Strahlen vielleicht noch etwas günstiger wirkt als ein völliges Gleichgewicht.
Ein geringes Überwiegen der kurzwelligen Strahlen im Verhältnis K : L wirkt aber ungünstiger
als ein starkes Überwiegen der langwelligen Strahlen. In der oben angeführten
Reihe müßten nur Rot und Grün die Plätze wechseln, um klar zu zeigen, daß die Mortalitä
t am größten ist, wo die kurzwelligen Strahlen am stärksten die langwelligen überwiegen,
wo also der Wert für K :L am größten ist. Sinkt der Wert für K :L, dann sinkt
auch die Mortalität, um etwa beim Wert K : L = 1 ihr Minimum zu erreichen. Sinkt der
Wert für K :L dann weiter unter den Wert von 1, d. h. überwiegen die langwelligen
Strahlen die kurzwelligen sehr stark, dann steigt die Mortalität wieder. Die Lichtdurchlässigkeit
hat auf die Mortalität keinen Einfluß. Extreme Helligkeit (Weiß) und völlige
Dunkelheit (Schwarz) zeigen ziemlich gleiche, niedrige Werte für die Mortalität. Sie
folgen in der Reihe unmittelbar aufeinander.
Ein Einfluß der Ultrarotstrahlen auf die von uns untersuchten biologischen Vorgänge
konnte einstweilen nicht nachgewiesen werden. Die Integralwerte, die für die verschiedenen
Versuchsschalen gewonnen wurden, liegen meist ziemlich eng beieinander. F ü r eine
zuverlässige Beurteilung des Einflusses der Ultrarotstrahlen auf die biologischen Vorgänge
müßte der Ultrarotbereich genauer -H in ähnlicherWeise wie die anderen Spektralbezirke
J§| physikalisch untersucht werden. Die Feststellung von Integralwerten reicht
für eine zuverlässige Auswertung wohl nicht aus.
Der Einfluß der Innen- und Außenfaktoren auf die Häutung
von Anthrenus fasciatus. (Häutungszahl und Häutungsintervall.)
In den vorstehenden Kapiteln sind schon häufig Beobachtungen über die Häutung
von A. fasciatus erwähnt und verwertet worden. Im vorliegenden Kapitel soll aber die
interessante Frage noch einmal im Zusammenhang behandelt werden, damit die Ergebnisse
um. so klarer und übersichtlicher hervortreten.
A . fasciatus ist für das Studium der Häutungsfrage zweifellos ein sehr günstiges Objekt.
Einmal kann bei Anthrenus, genau wie Titschack (1926,¡i) es für Tineola biselliella
betont, die Nahrung in einer sonst schwer erreichbaren Weise in den Versuchsreihen
ganz gleichartig und optimal gehalten, dann aber (siehe Kap. Qualität der Nahrung S.
11 ff.) genau qualitativ und quantitativ v ariiert werden. Auch läßt sieh A. fasciatus,
ebenso wie Tineola, leicht in beliebiger Menge kultivieren, so daß stets ein sehr reichliches
Versuchsmaterial von großer Gleichartigkeit zur Verfügung steht. Der größte Vorteil
aber besteht darin, daß durch die Möglichkeit, die Häutungsvorgänge in den einzelnen
Stadien gut verfolgen zu können, große Genauigkeit und Exaktheit in den Beobachtungen
erreicht werden kann. A. fasciatus lebt völlig frei auf dem als Nahrung dienenden
Stoff, während bei Tineola die Beobachtung insofern erschwert isjjnals die Baupen
und Puppen unter normalen Bedingungen dauernd in einem selbst verfertigten Höhrchen
bzw. Köcher leben und der Beobachtung selbst mehr oder minder entzogen sind. Dann
aber läßt sieh bei A. fasciatus der Häutungsvorgang am Tier selbst zweifellos besser beobachten,
wie die nachstehende Schilderung eines Häutungsvorganges bei Anthrenus
fasciatus zeigt.
Der H ä u t u n g s v o r g a n g : Man kann bei A.fasciatus auf einen Blick hin genau
feststellen, in welchem Zustand der Häutung das Tier sich befindet. Man kann genau das
Stadium bestimmen, in dem die Larve sich jeweils befindet, ob beispielsweise das Tier
kurz vor der Häutung steht, oder ob die Häutung schon eingeleitet ist, ob es sich soeben
frisch gehäutet hat, oder ob es sich in der Zwischenphase zwischen zwei Häutungen befindet.
Eine Larve, die mitten in der Zwischenpbase zwischen zwei Häutungen steht, zeigt
ein ganz bestimmtes Aussehen, wie es z. B. die Abbildungen 7 und 10 besser zeigen als