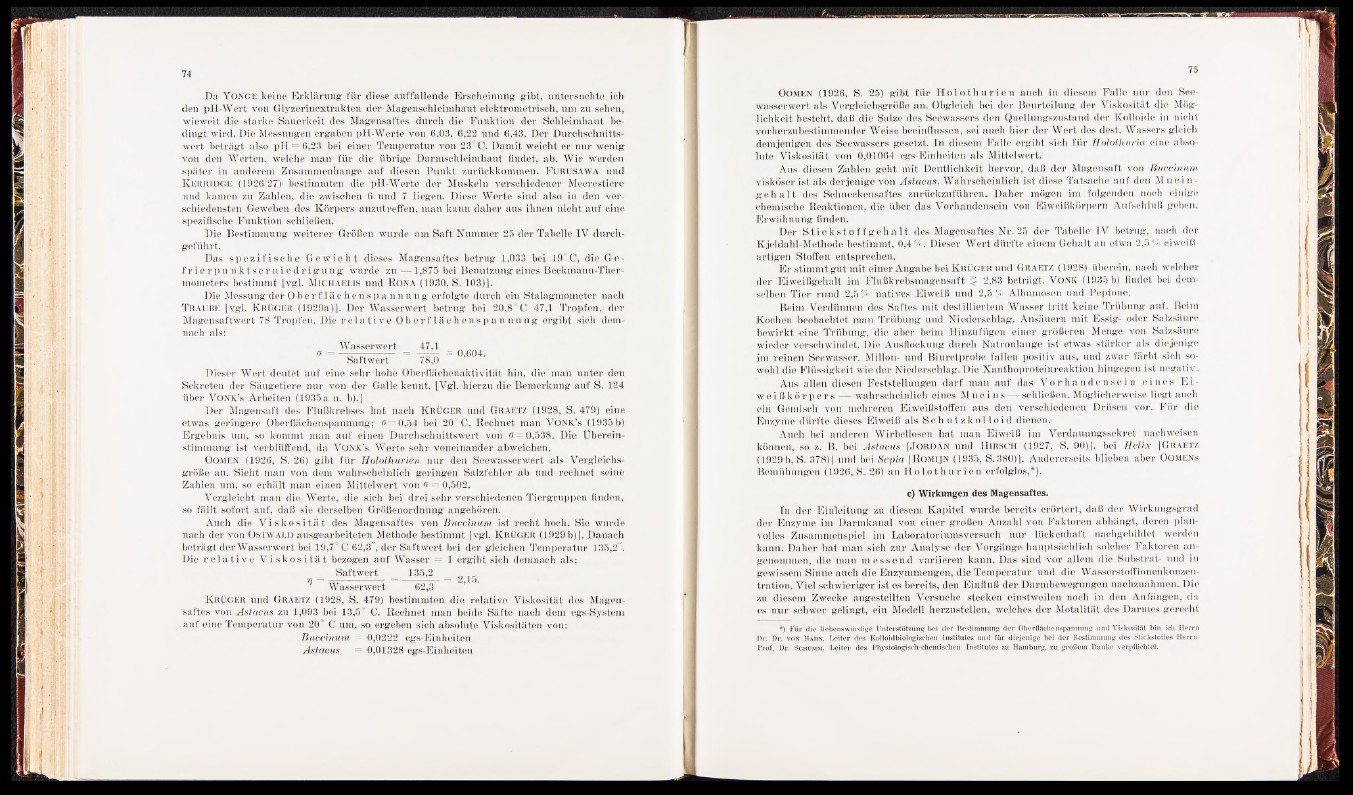
Da Yonge keine Erklärung für diese auffallende Erscheinung gibt, untersuchte ich
den pH-Wert von Glyzerinextrakten der Magenschleimhaut elektrometrisch, um zu sehen,
wieweit die starke Sauerkeit des Magensaftes durch die Funktion der Schleimhaut bedingt
wird. Die Messungen ergaben pH-Werte von 6,03, 6,22 und 6,43. Der Durchschnittswert
beträgt also pH = 6,23 bei einer Temperatur von 23° C. Damit weicht er nur wenig
von den Werten, welche man für die übrige Darmschleimhaut findet, ab. Wir werden
später in anderem Zusammenhänge auf diesen Punkt zurückkommen. FURUSAWA und
K erridge (1926/27) bestimmten die pH-Werte der Muskeln verschiedener Meerestiere
und kamen zu Zahlen, die zwischen 6 und 7 liegen. Diese Werte sind also in den verschiedensten
Geweben des Körpers anzutreffen, man kann daher aus ihnen nicht auf eine
spezifische Funktion schließen.
Die Bestimmung weiterer Größen wurde am Saft Nummer 25 der Tabelle IV durchgeführt.
Das s p e z i f i s c h e Ge w i c h t dieses Magensaftes betrug 1,033 bei 1 9 °C, die G e f
r i e r p u n k t s e r n i e d r i g u n g wurde zu — 1,875 bei Benutzung eines Beckmann-Thermometers
bestimmt [vgl. Michaelis und Bona (1930, S. 103)].
Die Messung der O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g erfolgte durch ein Stalagmometer nach
Traube [vgl. K rüger (1929a)]. Der Wasserwert betrug bei 20,8° C 47,1 Tropfen, der
Magensaftwert 78 Tropfen. Die r e l a t i v e O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g ergibt sich demnach
als:
o = —W—a—ss-e-r-w--—ert = B4j7j,g1 I 0,604.
Saftwert 78,0
Dieser Wert deutet auf eine sehr hohe Oberflächenaktivität hin, die man unter den
Sekreten der Säugetiere nur von der Galle kennt. [Vgl. hierzu die Bemerkung auf S. 124
über Vonk’s Arbeiten (1935 a u. b).]
Der Magensaft des Flußkrebses hat nach K rüger und Graetz (1928, S. 479) eine
etwas geringere Oberflächenspannung; tf=0,54 bei 20° C. Rechnet man Vonk’s (1935 b)
Ergebnis um, so kommt man auf einen Durchschnittswert von o = 0,538. Die Übereinstimmung
ist verblüffend, da Vonk’s Werte sehr voneinander abweichen.
Oomen (1926, S. 26) gibt für Holothurien nur den Seewasserwert als Vergleichs-
grö ße an. Sieht man von dem wahrscheinlich geringen Salzfehler ab und rechnet seine
Zahlen um, so erhält man einen Mittelwert von o = 0,502.
Vergleicht man die Werte, die sich bei drei sehr verschiedenen Tiergruppen finden,
so fällt sofort auf, daß sie derselben Größenordnung angehören.
Auch die V i s k o s i t ä t des Magensaftes von Buccinum ist recht hoch. Sie wurde
nach der von Ostwald ausgearbeiteten Methode bestimmt [vgl. K rüger (1929 b)]. Danach
beträgt der Wasserwert bei 19,7° C 62,3”, der Saftwert bei der gleichen Temperatur 135,2”.
Die r e l a t i v e V i s k o s i t ä t bezogen auf Wasser = 1 ergibt sich demnach als:
v = .--S--a--f-t wert • = ---1--3-5-—,2 = H2,1| |5.
Wasserwert 62,3
K rüger und Graetz (1928, S. 479) bestimmten die relative Viskosität des Magensaftes
von Astacus zu 1,093 bei 13,5° C. Rechnet man beide Säfte nach dem cgs-System
auf eine Temperatur von 20° C um, so ergeben sich absolute Viskositäten von:
Buccinum = 0,0222 cgs-Einheiten
Astacus ijj| 0,01328 cgs-Einheiten
Oomen (1926, S. 25) gibt für H o l o t h u r i e n auch in diesem Falle nur den Seewasserwert
als Vergleichsgröße an. Obgleich bei der Beurteilung der Viskosität die Möglichkeit
besteht, daß die Salze des Seewassers den Quellungszustand der Kolloide in nicht
vorherzubestimmender Weise beeinflussen, sei auch hier der Wert des dest. Wassers gleich
demjenigen des Seewassers gesetzt. In diesem Falle ergibt sich für Holothuria eine absolute
Viskosität von 0,01064 cgs-Einheiten als Mittelwert.
Aus diesen Zahlen geht mit Deutlichkeit hervor, daß der Magensaft von Buccinum
viskoser ist als derjenige von Astacus. Wahrscheinlich ist diese Tatsache auf den Mu c i n -
g e h a 11 des Schneckensaftes zurückzuführen. Daher mögen im folgenden noch einige
chemische Reaktionen, die über das Vorhandensein von Eiweißkörpern Aufschluß geben.
Erwähnung finden.
Der S t i c k s t o f f g e h a l t des Magensaftes Nr. 25 der Tabelle IV betrug, nach der
Kjeldahl-Methode bestimmt, 0,4 %. Dieser Wert dürfte einem Gehalt an etwa 2,5 % eiweißartigen
Stoffen entsprechen.
E r stimmt gut m it einer Angabe bei K rüger und Graetz (1928) überein, nach welcher
der Eiweißgehalt im Flußkrebsmagensaft < 2,83 beträgt. Vonk (1935 b) findet bei demselben
Tier rund 2,5 % natives Eiweiß und 2,5 % Albumosen und Peptone.
Beim Verdünnen des Saftes mit destilliertem Wasser tritt keine Trübung auf. Beim
Kochen beobachtet man Trübung und Niederschlag. Ansäuern mit Essig- oder Salzsäure
bewirkt eine Trübung, die aber beim Hinzufügen einer größeren Menge von Salzsäure
wieder verschwindet. Die Ausflockung durch Natronlauge ist etwas stärker als diejenige
im reinen Seewasser. Millon- und Biuretprobe fallen positiv aus, und zwar färbt sich sowohl
die Flüssigkeit wie der Niederschlag. Die Xanthoproteinreaktion hingegen ist negativ.
Aus allen diesen Feststellungen darf man auf das V o r h a n d e n s e i n e in e s E i w
e i ß k ö r p e r s — wahrscheinlich eines M u c i n s — schließen. Möglicherweise liegt auch
ein Gemisch von mehreren Eiweißstoffen aus den verschiedenen Drüsen vor. Fü r die
Enzyme dürfte dieses Eiweiß als S c h u t z k o l l o i d dienen.
Auch bei anderen Wirbellosen ha t man Eiweiß im Verdauungssekret nach weisen
können, so z. B. bei Astacus [ J ordan und Hirsch (1927, S. 90)], bei Helix [Graetz
(1929 b, S. 378)] und bei Sepia [Romijn (1935, S. 380)]. Andererseits blieben aber Oomens
Bemühungen (1926, S. 26) an H o l o t h u r i e n erfolglos,*).
c) Wirkungen des Magensaftes.
In der Einleitung zu diesem Kapitel wurde bereits erörtert, daß der Wirkungsgrad
der Enzyme im Darmkanal von einer großen Anzahl von Faktoren abhängt, deren planvolles
Zusammenspiel im Laboratoriumsversuch nur lückenhaft nachgebildet werden
kann. Daher hat man sich zur Analyse der Vorgänge hauptsächlich solcher Faktoren angenommen,
die man m e s s e n d variieren kann. Das sind vor allem die Substrat- und in
gewissem Sinne auch die Enzymmengen, die Temperatur und die Wasserstoffionenkonzen-
tration. Viel schwieriger ist es bereits, den Einfluß der Darmbewegungen nachzuahmen. Die
zu diesem Zwecke angestellten Versuche stecken einstweilen noch in den Anfängen, da
es nur schwer gelingt, ein Modell herzustellen, welches der Motalität des Darmes gerecht
*) Für die liebenswürdige Unterstützung bei der Bestimmung der Oberflächenspannung und Viskosität bin ich Herrn
Dr. Dr. von H aiin, Leiter des Kolloidbiologischen Institutes und für diejenige bei der Bestimmung des Stickstoffes Herrn
Prof. Dr. Sciiumm, Leiter des Physiologisch-chemischen Institutes zu Hamburg, zu großem Danke verpflichtet.