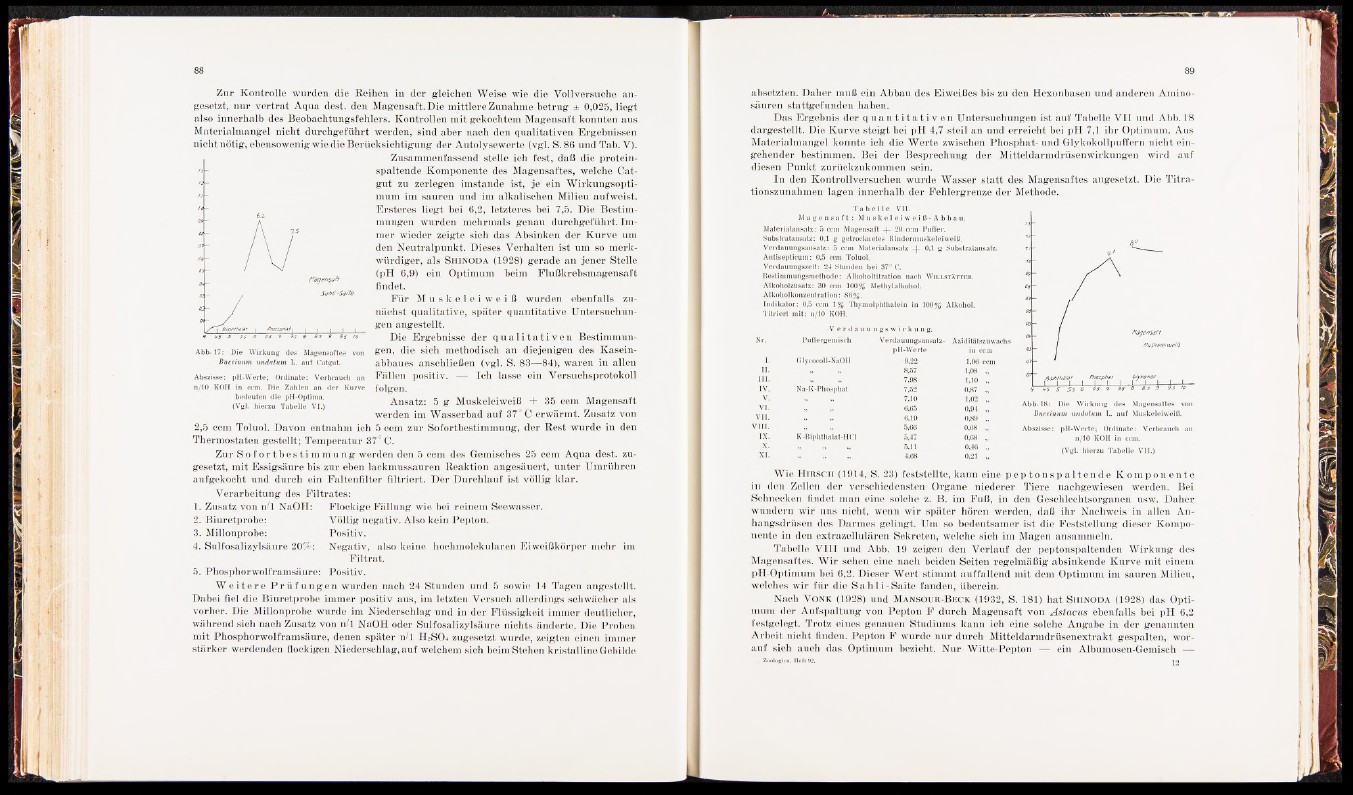
Zur Kontrolle wurden die Reihen in der gleichen Weise wie die Vollversuche angesetzt,
nur vertra t Aqua dest. den Magensaft. Die mittlere Zunahme betrug ± 0,025, liegt
also innerhalb des Beobachtungsfehlers. Kontrollen mit gekochtem Magensaft konnten aus
Materialmangel nicht durchgeführt werden, sind aber nach den qualitativen Ergebnissen
nicht nötig, ebensowenig wie die Berücksichtigung der Autolysewerte (vgl. S. 86 und Tab. V).
Zusammenfassend stelle ich fest, daß die proteinspaltende
Komponente des Magensaftes, welche Catgut
zu zerlegen imstande ist, je ein Wirkungsoptimum
im sauren und im alkalischen Milieu aufweist.
Ersteres liegt bei 6,2, letzteres bei 7,5. Die Bestimmungen
wurden mehrmals genau durchgeführt. Immer
wieder zeigte sich das Absinken der Kurve um
den Neutralpunkt. Dieses Verhalten ist um so merkwürdiger,
als Shinoda (1928) gerade an jener Stelle
(pH 6,9) ein Optimum beim Flußkrebsmagensaft
findet.
F ü r M u s k e l e i w e i ß wurden ebenfalls zunächst
qualitative, später quantitative Untersuchungen
angestellt.
Die Ergebnisse der q u a l i t a t i v e n Bestimmungen,
die sich methodisch an diejenigen des Kaseinabbaues
anschließen (vgl. S. 83—84), waren in allen
Fällen positiv. — Ich lasse ein Versuchsprotokoll
folgen.
Ansatz: 5 g Muskeleiweiß + 35 ccm Magensaft
werden im Wasserbad auf 37° C erwärmt. Zusatz von
Abb. 17: Die Wirkung des Magensaftes von
Buccinum undatum L. auf Catgut.
Abszisse: pH-Werte; Ordinate: Verbrauch an
n/10 KOH in ccm. Die Zahlen an der Kurve
bedeuten die pH-Optima.
(Vgl. hierzu Tabelle VI.)
2,5 ccm Toluol. Davon entnahm ich 5 ccm zur Sofortbestimmung, der Rest wurde in den
Thermostaten gestellt; Temperatur 37° C.
Zur S o f o r t b e s t im m u n g werden den 5 ccm des Gemisches 25 ccm Aqua dest. zugesetzt,
mit Essigsäure bis zur eben lackmussauren Reaktion angesäuert, unter Umrühren
aufgekocht und durch ein Faltenfilter filtriert. Der Durchlauf ist völlig klar.
Verarbeitung des Filtrates:
1 . Zusatz von n /l NaOH: Flockige Fällung wie bei reinem Seewasser.
Völlig negativ. Also kein Pepton.
Positiv.
Negativ, also keine hochmolekularen Eiweißkörper mehr im
Filtrat.
2. Biuretprobe:
3. Milionprobe:
4. Sulfosalizylsäure 20%:
5. Phosphorwolframsäure: Positiv.
We i t e r e P r ü f u n g e n wurden nach 24 Stunden und 5 sowie 14 Tagen angestellt.
Dabei fiel die Biuretprobe immer positiv aus, im letzten Versuch allerdings schwächer als
vorher. Die Milionprobe wurde im Niederschlag und in der Flüssigkeit immer deutlicher,
während sich nach Zusatz von n/l NaOH oder Sulfosalizylsäure nichts änderte. Die Proben
mit Phosphorwolframsäure, denen später n/l H2SO4 zugesetzt wurde, zeigten einen immer
stärker werdenden flockigen Niederschlag, auf welchem sich beim Stehen kristalline Gebilde
absetzten. Daher muß ein Abbau des Eiweißes bis zu den Hexonbasen und anderen Aminosäuren
stattgefunden haben.
Das Ergebn is der q u a n t i t a t i v e n Untersuchungen ist auf Tabelle VII und Abb. 18
dargestellt. Die Kurve steigt bei pH 4,7 steil an und erreicht bei pH 7,1 ihr Optimum. Aus
Materialmangel konnte ich die Werte zwischen Phosphat- und Glykokollpuffern nicht eingehender
bestimmen. Bei der Besprechung der Mitteldarmdrüsenwirkungen wird auf
diesen Punkt zurückzukommen sein.
In den Kontrollversuchen wurde Wasser statt des Magensaftes angesetzt. Die Titrationszunahmen
lagen innerhalb der Fehlergrenze der Methode.
T a b e l l e VII.
M a g e n s a f t : M u s k e l e i w e i ß - A b b a u .
Materialansatz: 5 ccm Magensaft -f- 20 ccm Puffer.
Substratansatz: 0,1 g getrocknetes Rindermuskeleiweiß.
Verdauungsansatz: 5 ccm Materialansatz -|- 0,1 g Substratansatz.
Antisepticum: 0,5 ccm Toluol.
Verdauungszeit: 24 Stunden bei 37° C.
Bestimmungsmethode: Alkoholtitration nach Wil l stä t t e r.
Alkoholzusatz: 30 ccm 100% Methylalkohol.
Alkoholkonzentration: 86 %.
Indikator: 0,5 ccm 1% Thymolphthalein in 100% Alkohol.
Titriert mit: n/10 KOH.
V e r d a u u n g s w i r k u n g.
Nr. Puffergemisch VerdauungsansatzAziditätszuwi
pH-Werte in ccm
I. Glycocoll-NaOH 9,22 1,06 ccm
II. ,, >, 8,57 1,08 „
III. >, ,, 7,98 1,10 „
IV. Na-K-Phosphat 7,52 0,87 „
V. » » 7,10 1,02 „
VI. 6,65 0,94 „
VII. ,, ,, 6,19 0,89 „
VIII. » >, 5,66 0,68 „
IX. K-Biphthalat-HCl 5,47 0,68 „
X. » » ,» 5,11 0,46 „
XI. „ 4,68 0,21 „
Abb. 18: Die Wirkung des Magensaftes von
Buccinum undatum L. auf Muskeleiweiß.
pH-Werte; Ordinate: V>
n/10 KOH in ccm.
(Vgl. hierzu Tabelle VII.)
Wie Hirsch (1914, S. 23) feststellte, kann eine p e p t o n s p a l t e n d e K omp o n e n t e
in den Zellen der verschiedensten Organe niederer Tiere nachgewiesen werden. Bei
Schnecken findet man eine solche z. B. im Fuß, in den Geschlechtsorganen usw. Daher
wundern wir uns nicht, wenn wir später hören werden, daß ihr Nachweis in allen Anhangsdrüsen
des Darmes gelingt. Um so bedeutsamer ist die Feststellung dieser Komponente
in den extrazellulären Sekreten, welche sich im Magen ansammeln.
Tabelle VIII und Abb. 19 zeigen den Verlauf der peptonspaltenden Wirkung des
Magensaftes. Wir sehen eine nach beiden Seiten regelmäßig absinkende Kurve mit einem
pH-Optimum bei 6,2. Dieser Wert stimmt auffallend mit dem Optimum im sauren Milieu,
welches wir für die Sahl i -Sai t e fanden, überein.
Nach Vonk (1928) und Mansour-Beck (1932, S. 181) ha t Shinoda (1928) das Optimum
der Aufspaltung von Pepton F durch Magensaft von Astacus ebenfalls bei pH 6,2
festgelegt. Trotz eines genauen Studiums kann ich eine solche Angabe in der genannten
Arbeit nicht finden. Pepton F wurde nur durch Mitteldarmdrüsenextrakt gespalten, worauf
sich auch das Optimum bezieht. Nur Witte-Pepton — ein Albumosen-Gemisch —