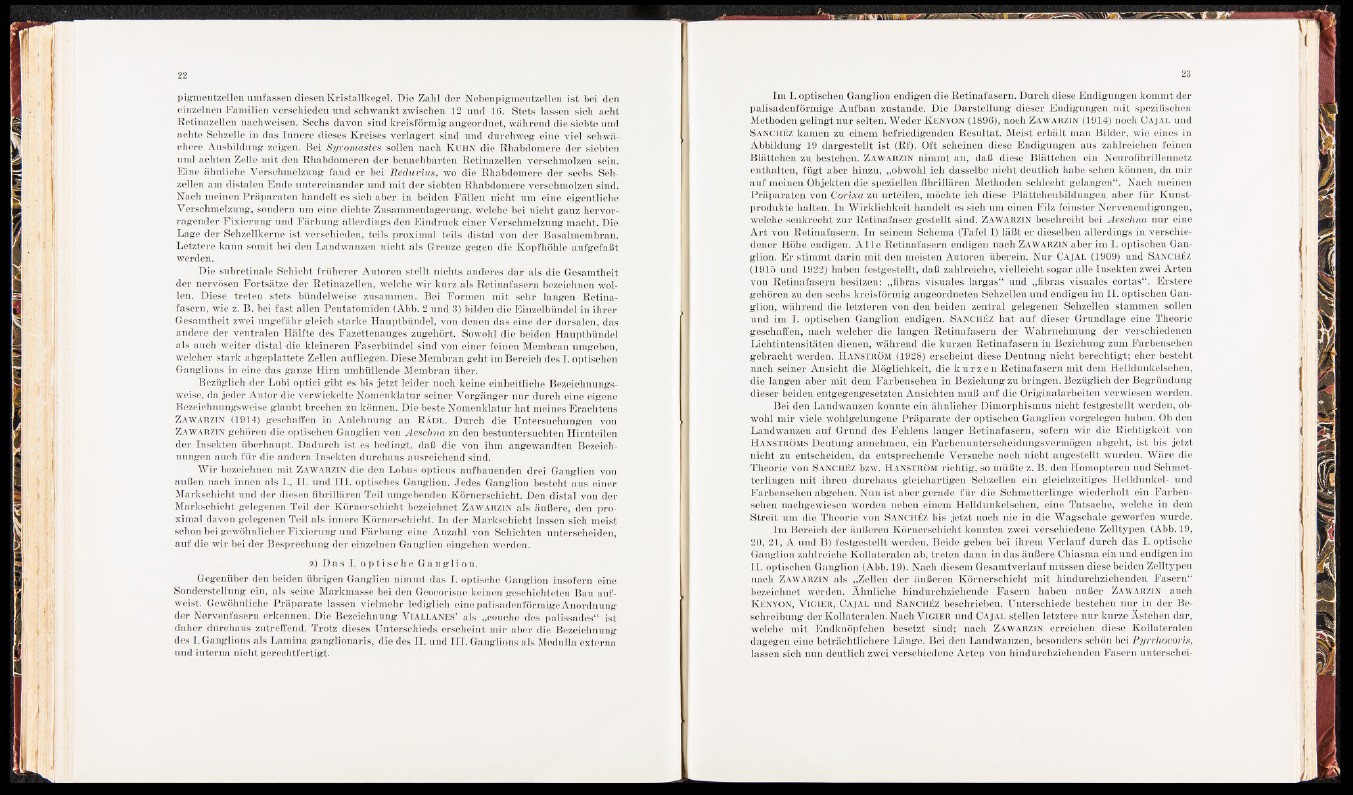
pigmentzellen umfassen diesen Kristallkegel. Die Zahl der Nebenpigmentzellen ist bei den
einzelnen Familien verschieden und schwankt zwischen 12 und 16. Stets lassen sich acht
Retinazellen nachweisen. Sechs davon sind kreisförmig angeordnet, während die siebte und
achte Sehzelle in das Innere dieses Kreises verlagert sind und durchweg eine viel schwächere
Ausbildung zeigen. Bei Syromastes sollen nach K u h n die Rhabdomere der siebten
und achten Zelle mit den Rhabdomeren der benachbarten Retinazellen verschmolzen sein.
Eine ähnliche Verschmelzung fand er bei Reduvius, wo die Rhabdomere der sechs Sehzellen
am distalen Ende untereinander und mit der siebten Rhabdomere verschmolzen sind.
Nach meinen Präparaten handelt es sich aber in beiden Fällen nicht um eine eigentliche
Verschmelzung, sondern um eine dichte Zusammenlagerung, welche hei nicht ganz hervorragender
Fixierung und Färbung allerdings den Eindruck einer Verschmelzung macht. Die
Lage der Sehzellkerne ist verschieden, teils proximal teils distal von der Basalmembran.
Letztere kann somit bei den Landwanzen nicht als Grenze gegen die Kopfhöhle aufgefaßt
werden.
Die subretinale Schicht früherer Autoren stellt nichts anderes dar als die Gesamtheit
der nervösen Fortsätze der Retinazellen, welche wir kurz als Retinafasern bezeichnen wollen.
Diese treten stets bündelweise zusammen. Bei Formen mit sehr langen Retinafasern,
wie z. B. bei fast allen Pentatomiden (Abb. 2 und 3) bilden die Einzelbündel in ihrer
Gesamtheit zwei ungefähr gleich starke Hauptbündel, von denen das eine der dorsalen, das
andere der ventralen Hälfte des Fazettenauges zugehört. Sowohl die beiden Hauptbündel
als auch weiter distal die kleineren Faserbündel sind von einer feinen Membran umgeben,
welcher stark abgeplattete Zellen aufliegen. Diese Membran geht im Bereich des I. optischen
Ganglions in eine das ganze Hirn umhüllende Membran über.
Bezüglich der Lobi optici gibt es bis jetzt leider noch keine einheitliche Bezeichnungsweise,
da jeder A utor die verwickelte Nomenklatur seiner Vorgänger nur durch eine eigene
Bezeichnungsweise glaubt brechen zu können. Die beste Nomenklatur h at meines Erachtens
Z a w a r z in (1914) geschaffen in Anlehnung an R ä d l. Durch die Untersuchungen von
Z a w a r z in gehören die optischen Ganglien von Aeschna zu den bestuntersuchten Hirnteilen
der Insekten überhaupt. Dadurch ist es bedingt, daß die von ihm angewandten Bezeichnungen
auch für die ändern Insekten durchaus ausreichend sind.
Wir bezeichnen mit Z a w a r z in die den Lobus opticus auf bauenden drei Ganglien von
außen nach innen als I.J II. und III. optisches Ganglion. Jedes Ganglion besteht aus einer
Markschicht und der diesen fibrillären Teil umgebenden Körnerschicht. Den distal von der
Markschicht gelegenen Teil der Körnerschicht bezeichnet Z a w a r z in als äußere, den proximal
davon gelegenen Teil als innere Körnerschicht. In der Markschicht lassen sich meist
schon bei gewöhnlicher Fixierung und Färbung eine Anzahl von Schichten unterscheiden,
auf die wir bei der Besprechung der einzelnen Ganglien eingehen werden.
a) D a s I. o p t i s c h e Ga ngl i on.
Gegenüber den beiden übrigen Ganglien nimmt das I. optische Ganglion insofern eine
Sonderstellung ein, als seine Markmasse bei den Geocorisae keinen geschichteten Bau aufweist.
Gewöhnliche Präparate lassen vielmehr lediglich eine palisadenförmige Anordnung
der Nervenfasern erkennen. Die Bezeichnung V ia l l a n e s ’ als „couche des palissades“ ist
daher durchaus zutreffend. Trotz dieses Unterschieds erscheint mir aber die Bezeichnung
des I. Ganglions als Lamina ganglionaris, die des II. und III. Ganglions als Medulla externa
und interna nicht gerechtfertigt.
Im I. optischen Ganglion endigen die Retinafasern. Durch diese Endigungen kommt der
palisadenförmige Aufbau zustande. Die Darstellung dieser Endigungen mit spezifischen
Methoden gelingt nur selten. Weder K e n y o n (1896), noch Z a w a r z in (1914) noch C a j a l und
S a n c h e z kamen zu einem befriedigenden Resultat. Meist erhält man Bilder, wie eines in
Abbildung 19 dargestellt ist (Rf). Oft scheinen diese Endigungen aus zahlreichen feinen
Blättchen zu bestehen. Z a w a r z in nimmt an, daß diese Blättchen ein Neurofibrillennetz
enthalten, fügt aber hinzu, „obwohl ich dasselbe nicht deutlich habe sehen können, da mir
auf meinen Objekten die speziellen fibrillären Methoden schlecht gelangen“. Nach meinen
Präparaten von Corixa zu urteilen, möchte ich diese Plättchenbildungen aber für Kunstprodukte
halten. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Filz feinster Nervenendigungen,
welche senkrecht zur Retinafaser gestellt sind. Z a w a r z in beschreibt bei Aeschna nur eine
Art von Retinafasern. In seinem Schema (Tafel I) läßt er dieselben allerdings in verschiedener
Höhe endigen. Al l e Retinafasern endigen nach Z a w a r z in aber im I. optischen Ganglion.
E r stimmt darin mit den meisten Autoren überein. Nur C a j a l (1909) und S a n c h e z
(1915 und 1922) haben festgestellt, daß zahlreiche, vielleicht sogar alle Insekten zwei A rten
von Retinafasern besitzen: „fibras visuales largas“ und „fibras visuales cortas“. Erstere
gehören zu den sechs kreisförmig angeordneten Sehzellen und endigen im II. optischen Ganglion,
während die letzteren von den beiden zentral gelegenen Sehzellen stammen sollen
und im I. optischen Ganglion endigen. S a n c h e z hat auf dieser Grundlage eine Theorie
geschaffen, nach welcher die langen Retinafasern der Wahrnehmung der verschiedenen
Lichtintensitäten dienen, während die kurzen Retinafasern in Beziehung zum Farbensehen
gebracht werden. H a n s t r ö m (1928) erscheint diese Deutung nicht berechtigt; eher besteht
nach seiner Ansicht die Möglichkeit, die k u r z e n Retinafasern mit dem Helldunkelsehen,
die langen aber mit dem Farbensehen in Beziehung zu bringen. Bezüglich der Begründung
dieser beiden entgegengesetzten Ansichten muß auf die Originalarbeiten verwiesen werden.
Bei den Landwanzen konnte ein ähnlicher Dimorphismus nicht festgestellt werden, obwohl
mir viele wohlgelungene Präparate der optischen Ganglien Vorgelegen haben. Ob den
Landwanzen auf Grund des Fehlens langer Retinafasern, sofern wir die Richtigkeit von
H a n s t r ö m s Deutung annehmen, ein Farbenunterscheidungsvermögen abgeht, ist bis jetzt
nicht zu entscheiden, da entsprechende Versuche noch nicht angestellt wurden. Wäre die
Theorie von S a n c h e z bzw. H a n s t r ö m richtig, so müßte z. B. den Homopteren und Schmetterlingen
mit ihren durchaus gleichartigen Sehzellen ein gleichzeitiges Helldunkel- und
Farbensehen abgehen. Nun ist aber gerade für die Schmetterlinge wiederholt ein Farbensehen
nachgewiesen worden neben einem Helldunkelsehen, eine Tatsache, welche in dem
Streit um die Theorie von S a n c h e z bis jetzt noch nie in die Wagschale geworfen wurde.
Im Bereich der äußeren Körnerschicht konnten zwei verschiedene Zelltypen (Abb. 19,
20, 21, A und B) festgestellt werden. Beide geben bei ihrem Verlauf durch das I. optische
Ganglion zahlreiche Kollateralen ab, treten dann in das äußere Chiasma ein und endigen im
II. optischen Ganglion (Abb. 19). Nach diesem Gesamtverlauf müssen diese beiden Zelltypen
nach Z a w a r z in als „Zellen der äußeren Körnerschieht mit hindurchziehenden Fasern“
bezeichnet werden. Ähnliche hindurchziehende Fasern haben außer Z a w a r z in auch-
K e n y o n , V ig i e r , C a j a l und S a n c h e z beschrieben. Unterschiede bestehen nur in der Beschreibung
der Kollateralen. Nach V ig i e r und C a j a l stellen letztere nur kurze Ästchen dar,
welche mit Endknöpfchen besetzt sind; nach Z a w a r z in erreichen diese Kollateralen
dagegen eine beträchtlichere Länge. Bei den Landwanzen, besonders schön bei Pyrrhocoris,
lassen sich nun deutlich zwei verschiedene A rten von hindurchziehenden Fasern unterschei