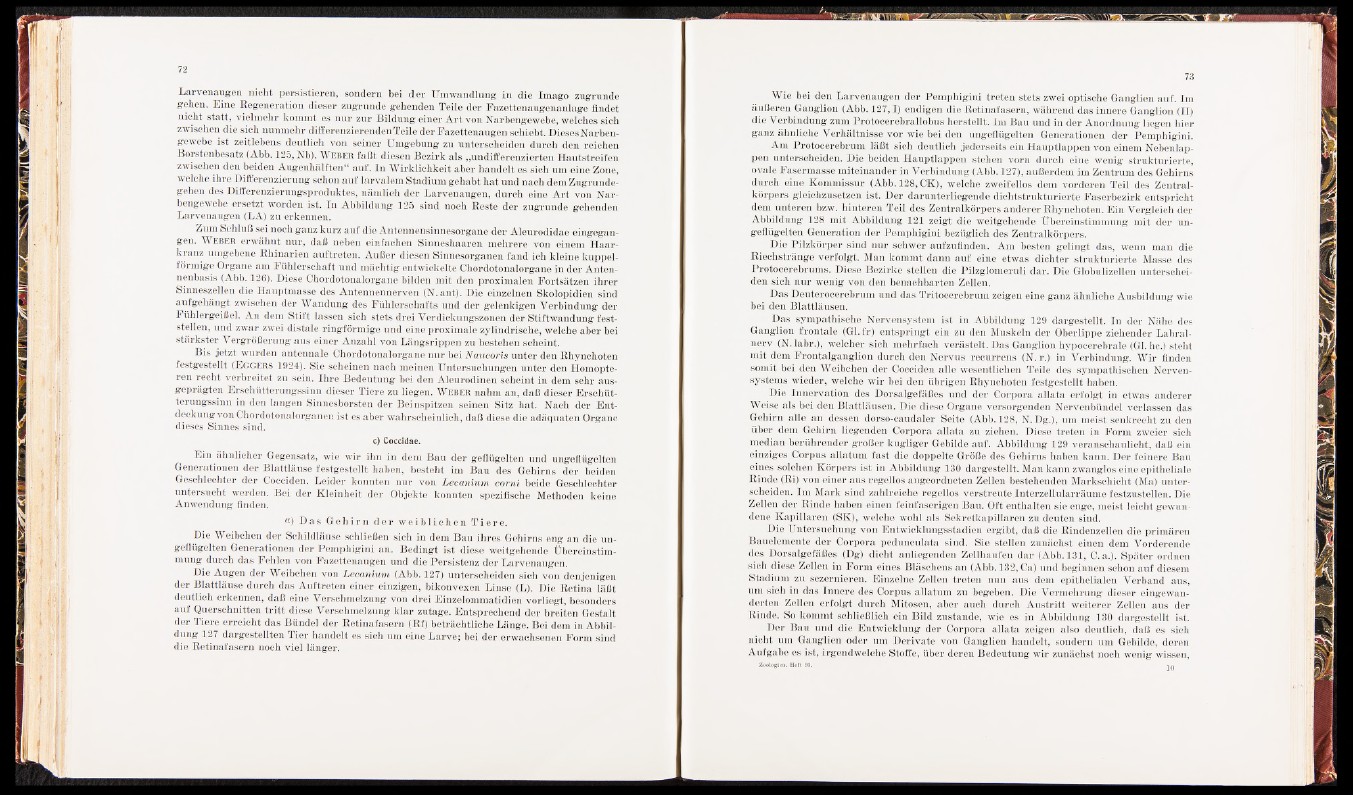
Larvenaugen nicht persistieren, sondern bei der Umwandlung in die Imago zugrunde
gehen. Eine Regeneration dieser zugrunde gehenden Teile der Fazettenaugenanlage findet
nicht statt, vielmehr kommt es nur zur Bildung einer Art von Narbengewebe, welches sich
zwischen die sich nunmehr differenzierenden Teile der Fazettenaugen schiebt. Dieses Narbengewebe
ist zeitlebens deutlich von seiner Umgebung zu unterscheiden durch den reichen
Borstenbesatz (Abb. 125, Nb). Weber faßt diesen Bezirk als „undifferenzierten Hautstreifen
zwischen den beiden Augenhälften“ auf. In Wirklichkeit aber handelt es sich um eine Zone,
welche ihre Differenzierung schon auf larvalem Stadium gehabt hat und nach dem Zugrundegehen
des Differenzierungsproduktes, nämlich der Larvenaugen, durch eine Art von Narbengewebe
ersetzt worden ist. In Abbildung 125 sind noch Reste der zugrunde gehenden
Larvenaugen (LA) zu erkennen.
Zum Schluß sei noch ganz kurz auf die Antennensinnesorgane der Aleurodidae eingegangen.
Weber erwähnt nur, daß neben einfachen Sinneshaaren mehrere von einem Haarkranz
umgebene Rhinarien auftreten. Außer diesen Sinnesorganen fand ich kleine kuppelförmige
Organe am Fühlerschaft und mächtig entwickelte Chordotonalorgane in der Antennenbasis
(Abb. 126). Diese Chordotonalorgane bilden mit den proximalen Fortsätzen ihrer
Sinneszellen die Hauptmasse des Antennennerven (N.ant). Die einzelnen Skolopidien sind
auf gehängt zwischen der Wandung des Fühlerschafts und der gelenkigen Verbindung der
Fühlergeißel. An dem Stift lassen sich stets drei Verdickungszonen der Stiftwandung feststellen,
und zwar zwei distale ringförmige und eine proximale zylindrische, welche aber bei
stärkster Vergrößerung aus einer Anzahl von Längsrippen zu bestehen scheint.
Bis jetzt wurden antennale Chordotonalorgane nur bei Naucoris unter den Rhynchoten
festgestellt (Eggers 1924). Sie scheinen nach meinen Untersuchungen unter den Homopte-
ren recht verbreitet zu sein. Ihre Bedeutung bei den Aleurodinen scheint in dem sehr ausgeprägten
Erschütterungssinn dieser Tiere zu liegen. Weber nahm an, daß dieser Erschütterungssinn
in den langen Sinnesborsten der Beinspitzen seinen Sitz hat. Nach der Entdeckung
von Chordotonalorganen ist es aber wahrscheinlich, daß diese die adäquaten Organe
dieses Sinnes sind.
c) Coccidae.
Ein ähnlicher Gegensatz, wie wir ihn in dem Bau der geflügelten und ungeflügelten
Generationen der Blattläuse festgestellt hahen, besteht im Bau des Gehirns der beiden
Geschlechter der Cocciden. Leider konnten nur von Lecanium corni beide Geschlechter
untersucht werden. Bei der Kleinheit der Objekte konnten spezifische Methoden keine
Anwendung finden.
a) D a s Ge h i r n d e r w e i b l i c h e n Ti e r e .
Die Weibchen der Schildläuse schließen sich in dem Bau ihres Gehirns eng an die ungeflügelten
Generationen der Pemphigini an. Bedingt ist diese weitgehende Übereinstimmung
durch das Fehlen von Fazettenaugen und die Persistenz der Larvenaugen.
Die Augen der Weibchen von Lecanium (Abb. 127) unterscheiden sich von denjenigen
der Blattläuse durch das Auftreten einer einzigen, bikonvexen Linse (L). Die Retina läßt
deutlich erkennen, daß eine Verschmelzung von drei Einzelommatidien vorliegt, besonders
auf Querschnitten tritt diese Verschmelzung klar zutage. Entsprechend der breiten Gestalt
der Tiere erreicht das Bündel der Retinafasern (Rf) beträchtliche Länge. Bei dem in Abbil-
dung 127 dargestellten Tier handelt es sich um eine Larve; bei der erwachsenen Form sind
die Retinafasern noch viel länger.
Wie bei den Larvenaugen der Pemphigini treten stets zwei optische Ganglien auf. Im
äußeren Ganglion (Abb. 127,1) endigen die Retinafasern, während das innere Ganglion (II)
die Verbindung zum Protocerebrallobus herstellt. Im Bau und in der Anordnung liegen hier
ganz ähnliche Verhältnisse vor wie bei den ungeflügelten Generationen der Pemphigini.
Am Protocerebrum läßt sich deutlich jederseits ein H auptlappen von einem Nebenlappen
unterscheiden. Die beiden Hauptlappen stehen vorn durch eine wenig strukturierte,
ovale Fasermasse m iteinander in Verbindung (Abh. 127), außerdem im Zentrum des Gehirns
durch eine Kommissur (Abb. 128, CK), welche zweifellos dem vorderen Teil des Zentralkörpers
gleichzusetzen ist. Der darunterliegende dichtstrukturierte Faserbezirk entspricht
dem unteren bzw. hinteren Teil des Zentralkörpers anderer Rhynchoten. Ein Vergleich der
Abbildung 128 mit Abbildung 121 zeigt die weitgehende Übereinstimmung mit der ungeflügelten
Generation der Pemphigini bezüglich des Zentralkörpers.
Die Pilzkörper sind nur schwer aufzufinden. Am besten gelingt das, wenn man die
Riechstränge verfolgt. Man kommt dann auf eine etwas dichter strukturierte Masse des
Protocerebrums. Diese Bezirke stellen die Pilzglomeruli dar. Die Globulizellen unterscheiden
sich nur wenig von den benachbarten Zellen.
Das Deuterocerebrum und das Tritocerebrum zeigen eine ganz ähnliche Ausbildung wie
bei den Blattläusen.
Das sympathische Nervensystem ist in Abbildung 129 dargestellt. In der Nähe des
Ganglion frontale (Gl. fr) entspringt ein zu den Muskeln der Oberlippe ziehender Labral-
nerv (N.labr.), welcher sich mehrfach verästelt. Das Ganglion hypocerebrale (Gl. hc.) steht
mit dem Frontalganglion durch den Nervus recurrens (N. r.) in Verbindung. Wir finden
somit bei den Weibchen der Cocciden alle wesentlichen Teile des sympathischen Nervensystems
wieder, welche wir bei den übrigen Rhynchoten festgestellt haben.
Die Innervation des Dorsalgefäßes und der Corpora allata erfolgt in etwas anderer
Weise als bei den Blattläusen. Die diese Organe versorgenden Nervenbündel verlassen das
Gehirn alle an dessen dorso-caudaler Seite (Abb. 128, N.Dg.), um meist senkrecht zu den
über dem Gehirn liegenden Corpora allata zu ziehen. Diese treten in Form zweier sich
median berührender großer kuglig’er Gebilde auf. Abbildung 129 veranschaulicht, daß ein
einziges Corpus allatum fast die doppelte Größe des Gehirns haben kann. Der feinere Bau
eines solchen Körpers ist in Abbildung 130 dargestellt. Man kann zwanglos eine epitheliale
Rinde (Ri) von einer aus regellos angeordneten Zellen bestehenden Markschicht (Ma) unterscheiden.
Im Mark sind zahlreiche regellos verstreute.Interzellular räume festzustellen. Die
Zellen der Rinde haben einen feinfaserigen Bau. Oft enthalten sie enge, meist leicht gewundene
Kapillaren (SK), welche wohl als Sekretkapillaren zu deuten sind.
Die Untersuchung von Entwicklungsstadien ergibt, daß die Rindenzellen die primären
Bauelemente der Corpora pedunculata sind. Sie stellen zunächst einen dem Vorderende
des Dorsalgefäßes (Dg) dicht anliegenden Zellhaufen dar (Abb. 131, C.a.). Später ordnen
sich diese Zellen in Form eines Bläschens an (Abb. 132, Ca) und beginnen schon auf diesem
Stadium zu sezernieren. Einzelne Zellen treten nun aus dem epithelialen Verband aus,
um sich in das Innere des Corpus allatum zu begeben. Die Vermehrung dieser eingewanderten
Zellen erfolgt durch Mitosen, aber auch durch Austritt weiterer Zellen aus der
Rinde. So kommt schließlich ein Bild zustande, wie es in Abbildung 130 dargestellt ist.
Der Bau und die Entwicklung der Corpora allata zeigen also deutlich, daß es sich
nicht um Ganglien oder um Derivate von Ganglien handelt, sondern um Gebilde, deren
Aufgabe es ist, irgendwelche Stoffe, über deren Bedeutung wir zunächst noch wenig wissen,