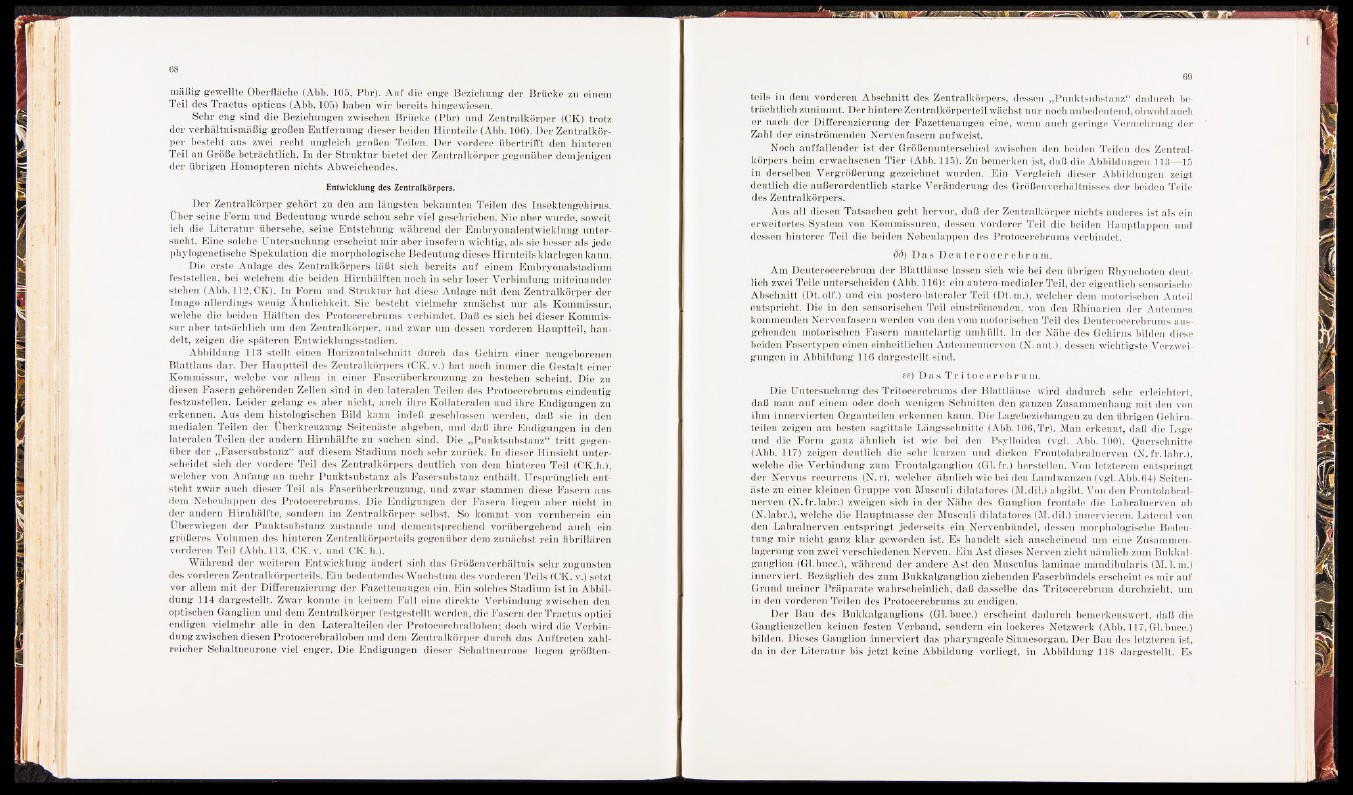
mäßig gewellte Oberfläche (Abb. 105, Pbr). Auf die enge Beziehung der Brücke zu einem
Teil des Tractus opticus (Abb. 105) haben wir bereits hingewiesen.
Sehr eng sind die Beziehungen zwischen Brücke (Pbr) und Zentralkörper (CK) trotz
der verhältnismäßig großen Entfernung dieser beiden Hirnteile (Abb. 106). Der Zentralkörper
besteht aus zwei recht ungleich großen Teilen. Der vordere übertrifft den hinteren
Teil an Größe beträchtlich. In der Struktur bietet der Zentralkörper gegenüber demjenigen
der übrigen Homopteren nichts Abweichendes.
Entwicklung des Zentralkörpers.
Der Zentralkörper gehört zu den am längsten bekannten Teilen des Insektengehirns.
Über seine Form und Bedeutung wurde schon sehr viel geschrieben. Nie aber wurde, soweit
ich die Literatur übersehe, seine Entstehung während der Embryonalentwicklung untersucht.
Eine solche Untersuchung erscheint mir aber insofern wichtig, als sie besser als jede
phylogenetische Spekulation die morphologische Bedeutung dieses Hirnteils klarlegen kann.
Die erste Anlage des Zentralkörpers läßt sich bereits auf einem Embryonalstadium
feststellen, bei welchem die beiden Hirnhälften noch in sehr loser Verbindung miteinander
stehen (Abb. 112, CK). In Form und Struktur hat diese Anlage mit dem Zentralkörper der
Imago allerdings wenig Ähnlichkeit. Sie besteht vielmehr zunächst nur als Kommissur,
welche die beiden Hälften des Protocerebrums verbindet. Daß es sich bei dieser Kommissur
aber tatsächlich um den Zentralkörper, und zwar um dessen vorderen Hauptteil, handelt,
zeigen die späteren Entwicklungsstadien.
Abbildung 113 stellt einen Horizontalschnitt durch das Gehirn einer neugeborenen
Blattlaus dar. Der Hauptteil des Zentralkörpers (CK. v.) hat noch immer die Gestalt einer
Kommissur, welche vor allem in einer Faserüberkreuzung zu bestehen scheint. Die zu
diesen Fasern gehörenden Zellen sind in den lateralen Teilen des Protocerebrums eindeutig
festzustellen. Leider gelang es aber nicht, auch ihre Kollateralen und ihre Endigungen zu
erkennen. Aus dem histologischen Bild kann indeß geschlossen werden, daß sie in den
medialen Teilen der Überkreuzung Seitenäste abgeben, und daß ihre Endigungen in den
lateralen Teilen der ändern Hirnhälfte zu suchen sind. Die „Punktsubstanz“ tritt gegenüber
der „Fasersubstanz“ auf diesem Stadium noch sehr zurück. In dieser Hinsicht unterscheidet
sich der vordere Teil des Zentralkörpers deutlich von dem hinteren Teil (CK.h.),
welcher von Anfang an mehr Punktsubstanz als Fasersubstanz enthält. Ursprünglich entsteht
zwar auch dieser Teil als Faserüberkreuzung, und zwar stammen diese Fasern aus
dem Nebenlappen des Protocerebrums. Die Endigungen der Fasern liegen aber nicht in
der ändern Hirnhälfte, sondern im Zentralkörper selbst. So kommt von vornherein ein
Überwiegen der Punktsubstanz zustande und dementsprechend vorübergehend auch ein
größeres Volumen des hinteren Zentralkörperteils gegenüber dem zunächst rein fibrillären
vorderen Teil (Abb. 113, CK.v. und CK.h.).
Während der weiteren Entwicklung ändert sich das Größenverhältnis sehr zugunsten
des vorderen Zentralkörperteils. E in bedeutendes Wachstum des vorderen Teils (CK. v.) setzt
vor allem mit der Differenzierung der Fazettenaugen ein. Ein solches Stadium ist in Abbildung
114 dargestellt. Zwar konnte in keinem Fall eine direkte Verbindung zwischen den
optischen Ganglien und dem Zentralkörper festgestellt werden, die Fasern der Tractus optici
endigen vielmehr alle in den Lateralteilen der Protocerebralloben; doch wird die Verbindung
zwischen diesen Protocerebralloben und dem Zentralkörper durch das Auftreten zahlreicher
Schaltneurone viel enger. Die Endigungen dieser Schaltneurone liegen größtenteils
in dem vorderen Abschnitt des Zentralkörpers, dessen „Punktsubstanz“ dadurch beträchtlich
zunimmt. Der hintere Zentralkörperteil wächst nur noch unbedeutend, obwohl auch
er nach der Differenzierung der Fazettenaugen eine, wenn auch geringe Vermehrung der
Zahl der einströmenden Nervenfasern auf weist.
Noch auffallender ist der Größenunterschied zwischen den beiden Teilen des Zentralkörpers
beim erwachsenen Tier (Abb. 115). Zu bemerken ist, daß die Abbildungen 113ML5
in derselben Vergrößerung gezeichnet wurden. Ein Vergleich dieser Abbildungen zeigt
deutlich die außerordentlich starke Veränderung des Größenverhältnisses der beiden Teile
des Zentralkörpers.
Aus all diesen Tatsachen geht hervor, daß der Zentralkörper nichts anderes ist als ein
erweitertes System von Kommissuren, dessen vorderer Teil die beiden Hauptlappen und
dessen hinterer Teil die beiden Nebenlappen des Protocerebrums verbindet.
<5<5) D a s De u t e r o c e r e b r um.
Am Deuterocerebrum der Blattläuse lassen sich wie bei den übrigen Rhynchoten deutlich
zwei Teile unterscheiden (Abb. 116): ein antero-medialer Teil, der eigentlich sensorische
Abschnitt (Dt. olf.) und ein postero-lateraler Teil (Dt. m.), welcher dem motorischen Anteil
entspricht. Die in den sensorischen Teil einströmenden, von den Rhinarien der Antennen
kommenden Nervenfasern werden von den vom motorischen Teil des Deuterocerebrums ausgehenden
motorischen Fasern mantelartig umhüllt. In der Nähe des Gehirns bilden diese
beiden Fasertypen einen einheitlichen Antennennerven (N. ant.), dessen wichtigste Verzweigungen
in Abbildung 116 dargestellt sind.
ee) D a s T r i t o c e r e b r um .
Die Untersuchung des Tritocerebrums der Blattläuse wird dadurch sehr erleichtert,
daß man auf einem oder doch wenigen Schnitten den ganzen Zusammenhang mit den von
ihm innervierten Organteilen erkennen kann. Die Lagebeziehungen zu den übrigen Gehirnteilen
zeigen am besten sagittale Längsschnitte (Abb. 106, Tr). Man erkennt, daß die Lage
und die Form ganz ähnlich ist wie bei den Psylloidea (vgl. Abb. 100). Querschnitte
(Abb. 117) zeigen deutlich die sehr kurzen und dicken Frontolabralnerven (N. fr. labr.),
welche die Verbindung zum Frontalganglion (Gl.fr.) hersteilen. Von letzterem entspringt
der Nervus recurrens (N. r), welcher ähnlich wie bei den Landwanzen (vgl. Abb. 64) Seitenäste
zu einer kleinen Gruppe von Musculi dilatatores (M.dil.) abgibt. Von den Frontolabralnerven
(N. fr. labr.) zweigen sich in der Nähe des Ganglion frontale die Labrainerven ab
(N.labr.), welche die Hauptmasse der Musculi dilatatores (M.dil.) innervieren. Lateral von
den Labrainerven entspringt jederseits ein Nervenbündel, dessen morphologische Bedeutung
mir nicht ganz klar geworden ist. Es handelt sich anscheinend um eine Zusammenlagerung
von zwei verschiedenen Nerven. Ein Ast dieses Nerven zieht nämlich zum Bukkalganglion
(Gl.bucc.), während der andere Ast den Musculus laminae mandibularis (M. 1. m.)
innerviert. Bezüglich des zum Bukkalganglion ziehenden Faserbündels erscheint es mir auf
Grund meiner Präparate wahrscheinlich, daß dasselbe das Tritocerebrum durchzieht, um
in den vorderen Teilen des Protocerebrums zu endigen.
Der Bau des Bukkalganglions (Gl.bucc.) erscheint dadurch bemerkenswert, daß die
Ganglienzellen keinen festen Verband, sondern ein lockeres Netzwerk (Abb. 117, Gl. bucc.)
bilden. Dieses Ganglion innerviert das pharyngeale Sinnesorgan. Der Bau des letzteren ist,
da in der Literatur bis jetzt keine Abbildung vorliegt, in Abbildung 118 dargestellt. Es