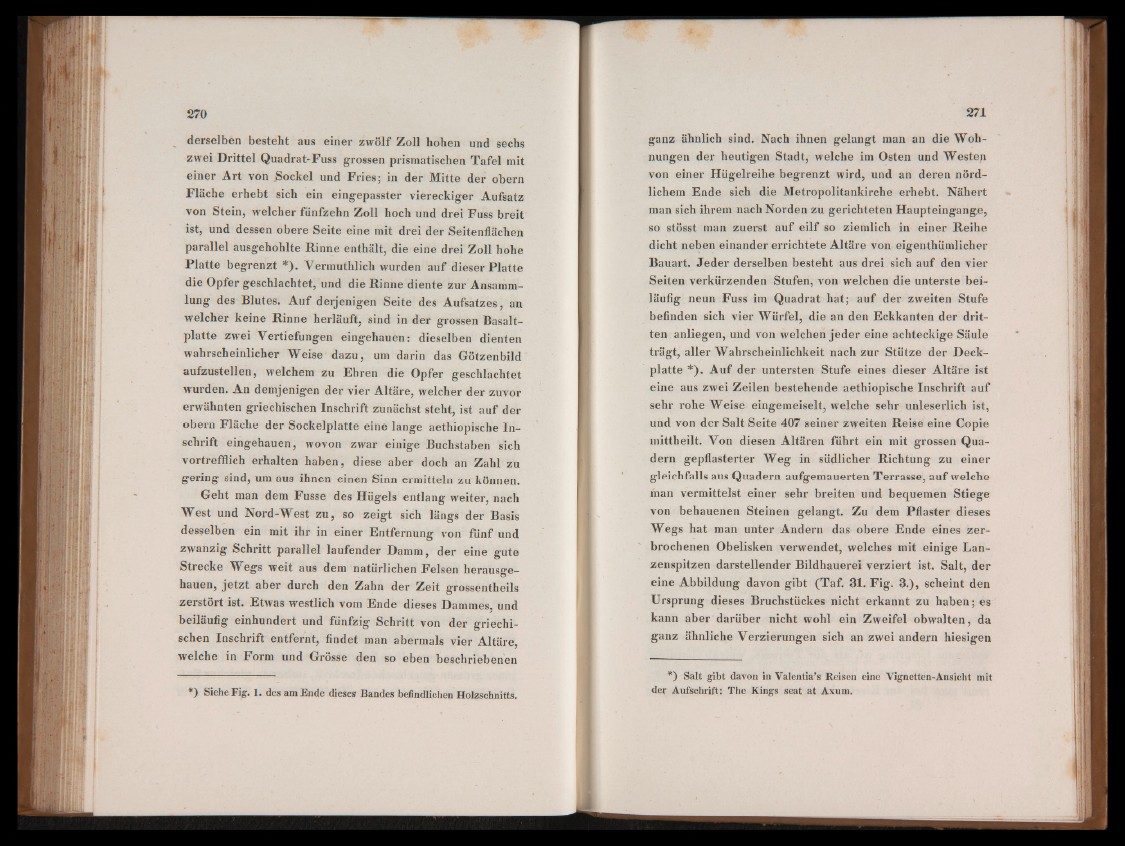
derselben besteht aus einer zwölf Zoll hohen und sechs
zwei Drittel Quadrat-Fuss grossen prismatischen Tafel mit
einer Art von Sockel und Fries; in der Mitte der obern
Fläche erhebt sich ein eingepasster viereckiger Aufsatz
von Stein, welcher fünfzehn Zoll hoch und drei Fuss breit
ist, und dessen obere Seite eine mit drei der Seitenflächen
parallel ausgehohlte Rinne enthält, die eine drei Zoll hohe
Platte begrenzt *). Vermuthlich wurden auf dieser Platte
die Opfer geschlachtet, und die Rinne diente zur Ansammlung
des Blutes. Auf derjenigen Seite des Aufsatzes, an
welcher keine Rinne herläuft, sind in der grossen Basaltplatte
zwei Vertiefungen eingehauen: dieselben dienten
wahrscheinlicher Weise dazu, um darin das Götzenbild
aufzustellen, welchem zu Ehren die Opfer geschlachtet
wurden. An demjenigen der vier Altäre, welcher der zuvor
erwähnten griechischen Inschrift zunächst steht, ist auf der
obern Fläche der Sockelplatte eine lange aethiopische Inschrift
eingehauen, wovon zwar einige Buchstaben sich
vortrefflich erhalten haben, diese aber doch an Zahl zu
gering sind, um aus ihnen einen Sinn ermitteln zu können.
Geht man dem Fusse des Hügels entlang weiter, nach
West und Nord-West zu, so zeigt sich längs der Basis
desselben ein mit ihr in einer Entfernung von fünf und
zwanzig Schritt parallel laufender Damm, der eine gute
Strecke Wegs weit aus dem natürlichen Felsen herausee-
hauen, jetzt aber durch den Zahn der Zeit grossentheils
zerstört ist. Etwas westlich vom Ende dieses Dammes, und
beiläufig einhundert und fünfzig Schritt von der griechischen
Inschrift entfernt, findet man abermals vier Altäre,
welche in Form und Grösse den so eben beschriebenen
*) Siehe Fig. 1. des am Ende dieses Bandes befindlichen Holzschnitts.
ganz ähnlich sind. Nach ihnen gelangt man an die Wohnungen
der heutigen Stadt, welche im Osten und Westen
von einer Hügelreihe begrenzt wird, und an deren nördlichem
Ende sich die Metropolitankirche erhebt. Nähert
man sich ihrem nach Norden zu gerichteten Haupteingange,
so stösst man zuerst auf eilf so ziemlich in einer Reihe
dicht neben einander errichtete Altäre von eigenthümlicher
Bauart. Jeder derselben besteht aus drei sich auf den vier
Seiten verkürzenden Stufen, von welchen die unterste beiläufig
neun Fuss im Quadrat hat; auf der zweiten Stufe
befinden sich vier Würfel, die an den Eckkanten der dritten
anliegen, und von welchen jeder eine achteckige Säule
trägt, aller Wahrscheinlichkeit nach zur Stütze der Deckplatte
*). Auf der untersten Stufe eines dieser Altäre ist
eine aus zwei Zeilen bestehende aethiopische Inschrift auf
sehr rohe Weise eingemeiselt, welche sehr unleserlich ist,
und von der Salt Seite 407 seiner zweiten Reise eine Copie
mittheilt. Von diesen Altären führt ein mit grossen Quadern
gepflasterter Weg in südlicher Richtung zu einer
gleichfalls aus Quadern aufgemauerten Terrasse, auf welche
man vermittelst einer sehr breiten und bequemen Stiege
von behauenen Steinen gelangt. Zu dem Pflaster dieses
Wegs hat man unter Ändern das obere Ende eines zerbrochenen
Obelisken verwendet, welches mit einige Lanzenspitzen
darstellender Bildhauerei verziert ist. Salt, der
eine Abbildung davon gibt (Taf. 31. Fig. 3.), scheint den
Ursprung dieses Bruchstückes nicht erkannt zu haben; es
kann aber darüber nicht wohl ein Zweifel obwalten, da
ganz ähnliche Verzierungen sich an zwei ändern hiesigen
*) Salt gibt davon in Valentia’s Reisen eine Vignetten-Ansicht mit
der Aufschrift: The Kings seat at Axum.