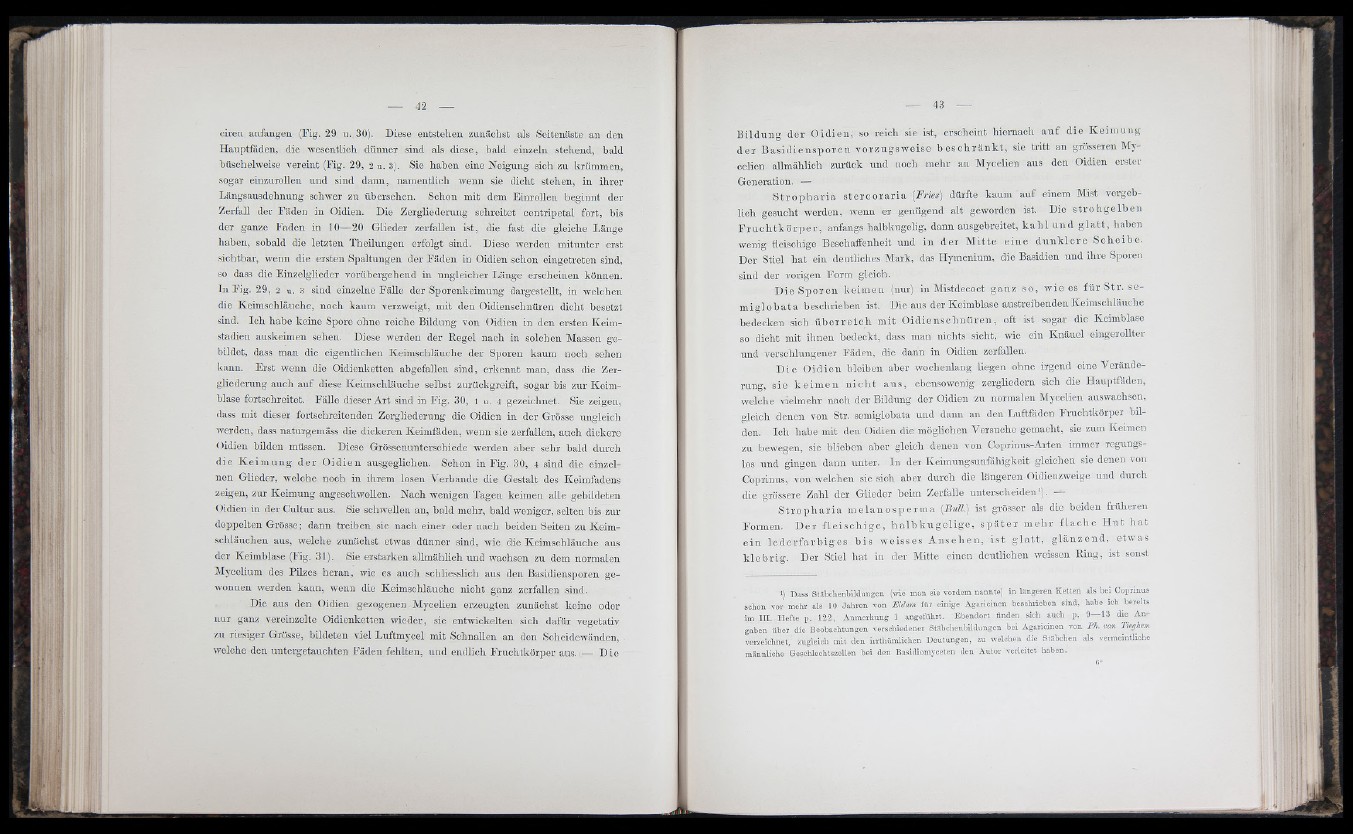
cireii anfangen (Fig. 29 u. 30). Diese entstellen zunächst als Seitenäste an den
Hauptfädcii, die wesentlicli d ünner sind als diese, bald einzeln stehend, bald
büscbolweise vereint (Fig. 29, 2 a. 3). Sie h ab en eine Neigung sich zn krümmen,
sogar einziirollen u n d sind dan n , namentlicli wenn sie dicht stehen, in ih re r
Längsausdehnung schwer zu übersehen. Schon mit dem Einrollen b eg in n t der
Zerfall dev Fäd en in Oidien. Die Zergliederung sch reitet cen trip etal fo rt, bis
der ganze Fad en in 10—20 Glieder zerfallen ist, die fast die gleielie Länge
haben, sobald die le tzten Th e ilu n g en erfolgt sind. Diese werden mitu n te r erst
sichtbar, wenn die ersten Spaltungen der F äd en in Oidien schon eingetreten sind,
so dass die Einzelglieder v orübergehend in u n g le ich er Länge erscheinen können.
In Fig. 29, 2 u. 3 sind einzelne Fä lle der Sporenkeimnng dargestellt, in welchen
die Keimschläiiclie, noch kaum verzweigt, mit den Oidienschnüren dich t besetzt
sind. Ich h abe k eine Spore ohne re ich e Bildung von Oidien in den ersten Keim-
stadieii auskeimen sehen. Diese werden der Kegel nach in solchen Massen gebildet,
dass man die eigentlichen Keimschläuche der Sporen kaum noch sehen
kann. E rst wenn die Oidienketten abgefallen sind, e rk en n t man, dass die Zergliederung
auch au f diese Keimschläuche selbst zurückgreift, sogar bis zur Keimblase
fortsohreitet. Fä lle dieser A rt sind in Fig. 30, 1 u. 4 gezeichnet. Sie zeigen,
dass mit dieser fortschreitenden Zergliederung die Oidien in der Grösse ungleich
werden, dass natnrgemäss die dickeren Keimfäden, wenn sie zerfallen, auch dickere
Oidien bilden müssen. Diese Grössenunterschiede werden aber sehr bald durch
d ie K e im u n g d e r O id i e n ausgeglichen. Schon in Fig. 30, 4 sind die einzeln
en Glieder, welche noch in ihrem losen Verb än d e die Gestalt des Keimfadens
zeigen, zur Keimung angeschwoUen. Nach wenigen Tagen keimen alle gebildeten
Oidien in der Cultur aus. Sie schwellen an, b ald mehr, bald weniger, selten bis zur
doppelten Grösse; dann tre ib en sie n ach einer oder nach beid en Seiten zu Keimschläuchen
aus, welche zunächst etwas d ü n n e r sind, wie die Keimschläuche aus
der Keimblase (Fig. 31). Sie ersta rken allmählich u n d wachsen zu dem normalen
Mycelium des Püzes h e ra n , wie es ancli schliesslich aus den Basidiensporen gewonnen
werden kann, wenn die Keimschläuche n ich t ganz zerfallen sind.
Die aus den Oidien gezogenen Mycelien erzeugten zunä chst keine oder
n u r ganz vereinzelte Oidienketten w ied e r, sie entwickelten sich dafür vegetativ
zu riesiger Grösse, b ildeten viel Luftmycel mit Schnallen an den Scheidewänden,
welche den u n te rg etau o h ten Fäd en feh lten , u n d endlich F ru ch tk ö rp e r aus. — D ie
B i ld u n g d e r O id i e n , so re ich sie ist, erscheint h iernacli a u f d io K e im u n g
d e r B a s i d i e n s p o r e n v o r z u g sw e i s e b e s c h r ä n k t , sie tritt an grösseren Mycelien
allmählich zurück u n d noch m eh r an Mycelien aus den Oidien erster
Generation. —
S t r o p h a r i a s t e r c o r a r i a [Fries] dürfte kaum au f einem Mist vergeblich
gesucht werden, wenn er genügend a lt geworden ist. Die s t r o h g e l b e n
F r u c h t k ö r p e r , anfangs halbkugelig, dann ausgebreitet, k a h l u n d g l a t t , h ab en
wenig fleischige Beschaffenheit n n d in d e r M i t t e e i n e d u n k l e r e S c h e i b e .
D er Stiel h a t ein deutliches Mark, das Hymenium, die Basidien u n d ih re Sporen
sind der vorigen F o rm gleich.
D ie S p o r e n k e im e n (nur) in Mistdecoct g a n z s o , w i e es f ü r S t r . s e -
m i g l o h a t a beschrieben ist. Die aus der Keimblase austre ibenden Keimschläuche
b edecken sich ü b e r r e i c h m i t O i d i e n s c h n ü r e n , oft ist sogar die Keimblase
so dicht mit ih n en b ede ckt, dass man niclits sieht, wie ein K n äu e l eingerollter
und verschlungener Fäden, die dann in Oidien zerfahen.
D i e O id i e n b le ib en ab e r wochenlang liegen ohne irgend eine Veränderu
n g , s i e k e im e n n i c h t a u s , ebensowenig zergliedern sich die Hauptfäden,
welche v ielmehr n ach der Bildung der Oidien zu normalen Mycelien auswachsen,
gleich denen von Str. semiglobata u n d dann an den Lnftfäden F ru ch tk ö rp e r b ilden.
Ich h abe mit den Oidien die möglichen Versuche gemacht, sie zum Keimen
zu bewegen, sie b lieb en abe r gleicli denen von Coprinus-Arten immer regungslos
u n d gingen dann n n te r. In der Keimungsunfähigkeit gleichen sie denen von
Coprinus, von welchen sie sich aher d u rch die län g e ren Oidienzweigo u n d durch
die grössere Zahl der Glieder beim Zerfalle u n te rsch e id en '). —
S t r o p h a r i a m e l a n o s p e rm a [Bull] ist grösser als die beiden früheren
Formen. D e r f l e i s c h i g e , h a l b k u g e l i g e , s p ä t e r m e h r f l a c h e H u t h a t
e i n l e d e r f a r b i g e s b i s w e i s s e s A n s e h e n , i s t g l a t t , g l ä n z e n d , e tw a s
k l e b r i g . Der Stiel h a t in der M itte einen deutlichen weissen R in g , ist sonst
1) Dass Stiibchenljildungen (wie man sie vordem nannte] in längeren Ketten als b e i Coimnus
schon vor mehr als 10 Jahren von JSidam für einige Agaricinen beschrieben sind, habe ich bereits
im III. H efte p. 1 2 2 , Anmerkung 1 angeführt. Ebendort finden sich auch p. 9 13 d ie A n gaben
über die Beobachtungen verschiedener Stäbchenbildungen b ei Agaricinen von P L van Tieghem
verzeichnet, zugleich m it den irrthümlichen D eutungen, zu welchen die Stäbchen als vermeintliche
männliche Geschlechtszellen b e i den Basidiomyceten den Autor verleitet haben.