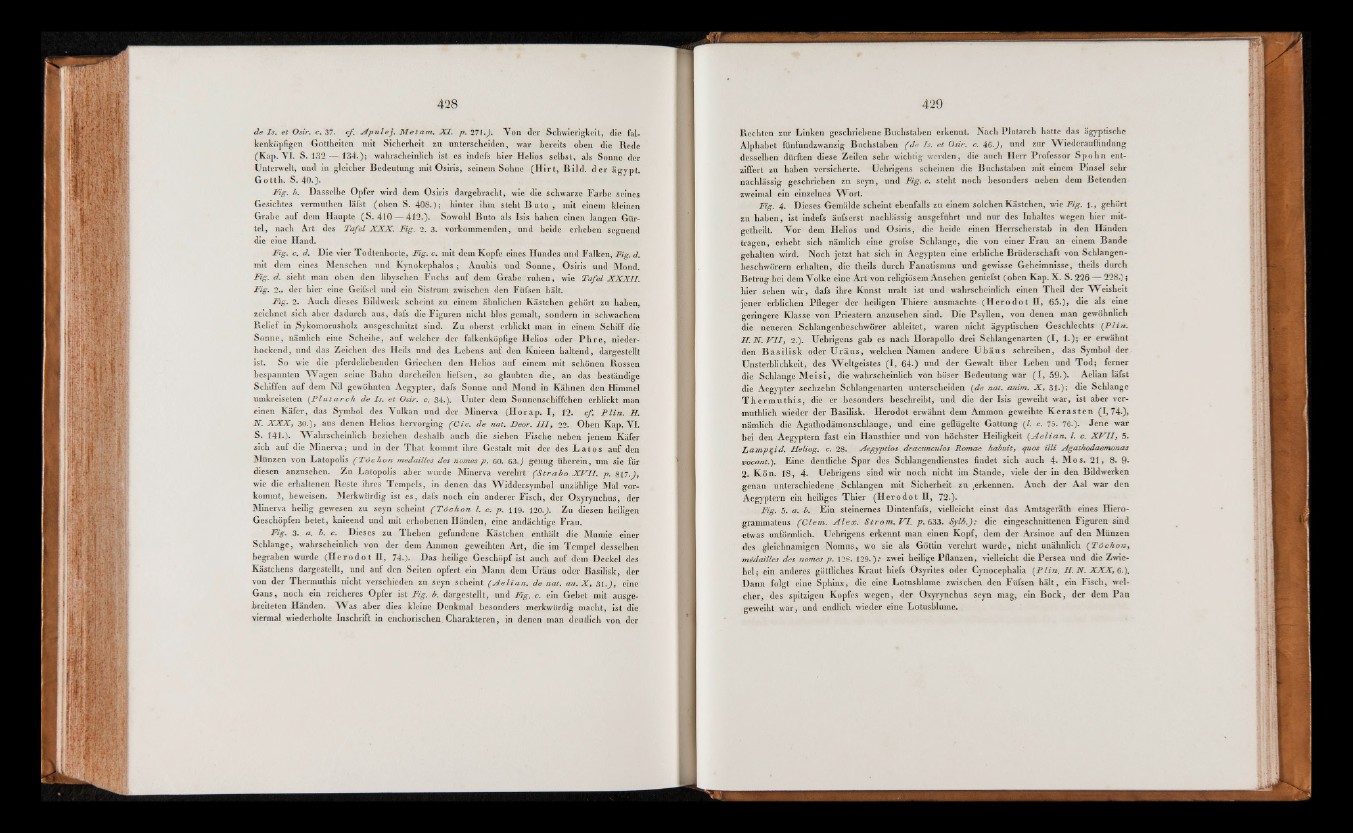
de Is. et Osir. c. 37. cf. A p u l e j . M e tarn. X I . p. 27 I.) . V o n der Schwierigkeit, die falkenköpfigen
Gottheiten mit Sicherheit zu unterscheiden, war bereits oben die Rede
(Kap . VI. S. 132 — 1 3 4 .); wahrscheinlich is t es indefs hie r Helios selbst, als Sonne der
Unterwelt, und in gleicher Bedeutung mit Osiris, seinem Sohne (H i r t , B ild , d e r ä g y p t.
G o t th . S. 4 0.).
Fig. b. Dasselbe Opfer wird dem Osiris dargebracht, wie die schwarze Farb e seines
Gesichtes vermuthen läfst (oben S. 4 0 8 .); hinter ihm steht B u t o , mit einem kleinen
Grabe au f dem Haupte (S . 410 — 412.). Sowohl Bnto als Isis haben einen langen Gürte
l, nach Art des T a fe l X X X . Fig. 2. 3. vorkommenden, u n d beide erheben segnend
die eine Hand.
Fig. c. d. Die vier T odtenhorte, Fig. c. mit dem Kopfe eines Hundes und Falken, Fig. d.
mit dem eines Menschen u n d Kynokephalos ; Anubis u n d S o n n e, Osiris und Mond.
Fig. d. sieht man oben den libyschen Fuchs au f dem Grabe ro h en , wie T a fe l X X X I I .
Fig. 2., der hier eine Geifsel und ein Sistrnm zwischen den Fiifsen hält.
Fig. 2. Auch dieses Bildwerk scheint zu einem ähnlichen Kästchen gehört zu haben,
zeichnet sich aber dadurch aus, dafs die Figuren nicht blos gemalt, sondern in schwachem
Relief in jSykomorusholz ausgeschnitzt sind. Z u oberst erblickt man in einem Schiff die
S o n n e, nämlich eine Scheibe, au f welcher der falkenköpfige Helios oder P h r e , nieder-
hockcnd, und das Zeichen des Heils u n d des Lebens au f den Knieen h alten d , dargestellt
ist. So wie die pferdehebenden Griechen den Helios au f einem mit schönen Rossen
bespannten W a g e n seine B ah n durcheilen liefsen, so glaubten die, an das beständige
Schiffen au f dem Nil gewöhnten Acgypter, dafs Sonne und Mond in Kähnen den Himmel
umkreiseten (P l u t a r c h de Is. et Osir. c. 34.). U n ter dem Sonnenschiffchen erblickt man
einen Käfer, das Symbol des Vulkan und der Minerva (H o r a p . I , 12. cf. P l in . H.
N . X X X , 30.), aus denen Helios hervorging (C ic . de nat. Deor. I I I , 22. Oben Kap. VI.
S. 141.). W ah rsch e in lich beziehen deshalb auch die sieben Fische neben jenem Käfer
sich au f die Minerva; und in der T h a t kommt ihre Gestalt mit der des L a t o s au f den
Münzen von Latopolis ( T ö c h o n medailles des nomes p. 60. 63.) genug überein, um sie für
diesen anzusehen. Z n Latopolis abe r wurde Minerva verehrt ( S t r a b o X V I I . p. 817.),
wie die erhaltenen Reste ihres Tempels, in denen das Widdersymbol unzählige Mal vorkommt,
beweisen. Merkwürdig is t es, dafs noch ein anderer Fisch , d e r Oxyrynchus, der
Minerva heilig gewesen zu seyn scheint ( T ö c h o n l. c. p. 119. 120.). Z u diesen heiligen
Geschöpfen b ete t, knieend u n d mit erhobenen H än d en , eine andächtige F rau .
Fig. 3. a. b. c. Dieses zu Theben gefundene Kästchen enthält die Mumie einer
Schlange, wahrscheinlich von der dem Ammon geweihten A rt, die im Tempel desselben
begraben wurde (H e r o d o t I I , 74.). Das heilige Geschöpf ist auch au f dem Deckel des
Kästchens dargestellt, und au f den Seiten opfert ein Mann dem Uräus oder Basilisk, der
von der Thermuthis nicht verschieden zu seyn scheint ( A e l i a n . de nat. an. X , 31. ), eine
G an s, noch ein reicheres O pfer is t Fig. b. dargestellt, u n d Fig. c. ein Gebet mit ausgebreiteten
Händen. W a s abe r dies kleine Denkmal besonders merkwürdig macht, is t die
viermal wiederholte Inschrift in enchorischen. Charakteren, in denen man deutlich von der
Rechten zur Linken geschriebene Buchstaben erkennt. Nach Pluta rch hatte das ägyptische
Alphabet fünfundzwanzig Buchstaben (d e Is. et Osir. c. 46• ), u n d zur Wiederauffindung
desselben dürften diese Zeilen sehr wichtig werden, die auch H e rr P ro fesso r S p o h n entziffert
zu haben versicherte. Uebrigens scheinen die Buchstaben mit einem Pinsel sehr
nachlässig geschrieben zu seyn, u n d Fig. c. steht noch besonders neben dem Betenden
zweimal ein einzelnes W o r t .
Fig. 4. Dieses Gemälde scheint ebenfalls zu einem solchen K ästchen, wie Fig. \ . , gehört
zu h ab e n , is t indefs äufserst nachlässig ausgeführt u n d n u r des Inhaltes wegen hier mit-
gctheilt. V o r dem Helios u n d Osiris, die beide einen Herrscherstab in den Händen
trag en , erhebt sich nämlich eine grofse Schlange, die von einer F ra u an einem Bande
gehalten wird. Noch jetzt h a t sich in Aegypten eine erbliche Brüderschaft von Schlangenbeschwörern
erhalten, die theils durch Fanatismus u n d gewisse Geheimnisse, theils durch
Betrug hei dem Volke eine Art von religiösem A nsehen genieist (oben Kap. X . S. 226 — 228.) ;
hier sehen w ir, dafs ihre K unst u ralt is t u n d wahrscheinlich einen T h e il der W e is h e it
jener erblichen Pfleger der heiligen Thiere ausmachte (H e r o d o t I I , 6 5 .), die als eine
geringere Klasse von Prieste rn anzusehen sind. Die P syllen, von denen man gewöhnlich
die neueren Schlangenbeschwörer ableitet, waren nicht ägyptischen Geschlechts (P l in .
H. N . V I I , 2.). Uebrigens gab es nach Horapollo drei Schlangenarten ( I , 1 .); er erwähnt
den B a s i l i s k oder U r ä u s , welchen Namen andere U b ä u s schreiben, das Symbol der
Unsterblichkeit, des W e ltg e is te s ( I , 6 4 .) und der Gewalt über Leh en u n d T o d ; ferner
die Schlange M e i s i , die wahrscheinlich von böser Bedeutung war ( I , 5 9 .). Aelian läfst
die Acgypter sechzehn Schlangenarten unterscheiden {de nat. anim. X , 31.); die Schlange
T h e rm u t h i s , die er besonders beschreibt, u n d die der Isis geweiht war, is t aber ver-
muthlich wieder der Basilisk. Herodot erwähnt dem Ammon geweihte K e r a s t e n (1,74.),
nämlich die Agathodämonschlangc, u n d eine geflügelte Gattung (/. c. 75. 76-)- J en e war
bei den Aegyptern fast ein Hausthier u n d von höchster Heiligkeit (A e l i a n . I. c. X V I I , 5.
L a m p ç id . Heliog. c. 28. Aegyptios dracunculos Romae habuit, quos ïlli Agathodaemonas
vocant.). Eine deutliche Spur des Schlangendienstes findet sich auch 4. M o s . 21, 8. 9.
2. K ö n . 18, 4. Uebrigens sind wir noch nicht im S tan d e , viele der in den Bildwerken
genau unterschiedene Schlangen mit Sicherheit zu ,erkennen. Auch der Aal war den
Aegyptern ein heiliges T h ie r (H e r o d o t I I , 72.).
Fig. 5. a. b. Ein steinernes Dintenfafs, vielleicht einst das Amtsgeräth eines Hiero-
grammateus (C lem . A l e x . S tr o m . V I . p . 633. Sylb.J; die eingeschnittenen Figuren sind
etwas unförmlich. Uebrigens erkennt man einen Kopf, dem der Arsinoe auf den Münzen
des gleichnamigen Nomus, wo sie als Göttin verehrt wurde, nicht unähnlich ( T ö c h o n ,
médailles des nomes p . 128. 129.)»' zwei heilige Pflanzen, vielleicht die Persea und die Zwiebel;
ein anderes göttliches Kraut hiefs Osyrites oder Gynocephalia [ P lin . H .N .X X X , 6.).
Dann folgt eine Sphinx, die eine Lotushlume zwischen den Fiifsen hält, ein Fisch, welcher,
des spitzigen Kopfes wegen, der Oxyrynchus seyn mag, ein Bock, der dem Pan
geweiht war, und endlich wieder eine Lotushlume.